

Arbeit und Beruf gelten bei Jugendlichen als zentrale Schlüsselkategorien für die eigene Lebensgestaltung, die Verwirklichung von Zukunftsinteressen und zur Identitätsbildung belegt eine von der ver.di-Jugend [1] in Auftrag gegebene Studie aus dem Jahr 2001.
Viele SchülerInnen erleben aber die so genannte erste Schwelle als unübersichtlich, verunsichernd und fühlen sich überfordert. Der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung, die Wahl des Grundbausteins für eine erfolgreiche Berufsplanung also, erscheint zum Teil sogar als bedrohlich. Eine Begründung ist die durch die Bildungsstruktur in Deutschland erzeugte Distanz von der Schule zur Arbeitswelt. Eine stärkere Verzahnung der beiden Bereiche könnte sicherlich dazu beitragen, die Grenzen fließender zu gestalten.
Bereits Kinder sammeln beispielsweise Arbeitswelt-Erfahrungen durch berufstätige oder arbeitslose Eltern und Bekannte. Jugendliche tragen Zeitungen aus, sind Babysitter oder bessern mit anderen Nebenjobs ihr Taschengeld auf. Sie haben also frühzeitig Berührung mit der Arbeitswelt. Diese vorhandenen Erfahrungen könnten schon in der Schule genutzt werden und fächerübergreifend in den Unterricht einfließen, um den Übergang zwischen allgemeinem und beruflichem Bildungssystem zu lockern.
Mit zunehmendem Alter sammeln die SchülerInnen aktuelle Informationen über den Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt und orientieren sich an Erfahrungen und Wissen von Bekannten und Verwandten. Ihre Vorstellungen vom Traumberuf ihrer Kindheit gerät zugunsten einer "vernünftigen" Entscheidung in Vergessenheit. So wird dieser Übergang nicht mehr mit Neugier und Spannung, sondern häufig als Bürde erlebt. Die unter diesen Bedingungen getroffene Berufswahlentscheidung löst oftmals Frustration aus, die bis hin zu Ausbildungsabbrüchen führen kann.
Um die Ausbildungs- und Arbeitsfähigkeit junger Menschen zu stärken, muss Berufsorientierung heute deshalb als schulübergreifende Aktivität verschiedener Akteure begriffen werden, zu denen nicht nur Eltern, Schule und Arbeitsämter, sondern auch Betriebe, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände zählen. SchülerInnen sollten diesem Übergang nicht mit Angst entgegen gehen, sondern diese Phase motiviert, engagiert und selbstbewusst gestalten können. Dazu benötigen sie Wissen über die eigenen Fähigkeiten und Stärken, aber auch aktuelles "Arbeitsweltwissen". Deutlich werden muss, dass die Wahl der Berufsausbildung nur das "Handwerkszeug", die Grundlage für den späteren beruflichen Werdegang ist und dass man mit dem Ausbildungsberuf eine Vielzahl an beruflichen Laufbahnen einschlagen kann.
Das Projekt Perspektive.Plus [2] der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) [3] nimmt genau dies zum Ausgangspunkt. Mit praktischen Angeboten für allgemein bildende Schulen und entsprechenden Konzepten zur Sicherung der Nachhaltigkeit wird hier ein wichtiger Beitrag zur Vernetzung der oben genannten Kooperationspartner geleistet.
In insgesamt zwei Projektwochen bietet ver.di Lebens- und Berufswahlthemen in folgenden Bereichen:
Diese für viele SchülerInnen neue Lernform verspricht Spaß und ermöglicht so eine lockere Herangehensweise an ein Thema, das für die berufliche und private Zukunft aller entscheidend ist.
Wirtschaftliche Zusammenhänge werden hier transparent und erfahrbar gemacht und bieten einen guten Einstieg in die ökonomische Bildung.
Arbeit "zum Anfassen": SchülerInnen verbringen einen Tag mit Auszubildenden und AusbildungsleiterInnen im Betrieb und können verschiedene Berufe erleben.
In 3 Phasen (2- bis 3-tägig) können Befürchtungen geäußert, Utopien entwickelt und anschließend kleine Einzelschritte erarbeitet werden, wie der Einstieg ins Berufsleben konkret entwickelt werden kann.
In dieser Einheit, in der auch nach Geschlechtern getrennt gearbeitet wird, geht es um Ursachen und Zusammenhänge, die Unterschiede und Ungleichheiten in der Arbeitswelt transparent machen.
Um wichtige Ausbildungsschritte zu planen, müssen die SchülerInnen sich selbst besser kennen lernen und mit der eigenen Entwicklung bewusst auseinander setzen.
Was bedeutet Erwerbstätigkeit in Bezug auf die soziale Integration, Sicherung des Lebensunterhalts und Identitätsbildung?
Hier bietet ver.di konkrete Hilfestellungen bei Bewerbungsverfahren, denen die SchülerInnen sich in Zukunft stellen werden müssen.
Weitere Informationen zu Perspektive.Plus gibt's im Internet unter:
| oder bei: | |
| Sabine Daß und Bärbel Lübke | |
| ver.di Bundesvorstand | |
| Bereich Jugend | |
| Tel. : 040/43915-494 oder - 342 | |
| Email: | sabine.dass@verdi.de [7] |
| baerbel.luebke@verdi.de [8] | |
Zu den neuen Herausforderungen des Projektes gehört, die regional geknüpften Kontakte zwischen Schule und Betrieb zu pflegen und zu erweitern. Die vorhandenen Seminarmaterialien zur Berufsorientierung und Lebensplanung werden daher nicht nur auf die PISA-Ergebnisse, das Forum Bildung, Gender Mainstreaming und strukturelle regionale Besonderheiten Rücksicht nehmen, sondern in Zukunft interaktiv auf einer Projekt-Website zur Verfügung stehen. Hier bietet sich zusätzlich die Möglichkeit, in Form von Foren oder Chatrooms einen direkten und aktuellen Kontakt von der Schule zu unseren Jugend- und Auszubildendenvertretungen in den Betrieben herzustellen. Darüber hinaus sichert ein Referenzschulkonzept die nachhaltige Vernetzung von Betrieb und Schule.
Die Projekt-Website soll:
Durch interaktiv und spielerisch umgesetzte Angebote aus den Seminarmaterialien "Berufsorientierung und Lebensplanung" sollen Jugendliche erste Schritte zum eigenen Lebens- und Berufsplan gehen, eigene Interessen und Fähigkeiten kennen lernen, Berufsprofile erforschen und Tipps zur Vorbereitung auf den Ernstfall "Bewerbung" bekommen. Die interaktiven Angebote auf der Website sollen Lust darauf machen, sich in Präsenzseminaren intensiver und erfahrungsbezogen mit der eigenen Berufsperspektive auseinander zu setzen.
Die am Projekt Perspektive.Plus beteiligten Betriebe, die KontaktpartnerInnen von ver.di und die Schulen haben hier die Möglichkeit, ihre durch die Präsenzveranstaltungen (Planspiel, Schnuppertage, Seminare) entstandenen Kontakte zu pflegen und zu verstetigen. Die Jugendlichen können sich direkt an AnsprechpartnerInnen in den Betrieben und bei ver.di wenden und mit ihnen per Chat, im Forum oder per E-Mail kommunizieren.
Berufsweltorientierung ist ein wichtiger Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Sie kann nicht nur die Auswahl des einen Berufs, der passt, zum Ziel haben. Für Jugendliche, die ihre persönliche Berufsstrategie finden wollen, ist daher die individuelle Beratung unverzichtbar. Mit der virtuellen Beratung durch ver.di-TutorInnen kann hier neben dem Beratungsangebot in der ver.di-Geschäftsstelle ein zusätzlicher Service aufgebaut werden. Die Erfahrung zeigt, dass Online-Beratung erste Hemmschwellen abbauen und zum anschließenden Besuch von Präsenzveranstaltungen motivieren kann.
Im Perspektive Treff:
haben die Jugendlichen in einem Online-Forum die Möglichkeit, Erfahrungen und Informationen auszutauschen und sich online beraten zu lassen. Die Kommunikation ist asynchron über themenorientierte Diskussionsgruppen möglich. Dabei orientieren sich Themen am Seminarablauf, z. B. "Traumberuf" oder "Berufsstart". Aber natürlich können die Jugendlichen auch selbst Themen in freien Diskussionsgruppen vorschlagen und einrichten.
Im Chatroom können regelmäßig moderierte Live-Chats
mit ExpertInnen aus der Arbeitswelt stattfinden.
Zur konzeptionellen Unterstützung der Zusammenarbeit von Schulen mit außerschulischen Kooperationspartnern wird das Referenzschulkonzept entwickelt, das zunächst in Hamburg erprobt werden soll. Anschließend wird das Konzept in weitere Bundesländer übertragen.
Um ein sich selbst tragendes Netzwerk von Schulen mit außerschulischen Kooperationspartnern zu erhalten, entstand die Idee eines Referenzschulkonzepts. Schulen können so Seminareinheiten zu Berufswahlthemen mit Betrieben und Gewerkschaften, später auch mit anderen Beteiligten des Arbeitsmarktes in Eigenregie planen und für die konkrete Seminararbeit Expertenwissen hinzuziehen.
Zum System:
Referenzschule bedeutet, eine nach bestimmten Kriterien ausgewählte Schule
Die Referenzschule kann in der Projektphase die kontinuierliche Beratung durch Perspektive.Plus-MitarbeiterInnen nutzen, die den konkreten organisatorischen und inhaltlichen Ablauf, die kontinuierliche Beratung der LehrerInnen und die Unterstützung der betrieblichen Ansprache beinhaltet. Der Referenzschule stehen die TeamerInnen von Perspektive.Plus für den Zeitraum der Förderung mit Mitteln des BMBF [4] kostenfrei zur Verfügung. Andere Schulen müssen sukzessive einen Teil der Kosten durch andere Finanzierungsmodelle abdecken. Auch hier erarbeitet Perspektive.Plus [2] Lösungsvorschläge.
Die Schule kann zwischen sämtlichen Bausteinen der Projektwochen wählen, die entweder als einzelne Blöcke oder als komplette Wochen durchgeführt werden. Hauptamtliche ver.di-MitarbeiterInnen und Ehrenamtliche aus den Betrieben können für vertiefende Seminareinheiten zum Thema Gewerkschaften und branchenspezifische Kenntnisse eingesetzt werden.
Die Referenzschule beteiligt sich an der Vernetzung Schule, Betrieb und Gewerkschaft/ außerschulische KooperationspartnerInnen. In Form von Feedback-Gesprächen liefert sie Hinweise über Besonderheiten und Bedürfnisse der Schule und unterstützt so die differenzierte Entwicklung eines Modellkonzepts. In der Folge dient sie als Beraterin für andere Schulen ihrer Region, die auf Grundlage der von Perspektive.Plus erarbeiteten Handreichungen ebenfalls ein Interesse an der Durchführung der Projektbausteine haben.
Gemeinsam mit der Referenzschule entwickelt Perspektive.Plus einen Handlungskatalog (Check-Liste) für andere Schulen, der die notwendigen Arbeitsschritte zur Durchführung jeder Seminareinheit konkret nachvollziehbar dokumentiert.
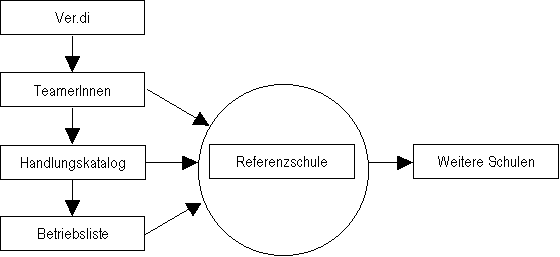 |
Das Konzept bietet die Möglichkeit, in einem weiteren Schritt andere KooperationspartnerInnen in die Strukturen einzubinden.
Zur Funktion:
Ziel des Referenzschulkonzepts ist, allgemein bildende Schulen zu unterstützen, den Berufsorientierungsunterricht in Zusammenarbeit mit außerschulischen KooperationspartnerInnen systematisch zu organisieren. Die entstehenden Handreichungen erleichtern die Durchführung arbeitsweltnaher Berufsorientierung mit Beteiligung sämtlicher ArbeitsmarktpartnerInnen. Diese gesamtgesellschaftlich wichtige Aufgabe kann nicht den Schulen allein aufgetragen werden, sondern muss von den praktischen Akteuren und tragfähigen Konzepten unterstützt werden.
Nicht erst seit der PISA-Studie wird von den Betrieben u. a. eine stärkere Praxisnähe des Schulunterrichts gefordert, die auf diese Weise für beide Seiten Vorteile beinhaltet. Auch die Empfehlungen des Forum Bildung zielen auf die Einbeziehung der Lebenswirklichkeit in Bildungseinrichtungen. So bekommen Betriebe zusätzlich die Chance, im eigenen Interesse die Ausbildungsabbrecherquote zu senken und die SchülerInnen besser und realitätsnäher auf das Arbeitsleben vorzubereiten.
Darüber hinaus kann sich der Kontakt zwischen Schule und Betrieb, idealerweise vertreten durch die ver.di Jugend [1]- und Auszubildendenvertretungen (JAV), unabhängig von Dritten verstetigen.
Der Auf- und Ausbau des Referenzschulkonzepts wird begleitet von der Sozialforschungsstelle Dortmund [9], um die Entwicklung eines systematischen Übertragungsmodells für weitere Landesbezirke und KooperationspartnerInnen zu unterstützen.
Will man sich der Frage der Funktion und dem Ziel von Bildung und speziell beruflicher Bildung nähern, macht es Sinn, an eine allgemeine Begriffsdefinition zu erinnern:
Etymologisch stammt Bildung von Bild. Das gebildete Individuum soll in der Lage sein, sich ein Bild zu machen von sich selbst, von der Gesellschaft in der es lebt und von der Welt insgesamt.
Wilhelm von Humboldt definierte allgemeine Menschenbildung als Entfaltung menschlicher Kräfte und Fähigkeiten. Eine breite Allgemeinbildung sollte keineswegs zweckfrei, sondern die Grundlage für den späteren Erwerb nützlicher Qualifikationen sein. Es ging ihm um eine kritische Auseinandersetzung mit der Welt und der Gesellschaft und nicht um bloße Anpassung. Emanzipation zu persönlicher Freiheit und Eigengestaltung war das Ziel.
Dieser faszinierende Gedanke hat nichts an Aktualität verloren und wird von heutigen Bildungsforschern weiter ausgeführt:
"Die Begriffe und Argumente mögen sich wandeln - ob man von "Schlüsselqualifikationen", von "Konfliktfähigkeit" und "sozialer Kompetenz", von "Toleranz" und "Teamgeist" spricht - der Kerngedanke der "Bildung" wird bleiben: Der Mensch ist kein Wesen, das bloß für bestimmte Zwecke konditioniert werden darf, sondern er ist aufgerufen, selbstständiges Denken und Urteilen in sich zu entfalten, er braucht nicht nur Wissen, sondern auch Kriterien, wofür es einzusetzen ist, er benötigt nicht nur Wendigkeit und Findigkeit, sondern auch Charakter und Verantwortungsbewusstsein, soll er sich in einer immer komplexeren Welt als "Mensch" zurechtfinden und behaupten können." (Wehnes 2001, S. 291)
Schulbildung, berufliche Aus- und auch Weiterbildung sind deshalb entscheidend für die Zukunftschancen der Beschäftigten. Um die eigenen Arbeits- und Lebensperspektiven zu sichern, ist ein hohes Maß an qualifizierter Bildung für den Einzelnen erforderlich. Nur so kann dem gesellschaftlichen Strukturwandel begegnet und die daraus resultierenden Herausforderungen können autonom und selbst bestimmt bewältigt werden.
Diese Grundannahmen bilden auch das Fundament für unser Berufsausbildungssystem.
"Das duale System der Berufsausbildung an der Schnittstelle von Bildungs- und Beschäftigungssystem verbindet Arbeiten und Lernen, Praxis und Theorie, berufliche Qualifikation und Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen in den klassischen Lernorten Betrieb und Berufsschule. Ausbildungsziel ist die Vermittlung einer beruflichen Handlungskompetenz, die es den AbsolventInnen ermöglicht, kompetent und flexibel qualifizierte Tätigkeiten selbstständig zu planen, durchzuführen und zu kontrollieren, die Aufgabenwahrnehmung aktiv mitzugestalten sowie sich weiter zu qualifizieren." (Vojta 2002, S. 107)
Wer es nicht von vornherein darauf anlegt, abhängig von den Eltern, LebenspartnerInnen oder von öffentlichen Leistungen zu sein, versucht seinen Lebensunterhalt durch Erwerbsarbeit zu sichern.
Da traditionell in Deutschland die berufsförmige Organisation der Arbeit vorherrscht, ist die Beruflichkeit das dominante Prinzip für das Wirtschafts- und Arbeitsleben und für Bildungs- und Qualifizierungsprozesse. Auch wenn dieses System kritisiert und bereits eine "neue Beruflichkeit" diskutiert wird, das berufliche Prinzip ist unverzichtbar.
Nach wie vor bleiben Berufe - auch in einer zukünftigen Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft - wichtige Orientierungsgrößen und positive Elemente für einen mobilen Arbeitsmarkt. In einer durch vielfältige Veränderungen geprägten Arbeits- und Lebenswelt hat die Sicherstellung des Berufsprinzips eine sinn- und identitätsstiftende Funktion.
Berufe haben einen bestimmten Stellenwert in der Gesellschaft. Bewusst oder unbewusst fließen diese Vorstellungen in die Berufswahlentscheidung mit ein:
Auch der Aspekt der Globalisierung der Märkte und der Europäisierung der Berufsbildungspolitik muss berücksichtigt werden. Das Berufskonzept wird sich auch dieser Entwicklung anpassen müssen. Die Entscheidung für einen bestimmten Berufsweg muss daher auch im europäischen Kontext gesehen werden und inhaltlich, sowie in der Frage der Verwertbarkeit, das europäische Ausland einbeziehen.
Wir können daher davon ausgehen, dass den Jugendlichen die Bedeutung der Berufswahl klar ist. Sie werden vom Elternhaus, von der Schule und auch von der Öffentlichkeit darauf hingewiesen. Und sie wissen: Wer keine berufliche Bildung durchläuft, hat kaum eine Chance in der Arbeitswelt.
Mit der Berufsentscheidung treten die jungen Menschen in das Erwerbsleben ein. In den Familien, im Freundeskreis, in vielen Diskussionen und in den Medien wird die Arbeitswelt dargestellt.
Aber was bedeutet es für einen jungen Menschen, der den bekannten Arbeitsplatz
"Schule" verlässt und in eine für ihn noch unbekannte
"Arbeitswelt" eintritt?
Häufig ist die getroffene Wahl keine freiwillige (s. o.), sondern die
einzige Möglichkeit einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Was auf die Jugendlichen
zukommt, wissen die wenigsten, Hauptsache Arbeit.
Vor dem Hintergrund dieser Komplexität des Themas Berufswahl-Entscheidung ist es mehr als verständlich, dass SchulabgängerInnen befangen und verunsichert sind. Sie glauben bereits sehr frühzeitig, alle Faktoren berücksichtigen zu müssen, um die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen.
Wie viel erfolgreicher und stressfreier wäre es, die Triebfedern "persönliche Fähigkeiten, Motivation und Engagement" als Basis zu nutzen und damit dem sich ständig wandelnden Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu begegnen. Entsprechend muss die Berufsorientierung als gemeinsame Aufgabe der allgemeinen und der beruflichen Bildung verstanden werden, der es gelingt die Komponenten "persönliche Kompetenzen der SchülerInnen" und "Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt" sinnvoll zu vernetzen.
Von den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technologischen Umbrüchen sind insbesondere die Dienstleistungsbranchen, die Medien- und die Kommunikationswirtschaft betroffen. Der Weg in die Wissens- und Informationsgesellschaft muss von den Gewerkschaften beachtet und begleitet werden, damit solidarisches Handeln, demokratische Verantwortung und soziale Gerechtigkeit nicht zu kurz kommen. Die Bildungspolitik ist dabei von zentraler Bedeutung.
Bildung wird von ver.di als Schlüsselthema angesehen und war bereits Inhalt einer programmatischen Konferenz, die den Entstehungsprozess der neuen Dienstleistungsgewerkschaft begleiteten. Mit der Bildungspolitischen Konferenz am 9. und 10. Oktober 2000 hat ver.di [3] auch inhaltlich Position bezogen. Im Zentrum stehen drei Bereiche:
Für die Gewerkschaften übernimmt die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di mit ihrer Gründung die ordnungspolitische Verantwortung für die überwiegende Zahl der in der Bundesrepublik bestehenden Ausbildungsberufe und beruflichen Fortbildungsregelungen. Damit hat ver.di nicht nur besondere Gestaltungschancen, sondern auch die Pflicht, die Zukunft von Bildung in Deutschland insgesamt und den Stellenwert von Berufen mitzugestalten.
Der Berufsorientierungsunterricht mit dem Projekt Perspektive.Plus [2] stellt ein mögliches Bindeglied zwischen allgemeiner Bildung und beruflicher Bildung dar. Die Seminareinheiten werden so dem Anspruch gerecht, eine Brücke zwischen den beiden Bereichen zu schlagen und tragen zum kontinuierlichem Kontakt zwischen Schule und Betrieb bei.
Zur Ergänzung des Berufsorientierungsunterrichts an allgemein bildenden Schulen verfügt ver.di mit ihren Mitgliedern über umfangreiches, vielseitiges und aktuelles "Arbeitsweltwissen", das so für beide Seiten Gewinn bringend genutzt werden kann.
Perspektive.Plus knüpft und verstetigt Netzwerke zwischen SchülerInnen, Schulen, Betrieben und den ArbeitnehmerInnen und integriert weitere interessierte KooperationspartnerInnen. Der Aufbau einer systematischen Zusammenarbeit der Akteure am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ist zeitgemäß und lösungsorientiert. Nur durch Vernetzung und regionales Engagement können die Jugendlichen ein unterstützendes Angebot und umfangreiche Beratung erhalten.
Nicht Anpassungsfähigkeit, sondern Einpassung in die neue Lebens- und Arbeitswelt fördern mündige ArbeitnehmerInnen, die ihr eigenes Leben selbst-bewusst in die Hand nehmen und mitgestalten.
Wehnes, Franz-Josef (2001): Theorien der Bildung. In: L. Roth (Hrsg.): Pädagogik. München, S. 291
Vojta, Jens (2002): Reform
der Beruflichkeit - ein Beitrag zur Beschäftigungssicherung. In:
Herzberg, Gerd/ Kunkel-Weber, Isolde/ Timmermann, Rüdiger/ Treml, Franz/
Frank Werneke (Hrsg.): ver.di. Bildung schafft Zukunft. Über die Perspektiven
von Bildung, Beruf und Beschäftigung. VSA-Verlag, Hamburg, S. 107
Links
[1] http://www.verdi-jugend.de/
[2] http://www.perspektive-plus.de/
[3] http://www.verdi.de/vd_internet
[4] http://www.bmbf.de/
[5] http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index-de.htm
[6] http://www.perspektive-plus.de
[7] mailto:sabine.dass@verdi.de
[8] mailto:baerbel.luebke@verdi.de
[9] http://www.sfs-dortmund.de/home.html