

Grundausbildungslehrgänge (G-Lehrgänge) gehören zum Angebot der Arbeitsämter in der Berufsvorbereitung. Sie haben das Ziel ausbildungsreife Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, auf eine qualifizierte Ausbildung vorzubereiten. Zum Programm gehört die fachliche Qualifizierung in einem Berufsfeld, die Steigerung der Motivation und Wettbewerbsfähigkeit und das Treffen einer fundierten Berufswahlentscheidung.
Das Problem ist aber, dass Grundausbildungslehrgänge immer weniger diese Zielsetzungen erfüllen. Sie geben Absolventen zwar über ein Jahr lang einen Schonraum, in dem sie Defizite aufarbeiten und eine berufliche Perspektive entwickeln können, vermitteln jedoch zu wenig praktisches Rüstzeug für einen erfolgreichen Übergang in eine Ausbildung - insbesondere in die neuen Berufe.
Die Mängel liegen
Aus diesem Grunde ist das im Prinzip wichtige Angebot der Grundausbildungslehrgänge für die Jugendlichen zunehmend unattraktiv.
Zur Beseitigung dieser Mängel und Kritikpunkte wird seit September 2001 im Auftrag des Landesarbeitsamtes Berlin-Brandenburg [1] ein Modellversuch unter dem Titel "Einführung von einheitlichen Qualifizierungsbausteinen und Zertifikaten in Grundausbildungslehrgängen" durchgeführt.
In dem Modellversuch kooperieren Berliner Bildungsträger mit den zuständigen Arbeitsämtern, der Schulverwaltung und den zuständigen Oberstufenzentren (Berufsschulen). Der verantwortliche Projektträger ist die BBJ Consult AG [2].
Das Vorhaben gründet sich auf die Beratungen der Arbeitsgruppe "Aus- und Weiterbildung" zu notwendigen Veränderungen und Anpassungen in der Berufsvorbereitung im Bündnis für Arbeit und die zwischen der Bundesanstalt für Arbeit [3] und den Sozialpartnern vereinbarten "Leitlinien zur Weiterentwicklung der Berufsvorbereitung" vom 27.03.99.
Ziel ist, Berufsvorbereitung mit Ausbildung stärker zu verbinden und dabei die Übergänge von den Grundausbildungslehrgängen in die Erstausbildung zu verbessern. Das Konzept künftiger Grundausbildungslehrgänge soll neben der Vorbereitung auf eine Berufsausbildung auch den Erwerb von anerkannten Teilzertifikaten ermöglichen, um auf diese Weise den Einstieg in eine berufliche Ausbildung zu forcieren.
Das neue Konzept soll folgende Forderungen einlösen:
Der Modellversuch sieht eine Neustrukturierung der Grundausbildungslehrgänge nach dem modularen Qualifizierungsansatz in Kombination mit Assessment- und Reflexionsphasen vor. Durch standardisierte Qualifizierungsbausteine, die z. T. auch frei gewählt werden können, sollen strukturelle Mängel des bisherigen Konzeptes beseitigt und die Effizienz der Maßnahmen gesteigert werden. Durch ein gestuftes Assessment- und Reflexionsverfahren (Feststellung von Interessen, Stärken und Neigungen) soll die relativ hohe Anzahl von Abbrüchen und Fehlbesetzungen reduziert, d. h. die Effizienz des Angebots gesteigert werden.
Die Ergebnisse des Modellversuchs sollen nach erfolgreicher Erprobung die Grundlage zukünftiger Leistungsbeschreibungen für Grundausbildungslehrgänge bilden.
Der Modellversuch erstreckt sich über 2 Jahre (1. 9. 2001 - 31. 8. 2003). Realisiert werden dabei eine Entwicklungsphase (bis 8/ 02) und eine Erprobungsphase bis 8/ 03. Aus der Entwicklungsphase liegen nun die ersten Ergebnisse vor.
Grundausbildungslehrgänge sind nach § 61 SGB III fester Bestandteil der berufsvorbereitenden Maßnahmen des Arbeitsamtes. Das Angebot richtet sich an Schulabgänger, die prinzipiell ausbildungsreif sind, jedoch aus unterschiedlichsten Gründen keinen Ausbildungsplatz finden können. Voraussetzung für die Teilnahme ist in der Regel das Vorhandensein eines Schulabschlusses.
Umgesetzt wird das Angebot von Bildungs- und Qualifizierungsträgern in Kooperation mit den Oberstufenzentren (Berufsschulen) im Auftrag der Arbeitsämter. Die fachliche Qualifizierung in den Grundausbildungslehrgängen ist im Gegensatz zur beruflichen Ausbildung breiter angelegt und mehr auf Berufsfelder ausgerichtet.
Einen großen Raum nimmt die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, sogenannte "Softskills", deutsch- und fremdsprachliche Kompetenzen und die Absolvierung eines Bewerbungstrainings ein (s. Runderlass 42/96 der Bundesanstalt für Arbeit).
Teilnehmer/ -innen in Grundausbildungslehrgängen sind in der Regel berufsschulpflichtig und absolvieren ein betriebliches Praktikum unterschiedlicher Dauer.
Grundausbildungslehrgänge haben einen zeitlichen Umfang von 11 Monaten.
Der Modellversuch wird exemplarisch in den Berufsfeldern/ Qualifizierungsbereichen "Informations- und Kommunikationstechnologie"/ Medien und "Bürowirtschaft und Verwaltung" durchgeführt. Hierzu wurden von den Arbeitsämtern sechs bewährte Bildungsträger ausgesucht, die in entsprechenden Maßnahmen insgesamt 135 Jugendliche vorbereiten. Die einzelnen Maßnahmen sind sowohl berufsfeldbezogen als auch berufsfeldübergreifend angelegt (z. B. IT und Medien oder IT und Bürowirtschaft).
Die Hauptgruppe der Teilnehmer/ -innen besitzt einen erweiterten Hauptschulabschluss bzw. einen Realschulabschluss. Die Spannweite erstreckt sich jedoch von Schulabgänger/ -innen ohne Abschluss bis zu Abiturient/ -inn/ -en, was auch einen entscheidenden Einfluss auf die Motivationslage der Teilnehmer/ -innen und somit auf das zu erreichende Niveau des Grundausbildungslehrganges hat.
Am Modellversuch beteiligte Bildungseinrichtungen (Tab. 1)
| Träger | Maßnahme(n) | TN |
| Akademie für Berufsförderung und Umschulung, Berlin, e.V. (ABU) [4] | IT Maßnahme | 30 |
| Berufsfortbildungswerk (bfw) [5] | IT Maßnahme | 30 |
| Bildungsmarkt Vulkan gGmbH (BiMa) [6] | Wirtschaft/ Verwaltung | 15 |
| Internationaler Bund Außenstelle Berlin Schöneberg (IB) [7] | Gemischte Maßnahme IT/ Wirtschaft/ Verwaltung | 30 |
| Institut für Betriebsorganisation und Informationstechnik (InBit) [8] | IT Maßnahme | 15 |
| SOS Kinderdorf e.V. Berufsausbildungszentrum (baz) [9] | Gemischte Maßnahme IT/ Medien | 15 |
Die inhaltliche Grundlage des Modellversuchs ist der von BBJ [2] entwickelte modulare Qualifizierungsansatz. Dieser sieht zum einen eine handlungsorientierte Vermittlung von Fachinhalten in einer engen Theorie/ Praxisverzahnung und zum anderen eine kontinuierliche Bewertung und Zertifizierung der Qualifizierungsfortschritte nach trägerübergreifend abgestimmten Standards vor. Zur Dokumentation der Erfolge wird der von BBJ entwickelte Qualifizierungspass (1) genutzt.
Die Implementierung des modularen Qualifizierungsansatzes wird durch eine sogenannte "Multiplikatorenschulung" für die Mitarbeiter/ -innen der beteiligten Bildungsträger sicher gestellt. Hierbei geht es sowohl um die Klärung der grundlegenden Fragen zur modularen Qualifizierung als auch um die Handhabung des dafür entwickelten Instrumentariums. Es werden zunächst Querschnittsinformationen zur Modularisierung vermittelt, damit alle am Modellvorhaben beteiligten Personen über einen gemeinsamen Fundus von Definitionen/ Sprachregelungen zur Modularisierung verfügen. Weitere Schwerpunkte sind die curriculare, methodisch-didaktische und organisatorische Umsetzung des modularen Qualifizierungsansatzes unter Einbeziehung aktueller Verfahren der Kompetenzermittlung, der Leistungsüberprüfung und Zertifizierung von Qualifizierungsabschnitten. Die von den Trägern bereits entwickelten Qualifizierungskonzepte werden hinsichtlich der vom BIBB [10] und den örtlichen Kammern festgelegten Standards zur Modularisierung überprüft und unter der Maßgabe der Vergleichbarkeit weiterentwickelt.
Um eine möglichst schnelle und nachhaltige Wirkung zu erreichen, nehmen an der Multiplikatorenschulung Koordinatorinnen, Sozialarbeiter/ -innen, Ausbilder/ -innen und Entwickler/ -innen teil. Die Qualifizierung der Multiplikatoren umfasst insgesamt fünf Module zu folgenden Themen/ Arbeitsschwerpunkten:
Zur Übertragung des Qualifizierungsansatzes/ Entwicklung eines Bausteinkonzeptes für die Grundausbildungslehrgänge werden trägerübergreifende Arbeitsgruppen - hauptsächlich in themenbezogenen - eingerichtet, die durch Beratungen/ Coaching bei den beteiligten Trägern ergänzt werden. Die Beratung dient dabei hauptsächlich der Berücksichtigung und Abstimmung einrichtungsspezifischer Aspekte bei der Konzept- und Bausteinentwicklung.
Die Begleitung in der Erprobungsphase erfolgt im Rahmen eines Monitoring durch das Projektteam. Gemeint sind hier die fortlaufende Beobachtung und Bewertung der Projektfortschritte, die Überprüfung der positiven und negativen Wirkungen, die Identifizierung von Synergieeffekten sowie auch das Initiieren von Anpassungen.
Zum Abschluss ist der Transfer der Ergebnisse in die Fachöffentlichkeit unter Beteiligung der Kammern, der zuständigen bildungspolitischen Gremien sowie der Arbeitsverwaltung zu organisieren.
Nach einjähriger Entwicklungs- und Abstimmungsarbeit befindet sich der Konzeptvorschlag für künftige Grundausbildungslehrgänge sowie die exemplarischen Qualifizierungsbausteine/ Module für zwei Berufsfelder/ Qualifizierungsbereiche in einem erprobungsfähigen Stadium.
Es wird die Neustrukturierung der Grundausbildungslehrgänge mit gestuftem Berufswahlverfahren vorgeschlagen. Die Grundstruktur zukünftiger G-Lehrgänge mit integriertem mehrstufigen Berufswahlverfahren wird im Folgenden dargestellt und näher erläutert:
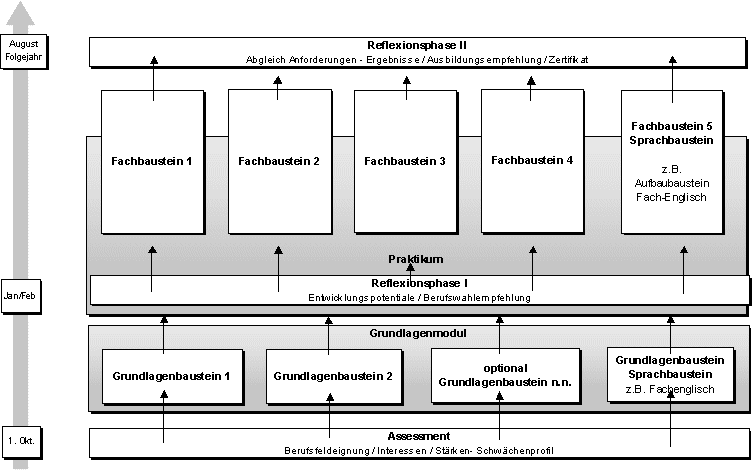 |
Zunächst wird in einem Assessment das Angebot der jeweiligen G-Lehrgänge den Teilnehmer/ -innen vorgestellt und dessen/ deren Eignung für ein Berufsfeld ermittelt. Zeigen einzelne Teilnehmer/ -innen andere Interessen und Neigungen wird diesen soweit möglich ein alternatives Angebot empfohlen. Grundsatz des Assessmentverfahrens ist ein positiver Denk- und Handlungsansatz.
Es werden die Bereiche Sozialkompetenz, Interessen/ Stärken, Motivation/ Durchhaltevermögen bearbeitet, sowie die Fachkompetenz überprüft.
Die Auswertung erfolgt in einem Reflexionsgespräch mit anschließender Qualifizierungsberatung. Ein Förder- und Qualifizierungsplan wird erstellt und eine schriftliche Empfehlung für ein Berufsfeld gegeben. Gleichzeitig wird gemeinsam die Suche eines Praktikumsplatzes geplant. Über fortlaufende Berichtslegung wird das Ergebnis gesichert.
Im Anschluss an das Assessment absolvieren die Teilnehmer/ -innen zunächst die erste Qualifizierungsphase in den (obligatorischen) Grundlagenbausteinen gemäß des festgelegten Förder- und Qualifizierungsplanes. Die Grundlagenbausteine bereiten auch auf das Praktikum in den Betrieben vor und werden nach erfolgreicher Absolvierung zertifiziert.
Zur Veranschaulichung wird hier der Grundlagenbaustein aus Bürowirtschaft/ Verwaltung exemplarisch abgebildet. Die Bausteine a + b bilden das so genannte Grundlagenmodul, welches mit der IHK zu Berlin [11] abgestimmt ist. (Tab. 2)
| Baustein | Inhalte |
| a) Grundlagen der Kommunikation | Kommunikationsformen Bürotechnik Textverarbeitung Tabellenkalkulation Informations- und Kommunikationsnetze |
| b) Betriebswirtschaftliche Grundlagen | Grundlagen des Wirtschaftens privates + öffentliches Recht Vertragsarten |
| Fachenglisch | entsprechend der o. g. Fachinhalte |
Mit der fachlichen Qualifizierung, die möglichst handlungsorientiert erfolgen und durch entsprechende Fachpraxis untermauert werden soll, werden auch Angebote zum Erwerb bzw. Ausbau der notwendigen sprachlichen bzw. fremdsprachlichen Kompetenzen gemacht.
Parallel zur Qualifizierung beim Bildungsträger/ zum Praktikum im Betrieb ist von den Teilnehmer/ -innen auch der obligatorische Berufsschulbesuch zu absolvieren. Die vorgelegten Konzepte schlagen ein abgestimmtes Verfahren entsprechend der vorhandenen Möglichkeiten und Ressourcen an den jeweiligen Lernorten vor. Hierbei werden von der Berufsschule i. d. R. vertiefende und ergänzende Angebote in den allgemein bildenden Fächern angeboten. Künftig wäre aber auch ein direktes Zusammenwirken in der Bausteinqualifizierung vorstellbar.
Die erste Reflexionsphase dient der Auswertung und dem Abgleich der Qualifizierung in den Grundlagenbausteinen und der Identifizierung der Entwicklungspotenziale. Auf dieser Basis wird mit den Teilnehmer/ -innen eine erste Berufswahl getroffen.
Eckpunkte sind die Auswertung der Qualifizierung in den Grundlagenbausteinen und die Fortschreibung des individuellen Förder-/ Qualifizierungsplans für die nachfolgenden Fachbausteine. Die Qualifizierungsberatung umfasst dabei:
Mit der Ausgabe des Qualifizierungspasses mit den Zertifikaten der Grundlagenbausteine wird die Reflexionsphase abgeschlossen.
Die Teilnehmer/ -innen absolvieren die Qualifizierung in den Fachbausteinen sowie ihr Praktikum auf Grundlage ihres fortgeschriebenen Förder-/ Qualifizierungsplanes. Dabei können z. B. aus vier angebotenen Bausteinen zwei gewählt werden. Die einzelnen Bausteine schließen mit einer Bausteinprüfung ab.
Je nach Angebots- und Organisationsmöglichkeiten des Trägers sollten besonders leistungsfähigen Teilnehmer/ -innen weitere Bausteine angeboten werden.
Zur Veranschaulichung wird hier der Fachbaustein aus IT/ Medien exemplarisch abgebildet. Die einzelnen Fachbausteine ordnen sich verschiedenen Fachmodulen aus unterschiedlichen Berufsbildern zu. (Tab. 3)
| Baustein | Inhalte |
Softwareanwendungen Vertiefung (Inhalte ECDL II) |
Datenbanken Präsentation HTML Grundlagen |
| Präsentationstechniken | Visuelle Präsentationsformen und ihre Durchführung Bewerbungstraining |
| Kaufm. Geschäftsprozesse | Lieferanten -> Unternehmen innerhalb des Unternehmens Unternehmen -> Kunden |
| Netzwerke | Planen Installation/ Inbetriebnahme Instandhaltung/ Service/ Wartung |
| Fachenglisch | entsprechend der o. g. Fachinhalte |
Wie in den Grundlagenbausteinen findet auch in der Vertiefungsphase der Ausbau der sprachlichen bzw. fremdsprachlichen Kompetenzen statt.
Das Praktikum als wesentliche Schnittstelle zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sichert ein Minimum an betrieblicher Erfahrung und kann bis zu drei Monaten dauern. Zur Abstimmung der Tätigkeits-/ Qualifizierungsinhalte im Praktikumsbetrieb ist im Qualifizierungsplan eine gesonderte Rubrik eingerichtet (siehe auch Übersicht Qualifizierungsplan).
Der Berufsschulbesuch findet ergänzend zur Vermittlung beim Bildungsträger/ im Betrieb einmal wöchentlich nach einem abgestimmten Lehrplan statt.
In der Schlussreflexion wird der G-Lehrgang ausgewertet und eine Empfehlung für einen bestimmten Ausbildungsberuf ausgesprochen. Dazu wird ein Abgleich der Anforderungen für eine Ausbildung in einem bestimmten Berufsbild und die abschließende Beurteilung der Entwicklung der Teilnehmer/ -innen vorgenommen. Zudem kann eine Einstiegsempfehlung für bestimmte Ausbildungsgänge erfolgen. (z. B. "...geeignet um ins erste oder zweite Ausbildungsjahr einer Ausbildung als IT-Systemkaufmann einzusteigen ...").
Die Bewerbungsstrategie für den Ausbildungsplatz wird überprüft und die Bewerbungs-/ Produktmappe bestätigt oder modifiziert. Diejenigen, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, werden abschließend bei der Suche unterstützt.
Zum Abschluss wird der Qualifizierungspass aktualisiert und der Endbericht mit der Ausbildungsempfehlung erstellt.
Das beschriebene Verfahren zur Berufswahl bedarf jedoch einheitlicher, zwischen den Trägern abgestimmte Qualitätskriterien. Diese dienen der Transparenz des Verfahrens und schaffen die Voraussetzungen für eine gegenseitige Anerkennung der Ergebnisse.
Die jeweiligen Schritte (Eingangsassessment, Reflexionsphasen) beinhalten daher konkrete Übereinkünfte und Aussagen zu
Um Berufsvorbereitung mit Ausbildung künftig besser verbinden zu können, braucht man kompetenzorientierte Bausteinkonzepte, die zum einen den aktuellen Anforderungen in den jeweiligen Berufsfeldern entsprechen und zum anderen berufsfeld- bzw. berufsbildübergreifend gestaltet sind. Die Orientierung an den aktuellen Anforderungen in den Betrieben wirkt sich positiv auf die Verwertbarkeit des Angebotes aus und die übergreifende Gestaltung der Bausteine ist Teil des methodischen Konzeptes, das erst in der Schlussphase die Wahl des eigentlichen Ausbildungszieles vorsieht.
Daher sollten in Grundausbildungslehrgängen überwiegend Qualifizierungsbausteine angeboten werden, die möglichst quer zu vielen Tätigkeitsbereichen, Berufsfeldern oder zumindest Berufsbildern gelagert sind. Voraussetzung für die Anerkennung in Ausbildungsgängen ist die Berücksichtigung des Berufskonzeptes nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG).
Bei der Entwicklung übergreifender Bausteine wurden im Modellversuch daher zunächst die gemeinsamen Kompetenzen und Inhalte der betroffenen Berufsfelder/-bilder identifiziert. Aus den gefundenen Querschnitts- und Teilmengen wurden nach handlungsorientierten Ansätzen neue Bausteine geschnitten. Die Systematik kann durch folgende Grafik veranschaulicht werden:
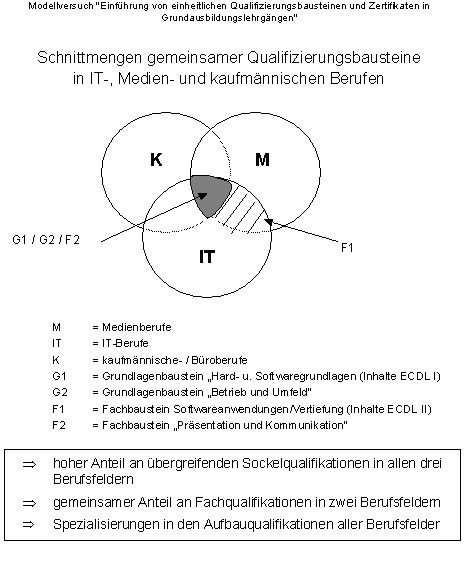 |
Die Grafik stellt das systematische Vorgehen in drei Berufsfeldern dar: kaufmännische Berufe, IT (IuK) Berufe und Medienberufe.
Es können hier Kompetenzen/ Inhalte identifiziert und Qualifizierungsbausteine geschnitten werden, die alle drei Felder betreffen und solche die lediglich zwei Felder schneiden. Grenzen übergreifender Bausteine ergeben sich aus der beruflichen Systematik, da Berufsfeldern/ -bildern zwangsläufig auch spezielle und nur für diese Berufe zutreffende Inhalte inhärent sind.
Zu jedem Baustein werden als Instrument der Lernortkooperation Qualifizierungspläne entwickelt, die jeweils eine Kompetenzbeschreibung und Aussagen zu Fachtheorie (Lerninhalte), Fachpraxis (zu vermittelnde Fertigkeiten/ Kenntnisse) und zum Praktikumbetrieb (Qualifizierungsempfehlung) beinhalten.
Nachfolgend soll ein exemplarischer Qualifizierungsplan aus dem Feld Bürowirtschaft/ Verwaltung dargestellt werden (Fachbaustein "Organisationsformen und Organisationstechniken").
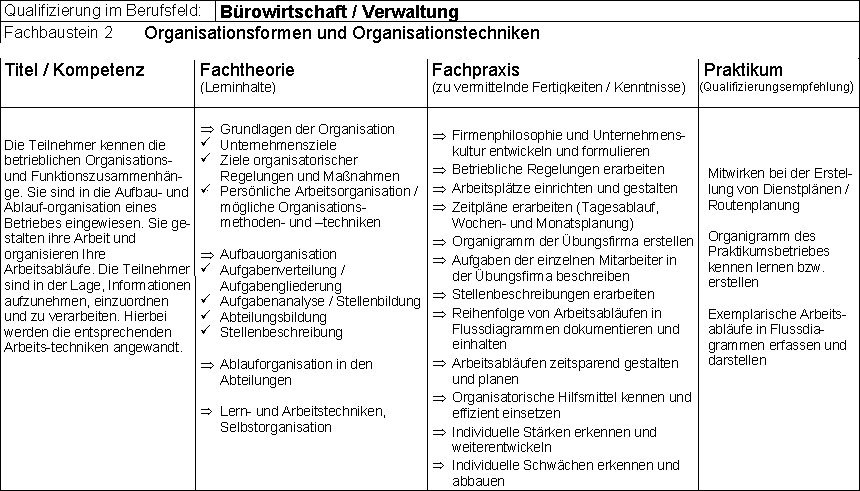 |
Die Qualifizierungspläne sind Bestandteil des zu erstellenden Förderplans.
Nach einem Jahr der Entwicklung und Abstimmung zwischen den beteiligten Trägern liegen nun das Strukturkonzept für künftige Grundausbildungslehrgänge, das Konzept für ein mehrstufiges Verfahren zur Berufswahl, zwei berufsfeldbezogene Bausteinkonzepte nebst zugehörigen Materialien vor. Die im Modellversuch beteiligten Träger haben zwischenzeitlich ihre G-Lehrgangsteilnehmer/ -innen aufgenommen und werden ab Oktober mit der Erprobung beginnen.
In den nächsten Monaten soll die Kooperation mit den Oberstufenzentren weiter konkretisiert werden und auch inhaltliche Schnittstellen zu anderen Modellen der Berufsvorbereitung (MDQM [12] (2), BBE etc.) geklärt werden.
Die Erfahrungen der Teilnehmer/ -innen mit dem Qualifizierungspass im Rahmen ihrer Praktikumsuche werden im ersten Quartal 2003 ausgewertet werden.
Im vierten Quartal 2003 werden dann die endgültigen Ergebnisse vorliegen, die durch den Projektträger in weiteren Veröffentlichungen bzw. über das Publikationsforum des "Netzwerkes Modularisierung" www.modulnet-berlin.de [13] der Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
| Projektträger: | BBJ Consult AG [2] |
| Kontaktperson: | Joachim Dellbrück |
| Herzbergstraße 84, 10365 Berlin | |
| Tel.: 030-5505-1329, Fax - 1000 | |
| E-Mail: dellbrueck@bbj.de [14] |
1) Der Qualifizierungspass ist in der Modellversuchsreihe "Modulare Nachqualifizierung" des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) in Abstimmung mit bundesweit tätigen Trägern der beruflichen Bildung, mit den örtlichen Kammern und Verbänden entwickelt worden. Herausgeber des Qualifizierungspasses ist der in Berlin ansässige BBJ Verlag [15], Herzbergstraße 84, 10365 Berlin.
2) Berliner Schulmodellversuch "Duale Modulare Qualifizierungsmaßnahme"
Dieser Beitrag ist entstanden auf Anregung der wissenschaftlichen Begleitung des Programms "Schule - Wirtschaft/ Arbeitsleben". Das Programm wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung [16] und durch den Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union. Der Inhalt liegt in der Verantwortung des Verfassers bzw. der Verfasserin.
Links
[1] http://www.arbeitsamt.de/hst/dienststellen/laaberlinbrandenburg/
[2] http://www.bbj.de/0.Hauptmenue.htm
[3] http://www.arbeitsamt.de/hst/index.html
[4] http://bebis.cidsnet.de/berufsorientierung/weissnochnicht/aktuelles/marzhellerdrf.html
[5] http://www.bfw.de/
[6] http://www.bildungsmarkt.de/index_g3.html
[7] http://www.internationaler-bund.de/
[8] http://www.inbit.de/Domis/InBit/Infopool.nsf/HTML/D269361224226CC7C1256A34005102F8
[9] http://www.sos-berlin.de/index.php?show=start
[10] http://www.bibb.de/
[11] http://www.ihk-berlin.de/produktmarken/
[12] http://www.osz-kt.de/bgang/mdqm1.htm
[13] http://www.modulnet-berlin.de/
[14] mailto:dellbrueck@bbj.de
[15] http://www.bbj.de/3.06._BBJ_Verlag.htm
[16] http://www.bmbf.de/