

[/S. 13:] In der Bundesrepublik Deutschland beobachten wir seit den achtziger Jahren die Auflösung von Normalitätsmustern der abhängigen Arbeit, die als Erosion des Normalarbeitsverhältnisses bezeichnet wird. Sie drückt sich in einer wachsenden Heterogenität von Beschäftigungsformen und einer Entstandardisierung und Destabilisierung der Erwerbsbiografien aus. Das institutionelle Normengefüge, das sich nach wie vor am herkömmlichen Normalarbeitsverhältnis orientiert, büßt an Regulierungs- und Schutzfunktionen ein; Normalität im Erwerbssystem und die Schutzwirkung rechtlicher Normen fallen immer mehr auseinander, und es setzen sich neue Formen der sozialen Ungleichheit durch.
Die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses wird häufig auf die Veränderungen am Arbeitsmarkt - namentlich auf das von Konjunkturzyklus zu Konjunkturzyklus wachsende Niveau der Arbeitslosigkeit - sowie Politiken der Deregulierung zurückgeführt. Eine solche Erklärung greift aber zu kurz, wenn sie nicht den ökonomischen Strukturwandel einbezieht und auch die gesellschaftlichen Veränderungen berücksichtigt, welche die früheren Normalitätsmuster sprengen und zu gleich die in diesen verborgenen Ungleichheitsstrukturen offen legen.
Arbeitsmarktpolitik kann sich daher kaum mehr an Leitbildern der Vollbeschäftigung und standardisierter Beschäftigungsformen nach dem Vorbild der frühen siebziger Jahre orientieren; es sind Konzepte und Politiken nötig, die Differenzierungen in der Beschäftigung nicht beseitigen, sondern sozial regulieren und absichern und damit zugleich versperrte Zugänge zum Erwerbssystem öffnen.
Im Folgenden werde ich zunächst Charakteristika des Normalarbeitsverhältnisses sowie die Ausdrucksformen und Ursachen seiner Erosion skizzieren und dann einige Ansätze der Neuordnung der Erwerbsarbeit vorstellen und diskutieren.
Die Entwicklung des Beschäftigungssystems in der Nachkriegszeit der Bundesrepublik Deutschland war durch eine einzigartige Konstellation bestimmt. Der schnell wachsende industriell-marktwirtschaftliche Sektor verdrängte die landwirtschaftliche und handwerkliche Kleinproduktion und absorbierte rasch einen großen Teil der Arbeitskräfte des traditionellen Erwerbssektors. Dieser Prozess wurde flankiert und gefördert durch die Entwicklung des Wohlfahrtsstaats. Keynesianische Wirtschaftspolitik, soziale Umverteilung, der Ausbau der sozialen Versorgungs- und Sicherungssysteme trugen ebenso wie die Entwicklung der industriellen Beziehungen zur Vollbeschäftigung und zur Stabilisierung und relativen Angleichung der Einkommen bei (vgl. Lutz 1984, S. 210 ff.). Es war in dieser Hochzeit des Fordismus (Fließbandfertigung), in der eine bestimmte soziale Beschäftigungsform normativ ausgestaltet und perfektioniert wurde und auch empirisch seine größte Verbreitung fand. Es bildete sich die Figur des "Normalarbeitsverhältnisses" heraus, die nicht nur "Bezugspunkt für juristische Ge- und Verbote sowie Rechtsinterpretationen" (Mückenberger 1985, S. 4), sondern auch Orientierungsrahmen für die Erwartungen und Strategien von Arbeitnehmern und Beschäftigern am Arbeitsmarkt wurde.
Für das Normalarbeitsverhältnis können folgende Elemente als konstitutiv angesehen werden:
Es ist dieser Typ von Arbeitsverhältnissen und Erwerbsverläufen, der (nach wie vor) im Zentrum der sozialen Schutzregelungen des Arbeits- und Sozialrechts steht und institutionell gestützt und abgesichert wird. Arbeitsrecht und Kollektivvereinbarungen schränken die Vertragsfreiheit ein, was die zeitliche Befristung und Kündigungen angeht und räumen Alter und Seniorität einen hervorragenden Platz als Kriterien für sozialen Schutz ein. Die Ansprüche an die soziale Sicherung - so Arbeitslosenunterstützung, Rente aus der Sozialversicherung und betriebliche Zusatzrente - sind an die vorherige Erwerbsarbeit gebunden und bemessen sich an Erwerbsdauer, Einkommen und eingezahlten Beiträgen. Nur wer in seinem Erwerbsleben kontinuierlich und in Vollzeit arbeitet, kann demnach eine maximale soziale Absicherung erwarten.
Das Normalarbeitsverhältnis wurde gleichermaßen sozialpolitisches Leitbild, praktischer Orientierungsrahmen am Arbeitsmarkt und auch empirisch vorherrschende Beschäftigungsform in der Nachkriegszeit. Es schloss zwar eine Angleichung von bestimmten Beschäftigungsbedingungen ein, bereits in der normativen Konstruktion wurden aber Formen der Ungleichheit festgeschrieben. Dies drückt sich etwa in Schutzfunktionen aus, die direkt oder indirekt an die Betriebsgröße gekoppelt sind und Beschäftigte in Großbetrieben mit etablierten Mitbestimmungsorganen und kompromissförmigen Personalpolitiken privilegieren. Aber auch faktisch waren große Gruppen von Personen von den sozialen Stabilitäts- und Sicherungsversprechen des Normalarbeitsverhältnisses ausgeschlossen. Das Normalarbeitsverhältnis schien zwar universalistische Maßstäbe zu setzen, unterstellte aber eine Normalität von Lebensverhältnissen, die nur für einen Teil der Bevölkerung galt. Frauen etwa waren von den materiellen und sozialen Sicherungen des Normalarbeitsverhältnisses weitgehend ausgeschlossen, weil sie im Rahmen des herkömmlichen Geschlechterarrangements der "männlichen Versorgerehe bzw. Hausfrauenehe" nicht oder nicht voll kontinuierlich erwerbstätig sein konnten oder wollten. Demnach war der Mann durch kontinuierliche Vollzeit-Erwerbsarbeit für das Familieneinkommen und die soziale Sicherung auch der Frau verantwortlich, während die verheiratete Frau zur Versorgung der Familie und im Normalfall nicht zur Lohnarbeit verpflichtet war; sie bedurfte daher auch nicht der umfassenden Schutzrechte aus dem Normalarbeitsverhältnis (vgl. Hinrichs 1996, S. 104 und Pfau-Effinger 1998, S. 167 ff. und Zukunftskommission der Friedrich-Ebert-Stiftung 1998, S. 269 ff.). Insgesamt setzte das traditionelle Familienmodell eine hochgradige Stabilität der Ehen und der Arbeitsteilung zwischen den Ehepartnern, den Verzicht der Frauen auf eine eigenständige Existenzsicherung und ihre Abhängigkeit von den Partnern voraus.
Das Normalarbeitsverhältnis baute so auf Strukturen der sozialen Ungleichheit auf und verfestigte sie. Auch andere Personengruppen - so etwa ausländische Arbeitskräfte, Berufs- und Betriebswechsler - waren dem Risiko ausgesetzt, aus dem Normalarbeitsverhältnis herauszufallen, weil sie nicht kontinuierlich und vollzeitig erwerbstätig sein und nur mindere Ansprüche auf Existenz- und Statussicherung stellen konnten.
Seit den achtziger Jahren zeigt sich ein deutlicher Erosionsprozess. In der ersten Hälfte der vorigen Dekade waren erstmals mehr als zwei Millionen Personen als erwerbslos registriert. In den neunziger Jahren sprang die Zahl auf inzwischen über vier Millionen oder mehr als zehn Prozent. [/S. 15:] Bezieht man die Personen, die an Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit [1] teilnehmen, sowie die potenziellen Arbeitnehmer in der "Stillen Reserve" ein, dann ergibt sich im Jahre 1999 ein Beschäftigungsdefizit von etwa sieben Millionen Arbeitsplätzen (vgl. Streeck/ Heinze 1999, S. 38).
Zugleich hat der Anteil von Erwerbsformen, die vom Normalarbeitsverhältnis abweichen, empirisch enorm zugenommen. Die Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen schätzt, dass der Anteil von Personen in "Normarbeitsverhältnissen", d. h. mit unbefristeten Vollzeitverträgen, in Westdeutschland zwischen 1970 und 1995 von fast 84 Prozent auf 68 Prozent aller abhängig Beschäftigten zurückgegangen ist (vgl. Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen 1997, Bd. I, S. 64).
Stark zugenommen hat demnach vor allem die Teilzeitbeschäftigung - von 6 Prozent auf 23 Prozent; sie wird ganz überwiegend von Frauen ausgeübt. Ein Teil dieser Beschäftigungsverhältnisse ist arbeits- und sozialrechtlich voll geschützt; ein anderer, die so genannten "geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse", sind auf einen monatlichen Höchstverdienst von gegenwärtig 630 DM begrenzt und vermitteln in der Regel allenfalls geringfügige Ansprüche auf soziale Sicherung. Bemerkenswert ist die schnelle Ausweitung des Anteils dieser Beschäftigungsform insbesondere in den neunziger Jahren (1). Neben der Teilzeitarbeit bildet die formell befristete Beschäftigung eine zweite große Gruppe "abweichender" abhängiger Erwerbstätigkeit. Sie macht (ohne Ausbildungsverhältnisse) etwa fünf Prozent abhängiger Beschäftigung aus, hat allerdings seit Mitte der achtziger Jahre nur geringfügig zugenommen (vgl. Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen 1997, Bd. I, S. 64 und Bielinski 1997, S. 171 ff.). Schließlich haben sich auch weitere Beschäftigungsformen ausgeweitet, so die Leiharbeit und die öffentlich subventionierte Beschäftigung (ABM-Maßnahmen).
Bei allen statistischen Ungenauigkeiten und widersprüchlichen Interpretationen kann man insgesamt von einer starken Differenzierung der abhängigen Beschäftigung ausgehen. Das "Normarbeitsverhältnis" hat an Verbreitung verloren; zugleich haben Beschäftigungsformen zugenommen, die kein existenzsicherndes Einkommen, kaum stabile Perspektiven und/ oder nur eingeschränkten arbeits- und sozialrechtlichen Schutz bieten. Zusammen mit der Arbeitslosigkeit tragen sie zur Ausbreitung diskontinuierlicher Erwerbsbiografien bei, die nur noch in unzulänglichem Maße Ansprüche an ein System der sozialen Sicherung begründen, welches noch auf dem Normalarbeitsverhältnis aufbaut. Hohe Arbeitslosigkeit und die Ausweitung von "abweichenden" Beschäftigungsverhältnissen schaffen so wachsende Probleme generations- und geschlechtsspezifischer sozialer Ungleichheit: Einer älteren Generation (überwiegend Männer), die lebenslang im Normalarbeitsverhältnis erwerbstätig war und volle Ansprüche auf die soziale Sicherung erworben hat, stehen große Gruppen von Personen gegenüber, die wegen reduzierter oder diskontinuierlicher Beschäftigung nicht mit einer hinreichenden und stabilen individuellen Sicherung rechnen können, so vor allem Frauen und jüngere Arbeitnehmer.
Viele Kritiker erklären die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses in Deutschland vor allem aus politischen und ökonomischen Veränderungen, die zu einer rigorosen Verschiebung der Machtbeziehungen zwischen Kapital und Arbeit geführt haben. "Jobless Growth" und Massenarbeitslosigkeit, begleitet von einer neoliberalen Deregulierungsoffensive, schaffen demnach Machtasymmetrien in der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt, die es den Unternehmen erlauben, neue Flexibilisierungsstrategien durchzusetzen, das herkömmliche System hoher, dichter und egalitär ausgerichteter Schutzstandards auszuhöhlen und neue Differenzierungen zulasten der Arbeitnehmer zu schaffen.
Eine solche Argumentation ist sicherlich nicht unbegründet. Sie erscheint aber verkürzt, weil sie andere Quellen übersieht, die das Normalarbeitsverhältnis unter Veränderungsdruck setzen: den Strukturwandel der Wirtschaft, der die Basis für eine neuartige Differenzierung von Tätigkeiten und Arbeitsverhältnissen legt, sowie Prozesse des gesellschaftlichen Wandels, in dem sich auch die Ansprüche der Arbeitnehmer an die Beschäftigungsverhältnisse verändern und differenzieren. [/S. 16:]
Die konservativ-liberale Koalition hat seit den achtziger Jahren und zumal im Zuge der Diskussion um den "Standort Deutschland" Maßnahmen der rechtlichen Deregulierung durchgesetzt. Sie hatten u. a. folgende Schwerpunkte: die Ausweitung der rechtlichen Spielräume für Leiharbeit und für befristete Arbeitsverträge; die Einschränkung des Kündigungsschutzes und der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall; die Verminderung von Transferzahlungen an Arbeitslose und Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen (vgl. Hoffmann/ Walwei 1998, S. 4).
Insgesamt ist aber die rechtliche Deregulierung in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern eher moderat ausgefallen; sie ist widersprüchlich, wenig systematisch und eher "zögerlich oder gar halbherzig" (Keller/ Seifert 1997, S. 530) eingeführt worden, und sie gibt jene eigentümliche Kontinuität wieder, welche den "rheinischen Kapitalismus" (Michel Albert) mit seinem breiten Spektrum politischen Konsenses und letztlich doch relativ stabilen Mustern sozialen Kompromisses charakterisiert. Obwohl das hohe Niveau und die große Dichte der Regulierung in Deutschland kräftige Deregulierungseinschnitte durch die konservative Regierung erwarten ließen, blieben die regulativen Veränderungen im Rahmen der gewachsenen rechtlichen Grundstrukturen. Offensichtlich wirken, wie Berndt Keller und Hartmut Seifert feststellen, die "Regulierungsmechanismen, Institutionen und Handlungsstrategien der korporativen Akteure (...) als Sicherungen, Barrieren und wichtige Stabilitätsbedingungen" (Keller/ Seifert 1997, S. 530). Die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses ist daher weniger Ergebnis der Deregulierung von Rechtsnormen. Sie drückt vielmehr vor allem die Veränderung von Normalität im Rahmen gegebenen Rechts aus (vgl. Höland 1996, S. 100).
Wie aber lässt sich der Wandel von Normalität erklären? Es liegt zunächst nahe, den Veränderungen am Arbeitsmarkt eine bestimmende Rolle einzuräumen.
Seit den sechziger und insbesondere seit den siebziger Jahren haben sich die Wachstumsraten drastisch reduziert und sind beträchtlich unter der Steigerung der Produktivität geblieben. Mit der Produktivitätsschere hängt zusammen, dass das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen - also die gesamte für abhängige Arbeit aufgewendete Zeit der Gesellschaft in Westdeutschland - in den letzten 35 Jahren beträchtlich, nämlich um fast 20 Prozent geschrumpft ist. Im selben Zeitraum, vor allem in den achtziger Jahren, hat sich aber die Zahl der Erwerbspersonen stark, um fast 10 Prozent erhöht, bedingt durch die rasche Zunahme der Erwerbsbeteiligung von Frauen, die Zuwanderung und den Eintritt geburtenstarker Jahrgänge in den Arbeitsmarkt. Dass die Zahl der Arbeitslosen nicht noch wesentlich höher ist, ist insbesondere der starken Arbeitszeitverkürzung zuzurechnen: In den letzten 35 Jahren hat sich die reale Arbeitszeit je Arbeitnehmer um gut ein Viertel reduziert, also weit mehr als das Arbeitsvolumen. Das geringere Arbeitsvolumen verteilt sich daher auf eine größere Zahl von Erwerbstätigen (vgl. Berliner Memorandum 1995). Insgesamt haben sich aber die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt angesichts der Disparität von Angebot und Nachfrage gegenüber den sechziger und siebziger Jahren drastisch verändert und die Substitution von Normarbeitsverhältnissen durch abweichende Formen gefördert. So sind heute Beschäftigungsformen zumutbar, die früher kaum akzeptabel waren.
Es wäre aber zu kurz gegriffen, die Differenzierung der Beschäftigungsformen nur auf die Verschiebungen der Machtbeziehungen am Arbeitsmarkt zurückzuführen. Von zentraler Bedeutung ist auch der wirtschaftliche Strukturwandel, in dessen Verlauf sich Formen der Arbeit und Arbeitsorganisation und damit die Erwerbstätigkeiten selbst verändern. Seit den siebziger Jahren hat die rapide "Tertiarisierung" den Arbeitsmarkt auf eine schleichende, aber darum nicht weniger dramatische Weise umstrukturiert: Der Dienstleistungssektor und darin vor allem der Bereich der unternehmensbezogenen und sozialen Dienstleistungen hat ein enormes Wachstum erfahren und die Industrie in ihrem Beitrag zu Wertschöpfung und Beschäftigung weit hinter sich gelassen (vgl. Haisken-De New u. a. 1998). Aber auch in der Industrie selbst zeigen sich Tendenzen der Tertiarisierung: "Direkte" Produktionsarbeit [/S. 17:] verliert an Bedeutung; viele Tätigkeiten sind inzwischen eher den Dienstleistungen als der materiellen Produktion zuzurechnen (vgl. Deutschmann 1997, S. 42).
Dienstleistungsarbeit ist häufig in höchst flexible Organisations- und Zeitstrukturen eingebettet, die nur noch wenig mit der klassischen Industriearbeit und ihren standardisierten Ordnungsregimen zu tun haben. Im expandierenden Dienstleistungsbereich finden wir Tätigkeiten, die große Autonomie der Arbeits- und Kooperationsgestaltung, der Zeitverwendung und räumlichen Mobilität verlangen oder zulassen, ebenso wie Arbeiten, deren Rhythmus vor allem von den Flexibilisierungsinteressen der Unternehmen diktiert und/ oder, wie im Bereich der sozialen und persönlichen Dienstleistungen, von dem Bedarf der Klienten bestimmt wird.
Diese Tendenzen des ökonomischen Strukturwandels tragen zur Veränderung der Profile und ebenso der organisatorisch-institutionellen Kontexte von Erwerbstätigkeit bei. Erwerbstätigkeit wird immer weniger durch den Typ der Produktionsarbeit in der standardisierten Massenfertigung repräsentiert, sondern zeigt eine bislang ungekannte Differenzierung von Arbeitstypen und Qualifikationsanforderungen selbst innerhalb derselben Unternehmen und Institutionen. Und auch der Organisationstyp, der das Normalarbeitsverhältnis stützte - das große Unternehmen -, büßt an Bedeutung ein gegenüber den kleinen und mittleren Unternehmen und/ oder neuen, netzwerkförmigen Zusammenhängen mit oft instabilen Marktbedingungen und flexiblen Organisationsformen und Zeitregimes (vgl. Kühl 1998 und Rogowski/ Schmid 1997, S. 568 ff.).
Die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, ökonomischer Strukturwandel und neuartige Differenzierungen von Unternehmen und Erwerbstätigkeit setzen auch eine institutionelle Stütze des Normalarbeitsverhältnisses unter Druck: das herkömmliche System der Kollektivvereinbarungen und sein Herzstück, den Flächentarifvertrag. Seit den achtziger Jahren, in Zeiten schrumpfender Wachstumsmargen und wachsender Arbeitslosigkeit, hat dieses System in zweierlei Hinsicht an allgemeiner Regulierungskraft eingebüßt: Erstens werden Pioniervereinbarungen nicht mehr wie früher in den Tarifverträgen anderer Branchen übernommen und verallgemeinert, mit der Folge, dass sich die Kollektivvereinbarungen zwischen Wirtschaftsbereichen immer mehr unterscheiden. Zweitens wer- den zunehmend auch Standards des Flächentarifvertrags selbst "flexibilisiert", d. h. differenziert und spezifischen betrieblichen Bedingungen angepasst.
Nach der Lage und Länge der Arbeitszeiten - früher ein Kernstück tariflicher Standardisierung - sind in den neunziger Jahren auch Löhne und Sozialleistungen in den Flexibilisierungssog geraten (vgl. Bispinck 1997, S. 555 f.). So wurden zunehmend Öffnungsklauseln, die betriebsspezifische Abweichungen oder Ausgestaltungen von tariflichen Normen erlauben, in die Tarifverträge eingeführt; Härteklauseln gestatten die befristete Unterschreitung von Tarifnormen. In Tarifverträgen wurden Entgeltstandards differenziert und mitunter Sozialleistungen eingeschränkt. Neben kollektiv regulierten Formen gewinnen auch Formen der "wilden" Flexibilisierung, die einseitig von Unternehmen durchgesetzt oder ohne Kenntnis der Gewerkschaft mit Betriebsräten vereinbart werden, an Boden.
Mit der "Verbetrieblichung" der Arbeitsbeziehungen verändert sich nicht nur die Rolle der betrieblichen Akteure im Verhältnis zu den Repräsentanten der Verbände, welche die Flächentarifverträge aushandeln. Es verändert sich auch der Bezugsrahmen der Politiken, da nun die spezifische betriebliche Situation an Gewicht gewinnt. Schließlich wird einem Regelungssystem der Boden entzogen, das bislang die Angleichung von Arbeits- und Vertragsbedingungen förderte, und es öffnen sich mit den neuen Differenzierungen auch neue materielle Disparitäten.
Die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses wird schließlich auch durch soziokulturelle Veränderungen befördert. Das wird besonders deutlich im Bereich der rasch expandierenden Teilzeitbeschäftigung. Im Jahre 1997 waren in Westdeutschland immerhin fast 40 Prozent aller erwerbstätigen Frauen und 10 Prozent der Männer teilzeitbeschäftigt (vgl. Holst/ Schupp 1998). [/S. 18:] Die rasche Zunahme der Teilzeitarbeit seit den achtziger Jahren hängt eng mit den Veränderungen des Erwerbsverhaltens und der Erwerbsorientierungen zusammen. Von Bedeutung ist vor allem die wachsende Erwerbsbeteiligung der Frauen, die sich zunehmend der der Männer angleicht. Sie erklärt sich gleichermaßen aus dem in den letzten Jahrzehnten stark gestiegenen weiblichen Bildungs- und Ausbildungsniveau, aus der Erosion des traditionellen Familienmodells und der zunehmenden Verbreitung von Haushaltsformen, in denen die Berufstätigkeit der Frau zur wichtigen oder einzigen Einkommensquelle der Familie wird. Teilzeitbeschäftigung ermöglicht vielen Frauen, die aufgrund ihrer sozialen Verpflichtungen in der Familie - etwa Kindererziehung und Altenpflege - und der unzureichenden öffentlichen Betreuung keine Vollzeitbeschäftigungen eingehen können oder möchten, erst den Zugang zur Erwerbstätigkeit, ohne die - kulturellen - Ansprüche an die Familienversorgung und Kinderbetreuung zu verletzen und die traditionelle Arbeitsteilung in der Familie in Frage zu stellen. Teilzeitarbeit schafft so neue Spielräume, setzt aber auch soziale Ungleichheits- und Abhängigkeitsbeziehungen fort.
Auch für andere Gruppen schafft die Teilzeitbeschäftigung erst die Möglichkeit, die Erwerbstätigkeit mit anderen Tätigkeiten - etwa Ausbildung und Weiterbildung, Betreuung, Eigenarbeit oder ehrenamtliche Tätigkeiten - zu verbinden, selbst wenn sie meist kaum ein existenzsicherndes Individualeinkommen und keine angemessene soziale Sicherung für Alter und Ausfallszeiten vermittelt.
Insgesamt entspricht das traditionelle Normalarbeitsverhältnis immer weniger den vielfältigen Notwendigkeiten, Bedürfnis- und Interessenlagen in einer Gesellschaft, in der traditionelle kollektive Lebenszusammenhänge, -stile und -rhythmen aufbrechen und sich differenzieren und mit ihnen Lebensplanung und Erwerbsstrategien der Individuen.
Eine Rückkehr zum Normalarbeitsverhältnis ist - dies dürfte deutlich geworden sein - weder realistisch noch den ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen angemessen; zu sehr hat sich das Erwerbssystem selbst im Zuge des wirtschaftlichen Strukturwandels differenziert, zu sehr haben sich auch gesellschaftliche Ansprüche an die Erwerbsarbeit aufgefächert und einer umfassenden Standardisierung den Boden entzogen. Das normativ-institutionelle Gefüge der Regulierung des Erwerbssystems ist aber noch weitgehend auf das Normalarbeitsverhältnis abgestimmt und unterstellt eine Normalität, die inzwischen zur Fiktion geworden ist. Mit der Erosion des Normalarbeitsverhältnisses, der Massenarbeitslosigkeit und der Differenzierung von Beschäftigungsformen sind aber neue Formen der sozialen Ungleichheit entstanden. Sie erfordern neue Politiken und regulative Vorkehrungen, wenn gesellschaftlicher Desintegration und der Vertiefung der Segmentierung im Erwerbssystem sowie der Gräben zwischen den Geschlechtern und Generationen entgegengewirkt werden soll. Dabei kann es nicht darum gehen, die Differenzierungen von Beschäftigungsformen zu beseitigen; es kommt vielmehr darauf an, sie sozial abzusichern und Wahl- und Wechselmöglichkeiten für die Beschäftigten zu schaffen. Es mangelt nicht an Vorschlägen (vgl. Dombois 1999).
In das Zentrum kontroverser Diskussionen sind die Vorschläge zur Ausweitung des Niedriglohnsektors gerückt, die auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze für Personen mit niedrigen Qualifikationen vor allem im Dienstleistungssektor setzen. Ihnen liegt die Annahme zugrunde, dass das hohe Niveau tariflicher und sozialpolitischer Regulierung und die vergleichsweise geringe Lohnspreizung in Deutschland einfache Tätigkeiten, gemessen an ihrer Produktivität, zu teuer mache und den Aufbau von Arbeitsplätzen mit niedriger Produktivität behindere; Potenziale zusätzlicher Beschäftigung, die im Dienstleistungssektor und vor allem im Bereich der personalen und sozialen Dienstleistungen ausgemacht werden, könnten nicht ausgeschöpft werden. Von der Erweiterung des Niedriglohnbereichs wird eine massive Expansion der Beschäftigung für Arbeitskräfte mit niedrigen Qualifikationen in arbeitsintensiven Dienstleistungsbereichen erwartet.
Es lässt sich dabei die neoliberale, marktorientierte Konzeption, wie sie von der bayrisch-sächsischen Kommission für Zukunftsfragen vorgestellt wurde, von eher institutionalistischen Konzeptionen unterscheiden, [/S. 19:] die eine Umorientierung von Arbeitsmarktpolitik und eine Re-Regulierung des Arbeitsmarkts verlangen; zu Letzteren ist der Vorschlag zu zählen, den Rolf Heinze und Wolfgang Streeck jüngst im Rahmen des Bündnisses für Arbeit vorgelegt haben. Die bayrisch-sächsische Kommission schlägt eine Radikalkur vor, die wie Claus Offe und Susanne Fuchs kritisch vermerken, "drei Dinge methodisch miteinander verbindet: das unbedingte Vertrauen auf die wissenschaftliche Lehre (nämlich der Marktökonomie); die Missachtung von bestehenden Institutionen und die heroische Zuversicht in die Mechanismen eines kontrollierten Bewusstseinswandels" (Fuchs/ Offe 1998, S. 297). Sie plädiert für eine radikale Deregulierung, die Aufhebung bisheriger sozialstaatlicher oder tariflicher Mindeststandards und insbesondere eine Öffnung des Lohnsystems nach unten, die eine produktivitätsorientierte Entlohnung einfacher Dienste möglich machen und nach Vorbild des US-amerikanischen "Job-Wunders" die Schaffung einer großen Zahl von zusätzlichen Arbeitsplätzen - bis zu vier Millionen - für Niedrigqualifizierte ermöglichen soll (vgl. Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen 1997, Bd. III, S. 19). Es wird ausdrücklich in Kauf genommen, dass die erhoffte Integration über den Markt mit zunehmender sozialer Ungleichheit verbunden ist (zur Kritik auch Bergmann 1998, S. 319 ff. und Senatsverwaltung für Arbeit, Berufliche Bildung und Frauen 1998).
Heinze und Streeck setzen dagegen stärker auf eine Verbindung von Marktmechanismen mit staatlichen Regulierungs- und Umverteilungspolitiken, so vor allem eine degressive Subventionierung der Sozialversicherungsbeiträge für Niedrigeinkommen, die durch weitere Maßnahmen flankiert werden sollen. Sie erwarten, dass dadurch Angebot wie auch Nachfrage im Bereich einfacher Dienstleistungstätigkeiten belebt, die hohe Arbeitslosigkeit von niedrigqualifizierten Arbeitskräften vermindert und sozial kaum geschützte geringfügige Beschäftigung sowie Schwarzarbeit in den ersten, regulierten Arbeitsmarkt überführt werden könnten.
Die Vorschläge zur Einrichtung eines Niedriglohnsektors sind auf breite Kritik aus unterschiedlichen Quellen gestoßen. Zentrale Annahmen werden in Zweifel gezogen. Von besonderem Gewicht ist der Einwand, dass soziale und personenbezogene Dienstleistungen qualifizierten Personals bedürfen, eine stärkere Lohnspreizung daher kaum zu einer Ausweitung der Dienstleistungen, etwa im Gesundheits- und Ausbildungsbereich, führen würden (vgl. Bosch 1999). Weiterhin werden die hohen Kosten einer allgemeinen Subventionierung von Niedriglohntätigkeiten angeführt und Zweifel an den erwarteten Beschäftigungseffekten, zumal für die besonders von Arbeitslosigkeit betroffene Gruppe der Niedrigqualifizierten, erhoben (vgl. Schupp u. a. 1999 und Bender u. a. 1999). Schließlich gelten die Befürchtungen dem möglichen Missbrauch und Mitnahmeeffekten, die dazu beitragen könnten, Sozialstandards in einen Abwärtssog zu ziehen und das institutionelle System industrieller Beziehungen auszuhöhlen (vgl. Senatsverwaltung für Arbeit, Berufliche Bildung und Frauen 1998, S. 135 ff. und Engelen-Kefer 1999, S. 1 ff.).
Während Konzeptionen zur Ausweitung des Niedriglohnsektors auf die Erschließung zusätzlicher Beschäftigungspotenziale setzen, zielen Strategien der Arbeitszeitverkürzung auf eine gleichmäßigere Verteilung eines gegebenen Erwerbsarbeitsvolumens, indem Beschäftigte ihren Arbeitsplatz zeitweise oder teilweise für Erwerbslose freimachen.
Es gibt inzwischen zahlreiche Ansätze der Arbeitsumverteilung auf betrieblicher, tariflicher und/ oder gesetzlicher Ebene, die im Gegensatz zu früher verfolgten Politiken der Arbeitszeitverkürzung nicht mehr einen (vollständigen) Einkommensausgleich vorsehen (vgl. Seifert 1998, S. 579 ff.). Dazu zählen: Regelungen, die Rechte auf Teilzeitbeschäftigung für bestimmte Beschäftigtengruppen (etwa Lehrer, Ältere) schaffen und dafür Neueinstellungen vorsehen; der Abbau von Überstunden; die Erweiterung von Freistellungen (Elternurlaub, Sabbaticals) mit befristeten Ersatzeinstellungen; schließlich auch betriebliche Bündnisse für Arbeit, welche eine befristete kollektive Arbeitszeitreduzierung ohne Lohnausgleich im Tausch gegen Beschäftigungsgarantien vorsehen (so etwa das VW-Modell). [/S. 20:]
Anders als in Fällen freiwilliger, optionaler Arbeitszeitverkürzung, welche die Interessenabwägung den einzelnen überlassen (wie Elternurlaub oder Sabbaticals, aber auch das Gros der Teilzeitbeschäftigung), dürften der kollektiven Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich enge Grenzen gesetzt sein. Es scheint kaum durchsetzbar, allgemeine, kollektive Verkürzungen dauerhaft akzeptabel zu machen, die weder nach besonderen Gruppen und ihren Zeit- und Einkommenspräferenzen differenzieren noch Spielräume für freiwillige Entscheidungen lassen. Schwierig ist dies insbesondere dort, wo Arbeitsumverteilung nicht so sehr auf die Stabilität der Beschäftigung im eigenen Betrieb, sondern allgemein auf die Verminderung von Arbeitslosigkeit zielt und somit "abstrakte Solidarität" mit den Erwerbslosen einfordert.
Aber auch die optionalen Formen der Arbeitszeitverkürzung sind mit Restriktionen befrachtet, die die Reichweite der Arbeitsumverteilung beschränken. Sie sind nämlich entweder mit Einbußen - vor allem bei den Ansprüchen an Einkommen und soziale Sicherung - verbunden oder belasten öffentliche Sozialkassen zugunsten bestimmter Gruppen (etwa Ältere); auch gibt es kaum Garantien dafür, dass frei gewordene Arbeitsplätze auch tatsächlich wieder neu besetzt und nicht zu Rationalisierungszwecken eingespart werden.
Eine zentrale Rolle kommt der Arbeitszeitpolitik auch in Vorschlägen zu, welche nicht nur Räume für die Umverteilung der Erwerbsarbeit, sondern auch für eine bessere, flexiblere Abstimmung von Erwerbstätigkeit und nicht marktvermittelten Tätigkeiten wie Familien-, Eigen- und Gemeinwesenarbeit öffnen und so eine gleichmäßigere Verteilung der verschiedenen Tätigkeitsarten zwischen den Lebensphasen der Individuen sowie zwischen den Geschlechtern ermöglichen sollen. Strategien umfassen vor allem verschiedene Formen der Arbeitszeitverkürzung, sei es als dauerhafte oder phasenweise Reduzierung der täglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit, sei es als blockartige Freistellung wie Sabbaticals oder Elternurlaub.
Bislang ist die Abstimmung der Erwerbsarbeit auf die differenzierten Lebenslagen und -ansprüche problematisch, weil "optionale", spezifischen Interessen entsprechende Erwerbsformen - sofern sie überhaupt zugänglich sind - häufig nicht die individuelle Existenz sichern, meist auch mit erhöhten Risiken behaftet sind. Einen interessanten Vorschlag macht Günther Schmid mit der "Strategie flexibler Arbeitsmarktübergänge". Dabei geht es vor allem darum, bisher blockierte oder riskante Übergänge zwischen verschiedenen Erwerbsformen und Tätigkeitsbereichen durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zu erleichtern und sozial abzusichern: Übergänge zwischen Arbeitslosigkeit und Beschäftigung, zwischen Bildung und Beschäftigung, zwischen Haushalts- und Erwerbstätigkeit, zwischen Erwerbstätigkeit und Rente, zwischen Kurz- und Vollzeitbeschäftigung. Dazu soll das vorhandene Instrumentarium der aktiven staatlichen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik und der Tarifpolitik genutzt und ausgestaltet werden (vgl. Schmid 1994, S. 9-23). Die Strategie der Übergangsarbeitsmärkte zielt auf eine spürbare Verminderung der Arbeitslosigkeit, zugleich aber auch auf eine flexiblere, den differenzierten Lebenslagen und -interessen entsprechende Gestaltung des Erwerbssystems mit einer Vielzahl unterschiedlicher Formen, die aber in höherem Maße als "abweichende Erwerbsformen" im Regime des herkömmlichen Normalarbeitsverhältnisses sozial abgesichert sind.
Die hier nur skizzierten Konzeptionen und Strategien zeigen neue - teils komplementäre, teils alternative - Wege in der Arbeitsmarktpolitik auf. Bislang wenig ausgeschöpft sind die Möglichkeiten der gesellschaftlichen Umverteilung von Erwerbsarbeit - zwischen Erwerbstätigen und Arbeitslosen, zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung. Wenig entwickelt sind auch noch Politiken, die flexiblere Abstimmungen und Übergänge zwischen Erwerbsarbeit und anderen, nicht marktorganisierten Tätigkeitsbereichen fördern. Eine weitere gesellschaftliche Umverteilung von Erwerbsarbeit verlangt nicht nur materielle und soziale Anreize zur Reduzierung von Arbeitszeit oder zum phasenweisen Ausscheiden aus dem Erwerbsarbeitsmarkt zugunsten erwerbsloser Personen, sondern auch langfristige soziale Sicherungen und Garantien; es wird dies nicht ohne die Aufgabe herkömmlicher Prinzipien gehen, die Anrechte auf die soziale Sicherung an die Erwerbstätigkeit zu binden. In jedem Fall verlangen die neuen Wege einen Umbau des etablierten, am Normalarbeitsverhältnis orientierten institutionellen Regulierungssystems - so von Arbeits- und Sozialrecht und industriellen Beziehungen. Sie rühren stets auch an etablierte Ansprüche und Privilegien und erfordern daher neue gesellschaftliche Pakte und Konzessionen der korporativen Akteure.
pBender, Stefan/ Kaltenborn, Bruno/ Rudolph, Helmut/ Walwei, Ulrich (1999): Die Diagnose stimmt, die Therapie noch nicht, IAB-Kurzbericht, (1999) 6
Bergmann, Joachim (1998): Die negative Utopie des Neoliberalismus oder: Die Rendite muss stimmen, in: Leviathan, (1998) 3, S. 319 ff.
Berliner Memorandum (1995): Berliner Memorandum zur Arbeitszeitpolitik 2000. für einen "New Deal" in der Arbeitszeitpolitik : kürzer und flexibler arbeiten - Arbeit umverteilen, Berlin
Bielinski, Harald (1997): Befristete Beschäftigung, in: Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen 1996 (1997), Band I, S. 171 ff.
Bispinck, Reinhard (1997): Deregulierung, Differenzierung und Dezentralisierung des Flächentarifvertrags, in: WSI- Mitteilungen, 50 (1997) 8, S. 555 f.
Bosch, Gerhard (1999): Zukunft der Erwerbsarbeit. Zur Rolle von Bildung und Löhnen im internationalen Vergleich, Berlin (unv. Man.)
Büchel, Felix/ Diewald, Martin/ Habich, Roland/ Schupp, Jürgen (Hrsg.) (1998): Arbeitsmarktstatistik zwischen Realität und Fiktion, Berlin
Deutschmann, Christoph (1997): Die Arbeitsgesellschaft in der Krise? Paradoxien der arbeitspolitischen Debatten der achtziger Jahre, in: Flecker, Jörg/ Zilian, Hans-Georg (Hrsg.) (1997), Pathologien und Paradoxien der Arbeitswelt, Wien, S. 42
Dombois, Rainer (1999): Auf dem Weg zu einem neuen Normalarbeitsverhältnis? Die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses und neue Strategien der Erwerbsarbeit, Arbeitspapier Nr. 36 der Zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen der Universität Bremen, Bremen
Engelen-Kefer, Ursula (1999): Niedriglohn als Beschäftigungschance?, in: Einblick, (1999) 39, S. 1 ff.
Fuchs, Susanne/ Offe, Claus (1998): Wie schöpferisch ist die Zerstörung?, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, (1998) 3, S. 297
Haisken-De New, John/ Horn, Gustav/ Schupp, Jürgen/ Wagner, Gert (1998): Das Dienstleistungs-Puzzle: Ein aktualisierter deutsch-amerikanischer Vergleich, in: DIW-Wochenbericht, 65 (1998) 35
Hinrichs, Karl (1996): Das Normalarbeitsverhältnis und der männliche Familienernährer als Leitbilder der Sozialpolitik, in: Sozialer Fortschritt, 45 (1996) 4, S. 104
Höland, Armin (1996): Normenwandel statt Normenerosion: Atypische Erwerbsformen aus rechtssoziologischer Sicht, in: Frommel, Monika/ Gessner, Volkmar (Hrsg.) (1996), Normenerosion, Baden-Baden, S. 100
Hoffmann, Edeltraud/ Walwei, Ulrich (1998a): Längerfristige Entwicklung von Erwerbsformen in Westdeutschland, in: IAB-Kurzbericht, (1998) 2, S. 4
Hoffmann, Edeltraud/ Walwei, Ulrich (1998b): Das Arbeitsverhältnis aus Sicht der Rechtsökonomie und der Arbeitsmarktprognostik, in: Büchel u. a. 1998, S. 318
Holst, Elke/ Schupp, Jürgen (1998): Arbeitszeitpräferenzen in West- und Ostdeutschland, in: DIW-Wochenbericht, 65 (1998) 37
Keller, Berndt/ Seifert, Hartmut (1997): Deregulierung, Differenzierung und Dezentralisierung des Flächentarifvertrags, in: WSI-Mitteilungen, 50 (1997) 4, S. 530
Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen 1996 (1997): Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit in Deutschland. Entwicklung, Ursachen und Maßnahmen, Bonn, Band I + III
Kühl, Stefan (1998): Wenn die Affen den Zoo regieren. Die Tücken der flachen Hierarchien, Frankfurt am Main/ New York
Lutz, Burkart (1984): Der kurze Traum immerwährender Prosperität, Frankfurt am Main, S. 210 ff.
Mückenberger, Ulrich (1985): Die Krise des Normalarbeitsverhältnisses, in: Mitteilungsblatt der Zentralen wissenschaftlichen Einrichtung "Arbeit und Betrieb", Bremen, 11/12 (1985), S. 4
Osterland, Martin (1990): "Normalbiografie" und "Normalarbeitsverhältnis", in: Berger, Peter A./ Hradil, Stefan (1990), Lebenslagen, Lebensläufe, Lebensstile, Sonderband der Sozialen Welt, Göttingen, S. 351 ff.
Pfau-Effinger, Birgit (1998): Der Mythos von der Hausfrauenehe. Entwicklungspfade der Familie in Europa, in: Soziale Welt. (1998) 2, S. 167 ff.
Rogowski, Ralf/ Schmid, Günther (1997): Reflexive Deregulierung. Ein Ansatz zur Dynamisierung des Arbeitsmarkts, in: WSI-Mitteilungen, 50 (1997) 8, S. 568 ff.
Schmid, Günther (1994): Übergänge in die Vollbeschäftigung. Perspektiven einer zukunftsgerechten Arbeitsmarktpolitik, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 12-13/1994, S. 9-23
Schupp, Jürgen/ Schwarze, Johannes/ Wagner, Gert (1998): Methodische Probleme und neue empirische Ergebnisse der Messung geringfügiger Beschäftigung, in: Büchel u. a. 1998, S. 95 ff.
Schupp, Jürgen/ Volz, Joachim/ Wagner, Gert/ Zwiener, Rudolf (1999): Zuschüsse zu den Sozialversicherungsbeiträgen im Niedriglohnbereich: Wenig zielgerichtet und teuer, in: DIW- Wochenbericht (1999) 27
Seifert, Hartmut (1998): Arbeitszeitpolitik in Deutschland: auf der Suche nach neuen Wegen, in: WSI-Mitteilungen, 51 (1998) 9, S. 579 ff.
Senatsverwaltung für Arbeit, Berufliche Bildung und Frauen (Hrsg.) (1998): Die Sackgassen der Zukunftskommission. Streitschrift wider die Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen, Senatsverwaltung für Arbeit, Berlin
Streeck, Wolfgang/ Heinze, Rolf (1999): An Arbeit fehlt es nicht, in: Der Spiegel, Nr. 19 vom 10. Mai 1999, S. 38
Zukunftskommission der Friedrich-Ebert-Stiftung (1998): Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, sozialer Zusammenhalt, ökologische Nachhaltigkeit, Bonn, S. 269 ff.
[/S. 438:] Der Beruf ist noch immer Basis für Orientierung, Beschäftigung und Arbeitsmarkt. Er ist in der Lage, die vielfältigen Strukturen in der Arbeitswelt und der Gesellschaft zu beschreiben. Berufszuordnungen und -bewertungen finden eine hohe Akzeptanz. Allerdings wird Beruf in seinem umfassenden Verständnis heute oft als Auslaufmodell bezeichnet und der Job als Gegenbild kurzfristiger und eher eindimensionaler Tätigkeitsstruktur als Zukunftsmodell propagiert.
Beruf hat viele Facetten: Raster für die Integration Jugendlicher, Tauschmuster, Arbeitsmarktregulator, Emanzipationsbasis, Identifikationskern bei sozialer und personaler Einordnung, Raum für Aufgaben- und Pflichterfüllung, Element sozialer Stabilität. Diese Aspekte sind in den letzten Jahrzehnten weitgehend in stabilen Stammbelegschaften aufgetreten. Die Auflösung dieser stabilen Rahmenbedingungen in der nachindustriellen Gesellschaft wird oft dahingehend interpretiert, dass mit dieser Entwicklung auch der Beruf seine Bedeutung verliere.
Als Indizien für die These, dass die Dauerhaftigkeit von Beruf gefährdet sei, werden angeführt, dass die berufliche Identität sich anderen Identifizierungsbereichen unterordne, dass Berufsausbildung und Berufstätigkeit sich voneinander abkoppeln, dass sich die Berufsausbildung zersplittere und damit für eine klare Identifikation nicht mehr geeignet sei, dass unscharfe Berufsangaben Signal für die schwindende Möglichkeit beruflicher Allokation seien und dass die Flexibilität enge Berufsabgrenzungen verbiete.
Bei der Analyse zukünftiger Arbeitswelten lassen sich Segmente vorstellen, von denen einige weiterhin betriebs- bzw. unternehmenszentriert sind und bei denen der Berufsbezug zwar sinnvoll - insbesondere für den Einstieg -, aber nicht unbedingt notwendig ist, während bei anderen Segmenten wegen des Verlustes dieser Betriebsbindung neue Identifikationsmuster erforderlich sind. Der Beruf in seiner umfassenden und zugleich offenen Struktur sowie seiner Beziehung zur Professionalität dürfte gerade in diesen offenen Arbeitsformen eine neue und wesentlichere Bedeutung erhalten.
Dieser Beitrag kann nur ein erster Schritt sein. Das komplexe Thema "Beruf" soll zunächst lediglich in seinen vielen Facetten beschrieben und eingeordnet werden. Weitere Arbeiten sollen folgen, in denen Einzelbereiche schärfer abgegrenzt und anhand von Forschungsergebnissen belegt werden.
Das Verständnis von Arbeit, ihre Bewertung und ihre Beschreibung haben sich immer wieder verändert, je nach den Rahmenbedingungen, unter denen Menschen die Arbeit gesehen haben. Unser heutiger "Arbeitsbegriff" ist durchaus nicht losgelöst von den historischen Entwicklungen und den natürlichen und gesetzten Rahmenbedingungen. Er ist zudem vielfältig und zeigt auch aktuell eine hohe Dynamik. Die Zentralität von Arbeit in der Gesellschaft und für die Gesellschaft wird daran deutlich, dass Thesen vom "Ende der Arbeit" große Resonanz finden.
[/S. 439:] Hier soll die Frage nach dem "Beruf" untersucht werden: Wird es in der Zukunft noch Berufe geben oder wird Erwerbsarbeit ohne das, was wir als Beruf bezeichnen, abgeleistet? Wird es also, wie schon sehr früh formuliert wurde, nur noch Tätigkeitsmuster oder "Jobs" geben? Oder besteht weiterhin der Wunsch und/oder die Notwendigkeit, Berufe abzugrenzen, sie auszufüllen und in ihrem Rahmen Erwerbsarbeit zu leisten?
Neben den traditionellen Zuordnungen, die den Beruf als umfassenden Begriff festlegen, der eine Vielzahl von Teilkategorien mit jeweils unterschiedlichem Gewicht harmonisch integriert, sehen aktuelle Beziehungsmuster die Erwerbstätigkeit eher im Job, der ad hoc spezifische Tätigkeiten umfasst, ohne die weiteren Teilkategorien von Beruf mitzutransportieren.
Schließlich gibt es immer wieder Einschätzungen, die davon ausgehen, dass die Erwerbstätigkeit aus dem Lebenszentrum auswandert und andere Bezüge zentral werden und dass damit insbesondere der Beruf an den Rand gedrängt würde bis hin zur Aussage, dass Beruf ersatzlos gestrichen werden könnte, da er in der modernen Gesellschaft keine Bedeutung mehr habe.
Daraus ergibt sich ein breites Spektrum: Auf der einen Seite der Beruf in seiner umfassenden Gewichtung, in der die soziale und gesellschaftliche Existenz auf die berufliche Verortung bezogen wird, auf der anderen Seite eine Gesellschaft von Menschen, die weder Sinn noch Verständnis für eine berufliche Verortung aufbringen und ihre - auch berufsähnlichen - Aktivitäten über andere Lebenssphären definieren.
Die Dominanz beruflicher Kategorien zeigt sich in folgenden Zusammenhängen:
In Bilderbüchern, in Liedern sowie in Spielen sind berufsbezogene Aspekte immer sehr dominant gewesen (siehe dazu beispielsweise Wallendy 1949, im Überblick Schneider 1990). Waren es früher eher handwerkliche Berufe im Wohnumfeld - beispielsweise der Bäcker und der Kaufmann - die in den Büchern und Spielen vorkamen, so kamen dann Räuber und Gendarm, auch Soldaten, bis diese vom Fußballprofi abgelöst wurden - allesamt spezifische beruflich definierte Rollen. Konkret werden Berufsfragen bei der Berufswahl, die einerseits Selbstfindung, andererseits Wahrnehmung der Erwerbswelt beinhaltet, und in der als Ergebnis eine zukunftsgerichtete Einordnung in eine durchaus als beruflich empfundene und geprägte Zukunft steht. Allein hier zeigt sich die große Bedeutung und Nützlichkeit eines knapp zusammenzufassenden Begriffs für ein komplexes Phänomen, denn eine Orientierung nur auf der Basis von wechselnden Jobs oder vielfältiger Tätigkeiten dürfte weitaus schwieriger sein, als wenn auf klar beschreibbare Berufsfelder zurückgegriffen werden kann, wenn also die übergroße Vielfalt der Merkmale in charakteristischen Clustern überschaubarer Zahl zusammengefasst und konkretisiert ist.
Die heutigen Berufsbildungsstrukturen der Aus- und Weiterbildung sind zwar überwiegend berufsbezogen, nicht aber mit der Berufelandschaft kongruent. Für manche Berufe gibt es keine geschlossene Ausbildungen, andere sind erst über Weiterbildungszertifikate erreichbar, für manche gibt es lediglich Einarbeitungen. "Berufsausbildung" als ausschließlicher Weg in den jeweiligen Beruf hat - speziell im Dualen System - eine gewisse Tradition, doch daneben zeigen sich zunehmend offene Muster, in denen Bildungselemente individuell gewählt und zusammengestellt werden und somit keine spezifische Beruflichkeit über die Qualifizierung vermittelt wird oder sich noch nicht prägend ausgewirkt hat, da die Entstehung bzw. Schaffung eines Berufsbildes einen langwierigen Prozess darstellt.
In der Arbeitswelt wird der Beruf genutzt, um die Rolle des Einzelnen im Betrieb und in der Gesellschaft zu beschreiben und zu bewerten. Betriebe sind nicht nur gezwungen, für die Statistik der sozialversicherten Mitarbeiter Berufskennziffern anzugeben, sondern sie nutzen den Berufsbegriff sowohl in der Berufsausbildung als auch für die Personalwirtschaft und die Personalplanung. Allerdings zeigen sich deutliche Auflösungstendenzen (siehe dazu auch Baethge/Baethge-Kinsky 1998), da im Wandel betrieblicher Arbeitsteiligkeit die traditionellen Berufszuweisungen oft nicht mehr geeignet sind, die aktuellen Erwerbsstrukturen zu beschreiben. Von den Erwerbstätigen selbst ist aber eine Berufszuweisung weiterhin gewünscht und wohl auch erforderlich, insbesondere wenn sich die betriebliche Zuordnung lockert.
Nach dem Ausscheiden bzw. Rückzug aus der Erwerbstätigkeit ist für viele Menschen in der Rückschau der Lebensweg durch den Beruf und die berufliche Tätigkeit geprägt. Viele Menschen haben durchaus den Wunsch, weiterhin ihre Berufszugehörigkeit aufrecht zu halten, möglicherweise sogar die Zuordnung zum Betrieb, in dem sie längere Phasen ihrer Erwerbstätigkeit verbracht haben. Selbst im Ruhestandsalter spielen der frühere Beruf und die Art der abgeschlossenen Erwerbstätigkeit eine weiterhin dominante Rolle.
Ein Gegenbild dazu könnte der Mensch sein, der in einer Lebenswelt agiert, in der Berufe nicht wahrgenommen werden, weil in den sozialen Bezügen Menschen nicht in ihrer Berufsrolle, sondern in anderen Aktivitäten erlebt werden, in der die unmittelbaren Dienstleistungen von Menschen ad hoc in Form von Jobs ohne Einbindung in traditionelle Berufsrollen geleistet werden. Eine Berufswahl erfolgt nicht, es werden lediglich Gelegenheitsarbeiten ausgeübt, bei denen möglicherweise Berufstätigkeiten abgedeckt werden, die aber wechselhaft und ohne Stabilität sind.
"Das Wichtigste im Leben ist die Wahl des Berufes. Der Zufall entscheidet darüber." (Pascal) "Der Beruf ist das Rückgrat des Lebens und seine Wahl die wichtigste Entscheidung, die der Mensch treffen muss" (Nietzsche) "Von der Berufswahl hängt zu einem wesentlichen Teil die weitere Ausgestaltung unseres Lebens ab, und jede Veränderung kommt einem Schicksalsumschwung gleich." (Sacherl 1954). Diese drei Zitate, ausgewählt aus einer reichen Palette derartiger Stellungnahmen, zeigen einerseits die Bedeutung, die dem Phänomen Beruf zugemessen werden, andererseits aber auch die damit verbundenen Probleme. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff "Beruf" oft unscharf verwendet und nicht eindeutig von Bezeichnungen, wie "Arbeit", "Tätigkeit", "Qualifikation" oder "Job" unterschieden. "Das sprachlich von "rufen"/"Ruf" abgeleitete Wort "Beruf" ist zwar schon Jahrhunderte bekannt, die Geschichte seiner Verwendung ist aber noch nicht ausreichend geklärt und bedarf noch tiefer schürfender Nachforschungen" (Molle 1968).
[/S. 440:]
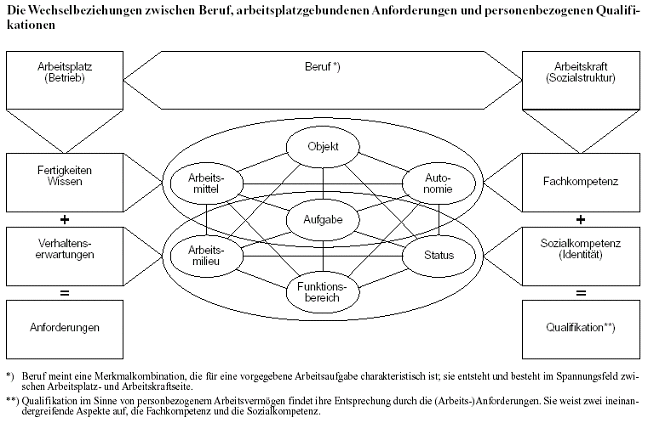 |
Beruf:
Der aus der Alltagssprache in die Sprache der Wissenschaft übernommene Begriff ist bis heute vielschichtig, mehrdeutig und umstritten. Der Beruf stellt die für eine vorgegebene Arbeitsaufgabe charakteristische Merkmalskombination dar. Beruf entsteht und besteht im Spannungsfeld zwischen Arbeitsplatz- und Arbeitskraftseite. Verfassungsrechtlich ist ein Beruf "jede auf Dauer berechnete und nicht nur vorübergehende, der Schaffung und Erhaltung einer Lebensgrundlage dienende Betätigung." Die freie Wahl des Berufes wird vom Grundgesetz garantiert, kann aber durch Gesetz eingeschränkt werden. In der Berufsforschung wird Beruf durch folgende Merkmale umschrieben:
Zusätzlich wird Beruf durch die folgenden Merkmale abgerundet:
Über den Beruf in seiner hierarchischen, statusmäßigen Abstufung sind die Chancen des Einzelnen festgelegt, sein Einkommen zu sichern, sich selbst zu verwirklichen, autonom zu handeln, an Kulturgütern teilzuhaben, über die Arbeit seine Identität zu finden und an der Weiterentwicklung und Ausgestaltung der Berufemuster aktiv mitzuwirken.
Job:
Als Gegenbild zum umfassenden Berufsbegriff umschreibt der aus dem amerikanischen Sprachraum kommende Begriff "Job" eine "Tätigkeit zum Geldverdienen", die in einer Arbeitsgesellschaft höchster Arbeitsteiligkeit als voraussetzungslose, schnell zu lernende Teilaufgabe definiert ist und die eher kurzfristig wechselnd abgeleistet wird, ohne dass auf dieser Basis eine stabile Identifikation mit der Aufgabe entsteht. In dynamischen Wirtschaften ist diese Form der Erwerbstätigkeit in der Lage, schnell auf neue Herausforderungen einzugehen, sie zeigt aber dort Probleme, wo befriedigende Leistungen nur mit längerfristiger Identifikation möglich sind.
Beruf und Job sind somit die weit auseinander liegenden Pole eines Spektrums, in dem Erwerbstätigkeit verortet werden kann.
[/S. 441:] Das deutsche Berufsprinzip basiert u. a. auf ethisch-religiösen Bindungen. Seine Deutung lässt sich auf eine "göttliche Berufung" des Menschen für bestimmte Tätigkeiten oder Aufgaben bis in die Reformationszeit und sogar bis in die frühchristliche Theologie zurückverfolgen. Bereits im Mittelalter wurde der Ausdruck "berufen" jedoch auch im weltlichen Sinne gebraucht. Handwerker wurden an Höfe berufen; an Universitäten werden heute noch Professoren berufen, Soldaten werden zum Wehrdienst einberufen.
Im 16. Jahrhundert konnte sich das Wort Beruf gegenüber dem Ausdruck "Stand" offenbar nicht allgemein durchsetzen. In dem von Hans Sachs verfassten und von Jost Amman mit Kupferstichen bebilderten Werk "Eygentliche Beschreibung Aller Stände auf Erden" aus dem Jahre 1568 oder in dem 1698 in Regensburg erschienen Bilderwerk von Christoff Weigel "Abbildungen der Gemein-Nützlichen Haupt Stände" werden 122 bzw. 204 "Stände" vorgestellt und beschrieben. Molle (1968) weist nach, dass noch 1900 in Urkunden durchgehend "Stand" anstelle von "Beruf" gebräuchlich war. Für Preußen lässt sich dies noch für 1929 (für Formulare an bayerischen Gymnasien sogar bis 1970) belegen.
Im 18. Jahrhundert wurden Beruf und die berufliche Arbeitsteiligkeit Thema der sich entwickelnden Nationalökonomie und auch der deutschen idealistischen Philosophie (Fichte, Schleiermacher).
In seiner Gesellschaftskritik im 19. Jahrhundert beschreibt Karl Marx die Entfremdungsformen einer durch Berufsdifferenzierung sich vertiefenden Arbeitsteilung. Sein Gegenkonzept: "Morgens jagen, nachmittags fischen, nach dem Essen kritisieren ... wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer... zu werden" (Marx) soll die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsteiligkeit des damaligen Proletariats überwinden. Im allgemeinen Sprachgebrauch des 19. Jahrhunderts verfestigte sich der Begriff "Beruf" und trat vor allem in Verbindung mit anderen Begriffen auf, z. B. Berufsgenossenschaft, Berufskrankheit, Berufsvereine. Nach der Reichsgründung 1871 nahm die Verwendung des Ausdruckes Beruf stark zu. Die ab 1882 durchgeführten Berufszählungen verwenden schon kombinierte Fachausdrücke wie Berufsabteilung, Berufsart in Sinne von Gewerbe bzw. Wirtschaftszweig. Es werden aber, abgeleitet aus der historisch geprägten Hauswirtschaft, jeweils auch die Familienangehörigen und Dienstboten dem Beruf des "Familienoberhauptes" zugeordnet. Erst 1925 werden nur noch die Erwerbstätigen in Berufen erfasst. In den 20er Jahren wurde "Beruf" vor den Hintergrund der industriellen Arbeitsteilung zum Thema "konservativ kulturkritischer" Diskussion (Voß 1994). Dunkmann (1922) beklagte das System der tayloristischen Arbeitsteilung und der "reinen Vernunft" im Arbeitsleben. "Wo die Ökonomie allein das Wort hat, hat der Beruf nichts mehr zu sagen." Dem müsse begegnet werden, in dem "wir auch unter modernen Arbeitsbedingungen dennoch danach streben müssen, der arbeitenden Menschheit ihren Beruf wiederzugeben" (Dunkmann 1922: 204-206).
In der Zeit des Nationalsozialismus bekam der Beruf eine besondere Bedeutung. Im Rahmen gesellschaftlicher Umstrukturierung wurde der Beruf ein wichtiges Klassifizierungselement. In einem Arbeitsbuch wurden die Arbeitsverhältnisse im Detail dokumentiert. Ziel war es, über diese Instrumente einen Überblick zu dem vorhandenen Arbeitskräftereservoir zu bekommen, um damit den Arbeitskräfteeinsatz in der Rüstungswirtschaft planen zu können. Facharbeiter waren zunächst für den Kriegsdienst unabkömmlich, erst 1943 wurde dies zurückgenommen. Gleichzeitig wurde die Kriegswirtschaft so weit wie möglich auf Anlernberufe umgestellt, sodass die Dominanz der Facharbeiter abnahm. In der Nachkriegszeit wurden gesellschaftlicher und emanzipativer Aufstieg eng mit der Zugehörigkeit zu einem höher bewerteten Beruf verbunden. Berufswahl und Berufsqualifikationen wurden Schlüssel zu einer besseren Position in der Gesellschaft, während die Rolle von Herkunft und Besitz eher abnahm. Auch bei der Subsistenzsicherung wurde das Arbeitseinkommen dominant, während Kapitaleinkommen, Versorgung aus der eigenen Landwirtschaft und Transfereinkommen peripher wurden. "Der Beruf ist, neben der Familie, eine der großen sozialen Sicherheiten, die der Mensch in der modernen Gesellschaft, insbesondere in der westlichen Zivilisation noch besitzt, verglichen etwa mit seinem Verhältnis zur Politik, zur Freizeit, zur Kultur und, jedenfalls in den meisten Fällen, auch zur Religion." (Schelsky 1965: 238, auch zitiert bei Paul-Kohlhoff 1998: 15). Beruf als Begriff und als gesellschaftliches Phänomen hat sich demnach parallel mit der Industriegesellschaft etabliert, seine Bedeutung hat im Laufe der Zeit deutlich zugenommen. Eine Existenz ohne Berufsbezug ist heute - mit Ausnahme der Kinder und der Ruheständler - kaum denkbar.
Bei einer Analyse der Berufsdefinitionen und -vorstellungen wird die Vielschichtigkeit sehr deutlich (siehe Übersicht 1). So scheint die Berufszugehörigkeit viele gesellschaftliche Strukturen abzubilden und die Allokation des Individuums in der Gesellschaft weitgehend zu bestimmen. Folgende Aspekte erscheinen besonders relevant: (vgl. Übersicht 1)
Zur weiteren Abgrenzung wird in Übersicht 2 auf der Basis aktueller Gegebenheiten
Schließlich zeigen die Definitionen der Übersicht 1 eine Reduktion auf die ausgeübte Tätigkeit oder auf spezifische Qualifikationen. Die unterschiedlichen Elemente von Beruf sind eng miteinander verknüpft, ja gewissermaßen wohl der Kitt, der diese Vielfalt zu einem Ganzen zusammenfasst, also jene Elemente, die den Beruf ausmachen:
[/S. 442:]
Übersicht 1: Elemente und Aspekte ausgewählter Berufsdefinitionen und -vorstellungen (des deutschsprachigen Raumes)
| Autor/ Quelle | wesentliche Elemente/ Aspekte der Definition |
| M. Weber (1925) |
|
Berufspädagogische Deutungen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Th. Scharmann (1956) |
|
| E. Ulrich, M. Lahner (1970) | Drei Aspekte werden genannt:
|
| H.A. Hesse (1972) | Beruf als "Vorgabe" (der Gesellschaft) - als Aktivitätsrahmen,
den das Individuum vorfindet und mitgestaltet
|
|
(bei Luckmann u. Sprondel, Hrsg., 1972) in Erweiterung des Ansatzes von H. Daheim |
|
| M. Brater (1975) |
|
| G. Büschges (1975) | Drei Dimensionen sind zu unterscheiden:
|
| J. Kühl, L. Pusse, B. Teriet, E. Ulrich (1975) |
|
| DDR-Arbeitskräftesystematiken (1978) | Beruf = Komplex von Voraussetzungen - Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten -,
|
| R. Crusius, R.M. Wilke (1979) |
|
| U. Beck, B. Brater, H. Daheim (1979) |
|
| Amtliche Berufsklassifizierung
(Statistisches Bundesamt Wiesbaden 1961, 1970, 1975, 1992) |
|
| H. Maier (1996) |
|
Quelle: von Henninges, H., Stooß, F., Troll, L., Berufsforschung im IAB: In MittAB 1/1976, Seite 5 (veränderte und erweiterte Wiedergabe 1998)
[/S. 443:]
Übersicht 2: Beruf als Strukturprinzip und Tauschmuster - Attribute/Befriedigungsangebote, Berufswahlkomponenten und Elemente sozialer Diskriminierung Arbeitsloser
|
||||||||||||||||||||||||
|
Systematische und alphabetische Verzeichnisse der Berufsbenennungen entstehen aus Befragungen, in denen die Berufsangabe im Klartext erhoben wird, und aus lexikalischen Arbeiten, durch die alle jemals aufgetauchten Berufsbenennungen dokumentiert werden. Insgesamt hat die Berufskunde der Bundesanstalt für Arbeit [1] - bei der Einführung der Informationstechnik - in einer groß angelegten Aktion etwa 100.000 unterschiedliche Berufsbenennungen in einer Datenbank gespeichert, die im deutschsprachigen Raum vorkommen.
Die Aussagekraft der Benennungen ist recht verschiedenartig, manche bezeichnen das Arbeitsgebiet klar, präzise und allgemein verständlich, andere sind unscharf und verschwommen. Viele, zumal neuere Bezeichnungen sind wenig bekannt, was u. a. damit zusammenhängt, dass laufend neue Berufsbezeichnungen entstehen, die zunächst nur einem kleinen Kreis von Experten bekannt sind.
Die Berufsbezeichnungen transportieren vor allem die folgenden Dimensionen:
Für Berufsorientierung, -beratung, Stellensuche, -angebote und -vermittlung ist es unabdingbar, dass klare Vorstellungen zu den verschiedenen Dimensionen der Berufe für alle Beteiligten verfügbar sind. Dies ist die Aufgabe der Berufskunde, die die Art und Weise der Berufsausübung laufend beobachtet und ihre Informationen zu "Berufsbildern" verdichtet. Beruf in seiner Mehrdimensionalität ist auch in der gesellschaftlichen Kommunikation präsent: "Die Antwort auf die Frage (nach dem Beruf) erleichtert die Einstufung eines Menschen innerhalb des beruflichen Wertesystems: Mag diesem System auch der Charakter von Vorurteilen oder Stereotypen anhaften." (Frieling 1980: 3)
Allerdings hat die Allgemeinverständlichkeit und die Aussagekraft der Berufsbenennung in den vergangenen Jahrzehnten abgenommen. Dies beruht vor allem auf
[/S. 444:] Übersicht 3: Der Wandel der Berufsstruktur von 1939 bis 1995 nach zwei Berufssektoren und 12 Berufsbereichen (Angaben in Prozent)
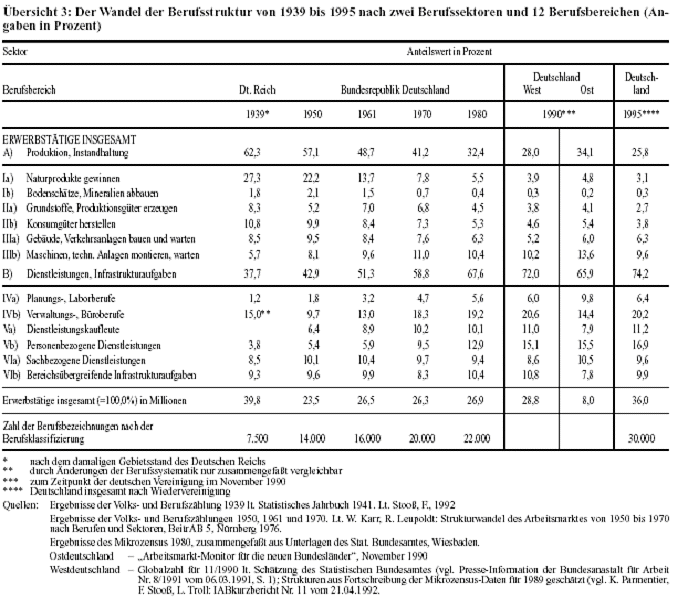 |
Gleichwohl bleiben die Berufsbenennungen Grundinformationen der Berufsforschung, basieren doch darauf Analysen und Aussagen zu den Haupttrends des beruflichen Wandels (Übersicht 3), ebenso aber zur Betroffenheit einzelner Gruppen und Berufe von Arbeitslosigkeit bzw. zu partiellen Arbeitskräftedefiziten und -überhängen (vgl. dazu Dostal/Parmentier/Schade 1999). Allerdings werden zunehmend auch tätigkeitsbezogene Charakterisierungen verwendet, um die Veränderung der Berufsinhalte bei stabiler Berufsbezeichnung deutlich zu machen. Dies ist ein Schritt, die hinter der Berufsbezeichnung stehende Mehrdimensionalität erkennbar zu machen.
In der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion der letzten Jahrzehnte wurde immer wieder vermutet, dass wegen der Zentralität von Arbeit in der DDR sich die dortigen Berufsstrukturen von denen der Bundesrepublik entfernt hätten. Durch gesellschaftliche, wirtschaftliche oder technische Umbrüche, so die Annahme, seien die langfristigen Entwicklungslinien der Berufsstrukturen verändert oder sogar unterbrochen worden.
Im Zuge der deutschen Einigung wurde im IAB [2] dieser Frage bereits früh nachgegangen: In einer im November 1990 durchgeführten Arbeitsmarktumfrage im Rahmen des Arbeitsmarkt-Monitors wurden die Berufsstrukturen in West und Ost verglichen (siehe dazu Parmentier u. a. 1992), nachdem bereits zuvor Ergebnisse aus dem Datenspeicher "Gesellschaftliches Arbeitsvermögen (GAV)" vorlagen. Die Übersicht 3 enthält u. a. eine Gegenüberstellung der Berufsbereiche in den alten und neuen Bundesländern, und es wird deutlich, dass bei der Verteilung der Erwerbstätigen nach Berufsbereichen die Unterschiede erstaunlich gering waren. Unterschiede ergaben sich überwiegend daraus, dass im Westen mehr Personen in Verwaltung- und Büroberufen, im Osten mehr Planungs- und Laborberufe zu finden waren. Daneben war die Besetzung der Berufe mit Männern und Frauen in Ost und West unterschiedlich. Insgesamt gesehen konnte also die jeweilige Gesellschaftspolitik die globalen Berufsstrukturen nur unwesentlich verändern, was deutlich macht, dass in Deutschland der Beruf und seine Interpretation offenbar eine autonome und tragfähige Kategorie ohne allzu große Beeinflussung durch gesellschaftspolitische Impulse ist.
[/S. 444:]
Berufsangaben müssen klar, kurz und handhabbar sein. Berufskategorien müssen den Durchschnittsbürgern wie den Personalfachleuten geläufig sein. Um welche Vorstellungen es hier geht, wird deutlich, wenn Piktogramme mit den Stereotypen der Berufsbilder Abschlussklassen an Haupt- und Realschulen vorgelegt werden. In aller Regel werden Schüler und Schülerinnen die Bilder korrekt den Berufen zuordnen.
Erfahrungen bei Großzählungen, in denen präzise Berufsangaben abgefragt wurden, zeigen in den letzten Jahren zunehmende Unschärfen. Schon bei der Berufszählung 1987 war erkennbar, dass Vorgehensweisen, die in Jahrzehnten angewendet und verfeinert worden waren, an ihre Grenzen stoßen. Die präzise Berufsangabe, die in einem Kurzprogramm prismengleich ein plastisches Bild der ausgeübten Tätigkeit erschließt, gibt es über weite Strecken nicht mehr. Allein die Frageformulierung im Mikrozensus "Welche Tätigkeit (Beruf) üben Sie aus?" weckt Zweifel: Ist "Beruf" im Sinne der personalen Identität und sozialen Verankerung gemeint oder schlicht die Bezeichnung für die tagtägliche Arbeit? Die gegebenen Antworten ergeben zumindest streckenweise Anhaltspunkte für eine Erosion des Berufsverständnisses.
Diese Unschärfen basieren einerseits auf der Verschiebung der Berufsinhalte aus den traditionellen Berufemustern hinaus, die es kaum noch möglich machen, mit traditionellen, historisch geprägten Berufszuordnungen umzugehen, sie sind aber auch Hinweis auf die zunehmende Integration von Elementen früher einzeln eingebrachter Berufe in neuen Hybridberufen. In der Klassifizierung der Berufe (1992) sind aus diesem Grunde Auffangpositionen gebildet worden, um auch die eher unspezifischen Berufsangaben zuordnen zu können. Die intensive Nutzung dieser Kategorien zeigt, dass es einen hohen Bedarf dieser eher allgemeineren Berufszuordnungen gibt.
Auf dem Arbeitsmarkt ist erkennbar, dass Stellenangebote - je nach dem Grad der Professionalisierung - sich entweder auf die Berufsangabe beschränken, oder - bei unscharfen Berufsangaben - eine größere Zahl von Berufs- und Ausbildungsabschlussbenennungen aufgeführt werden. Zusätzlich werden die Tätigkeiten und Arbeitsmittel im Detail beschrieben, indem "Spezialisten für" gesucht werden, bei denen dann die Aufgaben und Erwartungen weiter erläutert werden. Die Frage, warum diese eher offenen Angaben vermehrt auftreten, lässt sich über die folgenden Entwicklungen beantworten:
Immer schon waren Statistik und Forschung darauf angewiesen, die Vielzahl der Berufsbenennungen systematisch zu ordnen und nach Aggregationsebenen zu einer handlichen Zahl von Einheiten zu verdichten. Dabei muss jede Benennung eindeutig einer statistischen Einheit zugeordnet werden. Die Berufsklassifikation des Statistischen Bundesamtes (StBA) [3] wurde über Jahrzehnte als das Instrument der Erhebung, Vercodung und Verdichtung der erhobenen Berufsangaben (Berufsbenennungen) ausgebaut; sie wird in einer Fassung des Jahres 1988 nach identischen Regeln auch von den Dienststellen der Bundesanstalt für Arbeit [1] verwendet (zu den Grenzen und den Möglichkeiten, die die Berufsklassifikation der Forschung setzt, vgl. Dostal/Parmentier/Schade 1999).
Ab der Berufsklassifikation 1970 gibt es in Deutschland keine offiziellen Berufsbeschreibungen mehr, die bei der Klassifizierung von Berufsangaben helfen können, sondern lediglich Auflistungen der in einer Einheit aggregierten Berufsbenennungen. In diesem Zusammenhang erscheint es problematisch, dass bei den Richtlinien des StBA für Interviewer zwar auf eine klare und detaillierte Berufsangabe gedrungen wird, aber keine weiteren Hilfen angeboten werden.
Im hier behandelten Kontext sei festgehalten, dass eine hierarchische, eindeutige Zuordnung von Berufsbenennungen zu Klassen etc. der komplexen Realität von "Beruf" nicht gerecht werden kann. Es zeigen sich die Probleme in großer Vielfalt, beispielsweise:
Dennoch ist insbesondere für quantitative Angaben eine eindeutige Zuordnung von Belang, sodass bei aller Problematik auf derartige Zuordnungen nicht verzichtet werden kann. Allerdings zeigen sich dann bei dem Vergleich unterschiedlicher empirischer Ergebnisse erhebliche Abweichungen (siehe dazu Troll 1981), wie auch bei eher minimalen Veränderungen der Systematik große Zuordnungsprobleme auftauchen (beispielsweise beim Wechsel von der 70er Berufssystematik zur 82er).
Diese Probleme treten nicht allein bei Berufsangaben auf, sondern überall dort, wo Systematiken eine klare Zuordnung verlangen, beispielsweise bei der Angabe des Sektors, der überwiegend ausgeübten Tätigkeit oder anderer tätigkeitsnaher Kategorien, wie auch bei Produktklassifikationen und in anderen Statistikbereichen.
Mit dem Ziel, Grundlagen für Fragen der Berufsberatung, der Arbeitsvermittlung, der Berufsaufklärung und der beruflichen Rehabilitation zu erarbeiten, werden in der Arbeitsverwaltung seit über sieben Jahrzehnten detaillierte Analysen und Materialsammlungen durchgeführt.
Die Ergebnisse solcher berufskundlicher Ermittlungen haben zu Einzelbeiträgen und zusammenfassenden Beschreibungen geführt und berufskundliche Archive gefüllt. Als Pionierleistung auf berufskundlichem Gebiet kann das vom [/S. 446:] Landesarbeitsamt Sachsen-Anhalt [4] und später von der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung in den Jahren 1927-1936 herausgegebene mehrbändige Werk "Handbuch der Berufe" gesehen werden. In einem "interdisziplinären" Vorgehen (berufshistorische, arbeitswissenschaftliche, psychologische, soziologische, medizinische, arbeitsmarktorientierte Aspekte sind berücksichtigt worden) wurden unter Mitarbeit anderer Landesarbeitsämter, einzelner Arbeitsämter sowie einschlägiger Berufsorganisationen umfassende "Berufsmonografien" erstellt.
In diesem umfangreichen Werk, das in der damaligen - auch fremdsprachlichen - Literatur nicht seinesgleichen hatte, deutete sich bereits eine Strukturierung an. Bestandteile waren eine "allgemeine Berufskunde" mit den Teilgebieten Berufsgeschichte, Berufsnomenklatur, Berufsgliederung, Berufsstatistik sowie eine "spezielle Berufskunde", deren Schwergewicht beim Erkennen der speziellen Einzelheiten der Berufe (z. B. Aufgabe, Tätigkeiten, Qualifikationen etc.) lag. Dementsprechend differenziert war auch das Gliederungsschema des "Handbuch der Berufe", das in Übersicht 4 wiedergegeben wird.
In den fünfziger Jahren formulierte Arimond (1959) seine "Theorie der Berufskunde": Ausgehend vom damaligen gesetzlichen Auftrag: "Die Bundesanstalt hat die Berufsberatung durch allgemeine Maßnahmen und Berufsaufklärung zu ergänzen und zu unterstützen", sah die Berufskunde ihre Aufgabe vor allem darin, möglichst alle Eigenschaften, die dem Betrachtungsgegenstand "Beruf" eigen sind, genau zu beschreiben, um die Ratsuchenden umfassend zu informieren. Aus den sich hieraus ergebenden Aspekten und Betrachtungsweisen unterschied Arimond eine
Die "Pragmatische Berufskunde" setzt sich einerseits mit der Frage nach dem geistigen und materiellen Aufwand, der zum Eintritt in einen Beruf notwendig ist und andererseits mit der Problematik der Berufsaussichten und Einkünfte, die sich aufgrund dieses Aufwands ergeben, auseinander.
In Nachfolge der im "Handbuch der Berufe" begonnenen Grundlagenarbeit und mit dem speziellen Ziel, den vor der Berufswahl stehenden Jugendlichen Orientierungs- und Entscheidungshilfen zu geben, entwickelte die Berufskunde der Arbeitsverwaltung die "Blätter zur Berufskunde" [5] (Gliederungsschema siehe Übersicht 4). Als Gesamtdokumentation sind diese Berufsbeschreibungen eine wesentliche Grundlage für die Beratungs- und Vermittlungsdienste und dürften mit derzeit mehr als 800 Heften die wohl umfassendste Sammlung berufskundlicher Beschreibungen in der Bundesrepublik Deutschland darstellen. Die Bestimmung der Inhalte dieser berufskundlichen "Monografien" wird teils in Zusammenarbeit mit berufserfahrenen Fachleuten, teils aber mithilfe berufskundlicher Arbeitsplatzanalysen gewonnen. Vor allem letztere Methode sah Molle (1965) als erstrebenswert an. Seiner Ansicht nach kann die Zufälligkeit einer selektiven Arbeitsplatzbeschreibung nur dann ausgeschaltet werden, indem alle Arbeitsplatzvariationen soweit wie möglich erfasst werden, und zwar durch die Analysen entsprechender Aufgaben und Tätigkeiten an einer größeren Zahl von in ihren Kernaufgaben her gleichartigen Arbeitsplätzen.
Übersicht 4: Gliederungsstruktur für Berufsbeschreibungen der Berufskunde
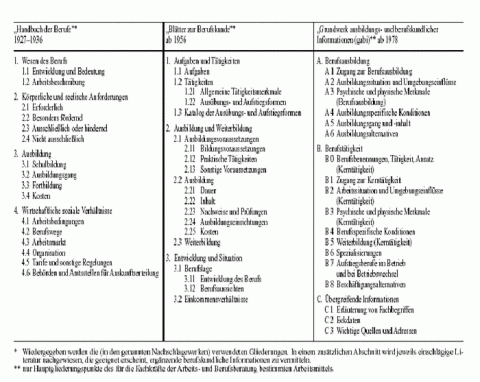 |
[/S. 444:] Ausgehend von diesem Verständnis sahen Stooß/Stothfang (1985) die Aufgabe der Berufskunde als systematisches Sammeln, Aufbereiten und Dokumentieren berufsbezogener Fakten und deren fortlaufender Aktualisierung. Diese Gedanken fanden ihren Niederschlag in dem seit Ende der siebziger Jahre entstehenden berufskundlichen Nachschlagewerk "Grundwerk Ausbildungs- und berufskundlicher Informationen - gabi -". Dieses Werk enthält umfassende und detaillierte Berufsinformationen und wird vor allem in der Beratungs-, Informations- und Vermittlungsarbeit eingesetzt (Gliederungsschema siehe Übersicht 4). Seit 1995/96 wird die gabi-Printfassung von einer DV-Version mit reduzierten Inhalten abgelöst.
Aktuelle Überlegungen der Berufskunde zielen vor allem in Zusammenhang mit neuen multimedialen Techniken auf einen so genannten "integrierten Datenpool Beruf", in dem sämtliche Informationen der Berufskunde zusammengefasst werden.
Im vorangehenden Teil wurde dargelegt, welche Aspekte bei der Definition des Berufs über Jahrzehnte hinweg im Vordergrund standen. Aus diesen Deutungen (siehe Übersicht 1 und 2) seien nun jene Elemente herausgearbeitet, die für Individuum, Wirtschaft und Gesellschaft besondere Relevanz haben.
Die individuellen Arbeitsvermögen werden auf Strukturen bezogen, in denen Erwerbsarbeit angeboten und entlohnt wird. Darauf fußen viele Definitionen des Berufs. Beispielsweise formuliert Hesse (1972: 130 f.):
"Berufskonstruktion soll heißen ein planmäßiger Vorgang zur Konstruktion von Mustern zur Qualifizierung und zum Tausch von Arbeitskraft,
"Professionalisierung soll heißen ein planmäßiger Vorgang zur Konstruktion von Mustern zur Qualifizierung und zum Tausch von Arbeitskraft,
Dieselbe Argumentation liefern Beck/Brater/Daheim (1980: 37), wenn sie die "subjektbezogene Arbeitsorganisation" als die für Verhältnisse des Warentausches charakteristische Form interpretieren, die zu dauerhaft institutionalisierten Kombinationen und Abgrenzungen vor Arbeitsfähigkeiten bzw. Tätigkeiten führe, "die als "Arbeitskräftemuster" von Individuen übernommen werden." Ein Modus, der die "Berufsform" der Arbeitsverteilung derartig bestimme, "dass wir sagen können: Der Beruf ist die Form, in der inhaltlich besondere Fähigkeiten als Ware angeboten werden. (...) Dominantes Gestaltungsprinzip der Berufsform ist ... die Vermarktbarkeit der Arbeitskraftangebote. Dieses Prinzip bestimmt zunächst auch die Herausbildung der Einzelberufe." (a.a.O.: 39)
Arbeitsfähigkeiten, gebündelt im Zuschnitt der institutionalisierten Kombinationen, die der Einzelne durch Berufsausbildung, berufliche Weiterbildung und/oder Einarbeitung erworben hat, werden am Arbeitsmarkt in Form von Berufen mit speziellen Berufsbenennungen angeboten. Andererseits werden Qualifikationserwartungen der Betriebe, die Arbeitskräfte suchen, in ebensolcher Form als Stellenangebote formuliert. Alle derartigen Benennungen, die spezifischen Arbeitsplatzprofile im Betrieb bzw. das spezifische Arbeitsvermögen der Individuen kennzeichnen, werden im deutschen Sprachraum dann unter "Beruf" subsumiert, wenn sie mit einer Benennung bezeichnet werden können und keine umfangreichere Beschreibungen erfordern.
Die Berufsausbildung und das dort erworbene Qualifikationsprofil wirken demnach als erste Zuschreibung des Fachberufs. Unterhalb der Hochschulebene sind Freisprechungsfeiern am Ende der Lehrzeit heute noch ein blasses Abbild ursprünglicher Initiationsriten, wie sie früher den Übergang der Jugend in die Erwachsenenwelt markierten. Diplome und Abschlusszertifikate bilden aber immer noch den Nachweis fachlicher Kompetenz; Handwerker dokumentieren sie öffentlich mit dem im Verkaufsraum ausgehängten Meisterbrief.
Berufskonstruktion, Verankerung der Ausbildungsprofile in Rechtsverordnungen, Erlasse der Kultusministerien zur schulischen Berufsausbildung, Studien- und Prüfungsordnungen der Hochschulen, Landes- und Bundesgesetze, die den Zugang zu Berufen an staatliche Examina binden, all dies sind beredte Zeugnisse dafür, wie sehr Berufsausbildung konstitutives Merkmal der Beruflichkeit ist. Möglicherweise haben sie die Flexibilität von betrieblicher Berufsallokation reduziert.
Betriebe würden möglicherweise offenere Zuweisungen wie Modularisierung und Bausteinsysteme bevorzugen, um sich nicht mit den starren und überkommenen beruflichen Strukturen auseinander setzen zu müssen. Allerdings erfordert dies besondere Bemühungen, bei der dann aufscheinenden Vielfalt die jeweiligen Kombinationen prägnant, für jedermann verständlich zu benennen. Welche Bezeichnung wäre dann in der Lage, die Fachqualifikation der Personen zu beschreiben?
Neuerdings tritt der aus dem anglo-amerikanischen Raum eindringende "Job" samt dem ihm zugeschriebenen "Jobdenken" neben den Beruf. Aus der Sicht tradierter Beruflichkeit wird dem Job immer noch eine eher negative Bedeutung zugemessen, wonach Job und Jobben als auf reinen Gelderwerb zielend angesehen werden, ohne dass ein Eintauchen in die Beruflichkeit in allen ihren Dimensionen erfolgt. Die Dauerbindung, die Identifikation mit der Arbeitsaufgabe und dem Unternehmen, die Sinnfindung in der Arbeit kann der Job nicht leisten, er orientiert sich am kurzfristigen Nutzen. Allerdings ist zu beobachten, dass die Vorliebe für Anglizismen oft dazu verleitet, von Job zu reden, wo es im Grunde genommen um Beruf geht.
Berufe und ihre Benennungen bündeln die vielfältigen Fähigkeiten von Menschen, wie auch die Aufgaben, die an Arbeitsplätzen auftreten, in programmatischer Form. Berufe mit ihren Benennungen werden zur Kommunikationsbasis über den Arbeitsmarkt und die Beschäftigung, sind Tauschmuster, nach denen Bedarf signalisiert, Angebot ermittelt und Marktausgleich erfolgen kann.
Die Diskussionen Ende der 70er Jahre über den Bedeutungsverlust des Berufs und seine Verdrängung durch den [/S. 448:] Qualifikationsbegriff, auch die Hervorhebung des kurzfristig definierten Jobs haben eine Neubesinnung über die Bedeutung von Beruf ausgelöst. In ihrem "Plädoyer für den Beruf" haben Crusius und Wilke (1979: 3) Leerfelder der aktuellen Berufsbildungsdiskussion, "die für die weitere Entwicklung in dieser Gesellschaft gefährlich werden können", bezeichnet und dargelegt, "dass eine neue, vom Berufsbegriff ausgehende Akzentuierung der Berufsbildungs- und Arbeitsmarktdiskussion notwendig ist." Beruf könne nicht Privileg einer elitären Minderheit sein, die eine erfolgreiche Berufs- und Standespolitik zu betreiben in der Lage sei. Plädiert wird für "die Wiederentdeckung des Berufs als dem interessenbezogenen Kriterium für das individuelle und kollektive Handeln der abhängig Beschäftigten und ihrer Gewerkschaften, das ... dem Rentabilitätsprinzip des Kapitals entgegengesetzt werden kann." (a.a.O.: 7). Arbeiter, Angestellte und Beamte identifizierten sich mit dem Beruf, auf den sie ihre materiellen Ansprüche, ihr Selbstbewusstsein und ihre betrieblichen Rechte gründen, denn "Begriffe sind auch soziale Wirklichkeit, in ihnen wird sie gedacht und erlebt" (a.a.O.: 8).
Die emanzipative Bedeutung von Beruf erschöpft sich nicht im Interessenabgleich zwischen Arbeitnehmervertretern und Arbeitgebern. Beruf ist - zumindest bisher - ein Wesensmerkmal spezifischer Erwerbsarbeit in abhängiger Position und bietet Subsistenzsicherung und gesellschaftliche Integration. Zentrale Rechtsnormen basieren auf derartigen Attributen des Berufs. Schon frühe Deutungen haben den Beruf als erwerbszentrierte Kombination von Verrichtungen, als Erwerbs- und Versorgungschance beschrieben. Ohne dass die deutsche Verfassung es expressis verbis formuliert, postulieren das Sozialrecht und das Sozialhilferecht die Eigenverantwortung des Individuums für die Subsistenzsicherung bzw. die Subsidiarität bei sozialen Unterstützungsleistungen. Das Grundgesetz verbürgt die Wahrnehmung der Erwerbschancen und der Versorgung unmittelbar und direkt durch folgende Elemente:
Der letzte Aspekt ist in wissenschaftlichen Analysen im Kontext der Beruflichkeit kaum thematisiert worden, allerdings von der Bildungsökonomie, die in ihrer Ausrichtung um die individuellen Humankapitalzurechnungen (siehe dazu Becker 1964) durchaus derartige Vermögensgewinne berücksichtigt. Ausbildung und ihre berufliche Verwertbarkeit werden unter dem Aspekt der Humanressourcen und ihrer nachhaltigen Entwicklung zu Investitionen der Individuen und der Wirtschaft als Ganzes, die - werden sie gepflegt und optimal genutzt - Standortvorteile im Wettbewerb bieten, im negativen Fall zu Fehlinvestitionen für Unternehmen und Individuen führen.
Die Grenzen, die die Verfassung einem Abbau an Beruflichkeit der Erwerbsarbeit setzt, sind bislang nur zum Teil ausgelotet. Mit dem ab Januar 1998 novellierten Arbeitsförderungsgesetz sind sie im Kontext mit der Frage neu bestimmt worden, welche Abstriche an Beruflichkeit Einzelne dann hinnehmen müssen, wenn sie Leistungen der Sozialversicherung in Anspruch nehmen. Die Anwendung der Neuregelung und einschlägige Urteile werden zeigen, in welchem Umfang das im Beruf konstituierte Bündel der Arbeitsfähigkeiten, der Subsistenzsicherung, der personalen und sozialen Identifikation zur Disposition steht, bzw. wann und in welchem Umfang Hilfen der Versichertengemeinschaft gewährt werden, die eingetretene Minderungen der Erwerbsbefähigung und des sozialen Status auffangen oder abfedern.
In welchem Umfang über Beruf soziale Wirklichkeit gedacht und erlebt wird, ist bereits skizziert worden. In Übersicht 2 wurde versucht, aus den Deutungen und Zuschreibungen des Berufs folgendes abzuleiten,
In diesem Kontext stehen Analysen, die Berufe nach dem Grad der Autonomie und möglichen Selbstverwirklichung eingruppieren. Hier geht es vor allem um die Gestaltbarkeit der Arbeitsvollzüge, die starre Berufsdefinitionen nicht zulassen, sondern eine Individualisierung beruflicher Ausrichtung erfordern. Persönlichkeitsförderliche Arbeitstätigkeiten (siehe dazu Ulich 1991) lassen sich - bezogen auf das Individuum - nur dynamisch definieren und abgrenzen, was zugleich zu einer offenen Berufszuweisung bzw. -modifikation und zu dynamischen Berufsbildern führen muss (siehe dazu Heidegger/Rauner 1997: 20 ff.).
Auch das Ausmaß der sozialen Anerkennung von Berufen lässt sich hierarchisch stufen und in einer Prestigeskala abbilden. Treiman (1979: 124 ff.) hat Messergebnisse zum Berufsprestige international verglichen und stellt eine hohe Übereinstimmung fest: "Mit den Daten von 55 Ländern betrug die durchschnittliche Korrelation zwischen Paaren von Ländern 0,81, was als sehr hoch angesehen werden muss." Beruf scheint also immer auch Prestige und soziale Anerkennung zu signalisieren.
Berufliche Mobilität könnte Beruflichkeit relativieren. Sofern die soziale Integration des Einzelnen über eine stabile Berufszugehörigkeit erfolgt, müssen Mobilitätsphänomene sehr differenziert bewertet werden. Das IAB [2] hat immer wieder Erwerbstätige befragt, ob sie - und wie oft - ihren Beruf gewechselt hätten und ob sie im neuen Beruf die in der Ausbildung erworbenen Qualifikationen verwerten könnten. Bei der letzten Erhebung (Jansen/Stooß 1992: 35 ff.) ergab sich bei Fachkräften mit betrieblicher Berufsausbildung ein durchschnittlicher Anteil
[/S. 448:]
Schließlich ist Beruf in Deutschland zum Vehikel für die Gleichberechtigung der Frau im Erwerbsleben geworden. Die gleiche Teilhabe an Erwerbsarbeit erfordert auch die Einordnung in Berufemuster. Berufe waren ja zuvor von Männern erdacht und gemacht, um außerhalb der Familie zu agieren und sich Geltung zu verschaffen.
Dauerhafte und gleichberechtigte Integration der Frau ins Erwerbsleben wirft damit berufsbezogene Fragen auf, stellt vorherrschende Deutungen in Frage, denn ohne eine Neuverteilung der Rollen in der Familie und beim Aufziehen von Kindern und in der Partnerschaft droht Frauen Überforderung bzw. ein phasenweiser Rückzug aus dem aktiven Berufsleben mit all den negativen Auswirkungen, die in der Frauenforschung thematisiert worden sind. Allein neue Erwerbsformen und Rollenbilder, die gleichermaßen für Männer und Frauen gelten, werden auf Dauer soziale Ungleichheit zwischen Männern und Frauen mindern und der derzeit erkennbaren hierarchischen Abstufung nach Einfluss, Ansehen, Einkommen und Karrieremustern ihre Schlagseite nehmen, die zur Pyramidenspitze hin immer mehr männerdominiert ist.
In der Berufswahl sind es oft die berufspädagogischen Deutungen des Berufs, die in individuellen Interessen und Fähigkeiten jene Variablen sehen, nach denen entschieden wird (bzw. werden sollte), welcher Beruf und welche Ausbildung ergriffen werden sollte. Darauf beruhen die Berufswahltheorien (Bußhoff 1992: 77 f.), die Berufswahl als Abgleich verstehen, bei dem zu klären sei, wo Einzelne ihre Interessen und Fähigkeiten optimal entfalten (Matching-Prozess), bzw. in welcher Weise sie ihr Selbstkonzept mit dem "Umweltkonzept" abstimmen (Berufswahl als Lern-, Entwicklungs- und Entscheidungsprozess) könnten.
Die Verschränkung sozialer Erwartungen und individueller Bemühungen ist bei Ableitungen des Berufs und der Berufsidee immer wieder im Nebeneinander von Aufgaben und Pflichten, die Einzelne der Gesellschaft gegenüber zu übernehmen haben, erörtert worden. In den Jahren um 1920 ist dies mit Vokabeln vom "Dienen" und "Dienst an der Gesellschaft" beschrieben worden, die ob des damit verbundenen Missbrauchs heute eher als Zumutung denn als Umschreibung einer sinnvollen Kongruenz individuellen und sozialen Bestrebens gelten mögen. Allerdings sind jüngste Änderungen des Sozialrechts u. a. auch als Rückgriff auf die damit thematisierten Pflichten gegenüber dem Gemeinwesen interpretierbar, wie dies aus der Begründung des Regierungsentwurfs zum AFRG aufscheint, wenn Pflichten der Arbeitnehmer präzisiert und im § 2, III des SGB III festgeschrieben werden.
Lebensversicherungen können seit Jahrzehnten mit der Absicherung des Risikos der Berufsunfähigkeit kombiniert werden. Ein Berufsschadensausgleich (Berufsunfähigkeitsrente) wird gewährt, wenn nach einem Unfall oder einer Krankheit die Rückkehr in den zuvor ausgeübten Beruf nicht mehr möglich ist und neben Einkommenseinbußen der Verlust des sozialen Status droht. Eine Berufsunfähigkeitsrente wird allerdings nicht fällig, soweit den Versicherten "Verweisungsberufe" offen stehen, deren Ausübung die Einkommensminderung und den Statusverlust auf das "zumutbare" Maß begrenzen können (siehe dazu Blaschke/Plath 1994: 301 f.).
Einen Berufsschadensausgleich durch eine Berufsunfähigkeitsrente hat bislang auch das Rentenrecht für ausgebildete Fachkräfte bei gesundheitlich bedingtem Berufsverlust vorgesehen.
Daneben sind Rechtsnormen entwickelt worden, nach denen Arbeitslose, die im bisherigen Beruf nicht mehr unterkommen, bei Arbeitssuche und Vermittlung mindere Bedingungen akzeptieren müssen, wollen sie nicht ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld verlieren.
In allen drei Bereichen wurde der Beruf als schutzwürdiger und existenzsichernder Tatbestand definiert, der vergleichbar ist mit dem Eigentum an materiellen Gütern. Vorstellungen darüber, welche Minderung beim sozialen Status, beim Einkommen und bei der Verwertbarkeit der Fachqualifikation in darauf abgestimmter beruflicher Tätigkeit hinzunehmen seien, bestimmen sowohl Grenzen des für den einzelnen Zumutbaren als auch den Schadensausgleich bei gegebenem oder drohenden Berufsverlust. Grundlage für den Schadensausgleich ist jeweils der "Fachberuf", der über die Ausbildungsberufe nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG), über vom Kultusministerium anerkannte Fachberufe, oder über Bundes- und Landesgesetze geregelte Ausbildungen und Berufsausübungen in Gesundheits- und Sozialberufen definiert ist. Beruf als elementare Einheit von Ausbildung, Ausübung, Aufbau und Aufstieg wird auf diese Weise zum Nukleus von Vorstellungen, nach denen
Das basiert auf den folgenden beiden Prämissen:
Daraus wurden Vorstellungen darüber abgeleitet, in welchen Tätigkeitsfeldern Bedingungen herrschen, die an Verweisungsberufe bzw. an zumutbare Berufe zu stellen sind. Grundsätzlich basiert der Berufsschutz auf dem Kongruenzprinzip, wonach Normen zur Berufsausbildung das Profil der zugehörigen Arbeitsplätze und dort Einkommenshöhe, Status und damit die Allokation des Einzelnen bestimmen. Wird Beruf nicht mehr als Realität gesehen und interpretiert und durch andere Realitäten im Erwerbssystem verdrängt, müsste der Berufsschutz zu einem nachrangigen Rechtsgut absinken, was wegen der bislang nicht gefestigten Rechtsprechung ohnehin erkennbar gewesen sei (Hesse/Filthuth 1993: 529 ff.). Als Folge dieser Entwicklung ergibt sich die Aufweichung des Berufs an sich und der mit ihm verbundenen Elemente, also Berufswahl, Berufsausbildung, Berufsausübung sowie Anpassungs- und Aufstiegsfortbildung.
[/S. 450:]
Beruf als Element der Arbeitsgesellschaft kann nur so stabil sein wie die Arbeitsgesellschaft selbst. Marx wurde schon erwähnt als Kritiker berufsbezogener "überzogener" Arbeitsteiligkeit, die zur Entfremdung führe. Auch heute, nach einigen Jahrzehnten Arbeitspsychologie und Arbeitswissenschaft mit dem Idealbild der umfassenden, breit angelegten, persönlichkeitsförderlichen Arbeitstätigkeit, werden enge Arbeitsvorgaben mit eingegrenzter beruflicher Struktur eher als überholt angesehen. Insbesondere anspruchsvolle Aufgaben ließen sich nicht mehr in traditioneller Weise in eher eng abgegrenzte Berufe gießen.
Daneben geht Beck (1996: 140) noch weiter, wenn er in allen nachindustriellen Gesellschaften einen Kapitalismus ohne eine Dominanz von Erwerbsarbeit heraufziehen sieht. Er hält den bevorstehenden Aufschwung der Dienstleistungsgesellschaft für einen der Mythen, die die Debatte von diesem Phänomen abschirme. Der Verlust der Arbeitsplätze führe in eine Situation, die durch Unsicherheit - ein Signum der Zeit - gekennzeichnet sei. Der "Beruf fürs Leben" drohe auszusterben. "Dass damit eine Wertewelt - die Welt der auf Erwerbsarbeit zentrierten Gesellschaft - untergeht, will niemand wahrhaben."
Stirbt aber mit dem stabilen Lebensberuf der Beruf - im deutschen Sinne und im deutschen Sprachraum mit dem ihm eigenen Verständnis - schlechthin? Sind Arbeitsmarkt, Arbeitsplätze, Qualifikationsprofile, Statusmuster, Ausbildungen, Weiterbildungen in Kategorien jenseits der Termini zu beschreiben, die gemeinhin "Beruf" genannt werden? Steht und fällt der Beruf mit seiner Ganzheitlichkeit sowie seiner Dauerhaftigkeit oder lässt er sich reduzieren auf jene konstitutiven, jedweder Erwerbsarbeit eigentümlichen Elemente, wie sie anderwärts unter "Job" oder "Occupation" subsumiert werden? Wird also das bewährte Normalarbeitsverhältnis obsolet? Stirbt der Beruf als allgemeine Kategorie aus, während in Nischen die Profession - im klassischen Sinne als monopolisierte Dienstleistung mit streng geregeltem Zugang über akademische/staatliche Examina - überlebt?
Wenn der Beruf am Ende wäre (Geissler/Orthey 1998), dann könnte sich dies in den folgenden Aspekten zeigen.
Ganz offensichtlich wird das Signet "Dauerhaftigkeit" für das Phänomen Beruf derzeit in Frage gestellt. Einvernehmen besteht darüber, dass die Zeiten dahin sind, in denen der Beruf einmal erlernt wird, den man dann - so eine Bezeichnung aus der Schweiz aus den 70er Jahren - in "Berufstreue" bis zum Ruhestand ausübt. "Der Begriff des Berufs vor allem spiegelt in dynamischen Gesellschaften nicht mehr den Inhalt oder die Anforderungen einer Position im Erwerbsleben wider. Besser brauchbare Kategorien stehen in der Erwerbsstatistik jedoch nicht zur Verfügung." (Mertens 1974: 38). Und schon im Jahresgutachten 1965 hat der Sachverständigenrat [6] zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung formuliert a.a.O.: 161 f.):
"Eine Ausbildung, die sich auf einen Lebensabschnitt beschränkt, kann der Entwicklung des Wissens und dem Wandel der beruflichen Anforderungen nur unvollkommen gerecht werden ... Maßnahmen, die Fortbildung und Umschulung anregen, erleichtern und begünstigen, werden deshalb in Zukunft für ein angemessenes Wirtschaftswachstum kaum entbehrlich sein. ... angemessenes Wachstum erfordert den Wandel der Strukturen, der Wandel der Strukturen jedoch Menschen..., die ihn treiben und ihn tragen. Die "zünftlerische" Vorstellung von einem Beruf, dem man gleichsam von der Wiege bis zur Bahre verpflichtet ist, wird der Zukunft noch weniger gerecht als der Gegenwart."
Der hier konstatierte Verzicht auf den Lebensberuf entspricht der Erfahrung, dass das Attribut "lebenslange Stabilität der Beschäftigung" als eine dem Beruf zugeschriebene Funktion, schon seit Jahrzehnten nicht eingelöst worden ist oder werden konnte. Die Mobilitätsforschung des IAB [2] (siehe dazu Hofbauer 1972 und 1981, Kaiser 1972 und 1975) hat immer wieder darauf hingewiesen, in welch großem Ausmaß - vor allem unterhalb der akademischen Berufe - Berufswechsel zum Alltag geworden ist. Zu Beginn der 90er Jahre waren von den betrieblich ausgebildeten Fachkräften nur 55% im erlernten oder in einem diesem verwandten Beruf beschäftigt, von den Übrigen, die in andere Tätigkeiten eingemündet sind, konnte nur jede(r) Dritte Wissen, Können und Erfahrung aus dem erlernten Beruf nutzen. Dies bedeutet, dass 30% aller Absolventen einer Berufsausbildung auf BBiG-Niveau einen Erwerbsweg hinter sich haben, in dem ihre in der Ausbildung erworbenen Qualifikationen weitgehend oder völlig entwertet worden sind.
Aus diesen Entwicklungen wird die Forderung abgeleitet, Berufsqualifikation und Berufsabgrenzung offen zu halten, laufende Aktualisierungen vorzunehmen und Beruflichkeit auf eine breite Basis langfristig stabiler und damit eher allgemeinerer Inhalte zu beziehen, statt auf ad hoc eingebrachte spezielle Verrichtungen. Unklar ist, wie in diesem Zusammenhang die Wirkung des Strukturwandels und der berufsspezifischen Arbeitsmärkte einzuschätzen ist. In der Mobilitätsforschung wird deutlich, dass es auf die Werthaltungen im Umfeld der Erwerbstätigkeit ankommt, und dass möglicherweise die Betriebstreue und der Verbleib im regionalen Bezug höher bewertet werden als die Treue zum Beruf.
Würde auf Berufe im Erwerbsleben verzichtet oder gingen sie, aus welchen Gründen auch immer verloren, dann stünde auch die berufliche und personale Identität, die über den Beruf und die dort erlebte Selbstverwirklichung und Sinnerfüllung gestiftet wird, zur Disposition. Bislang war der Beruf ein Signet dafür, wo jemand Experte sei, wovon er/sie etwas verstehe, wo Kompetenz, Routine und Erfahrung, ja Könnerschaft vorhanden sei, die ständig auch durch hohe Arbeitsleistung bewiesen werde. Damit sind - meist dem Facharbeiter zugeschriebene, in allen anderen Statusbereichen ebenfalls relevante - Eigenschaften verbunden, beispielsweise die Verantwortung für die Produktqualität, die Identifikation mit dem Produkt oder dem Betrieb. Deutlich wird dies in der tiefen Verachtung jeglicher Art von "Pfusch", mit der auch der Berufsstolz ausgedrückt wird.
Möglicherweise werden hier glorifizierende Strukturen und Werte aus dem Handwerksbereich in die Gegenwart übertragen, die in der betrieblichen Wirklichkeit mit rigiden Vorgaben und hoher Arbeitsteiligkeit nur am Rande bedeutsam waren und jetzt - wo die Einsatzflexibilität auch innerhalb der Unternehmen über traditionelle Berufsgrenzen hinweg eine wichtige Rolle spielt - kurzerhand abgestoßen werden.
Die Modelle persönlichkeitsförderlicher Arbeitsgestaltung versuchen zwar durchaus, die berufsfachlich strukturierte Identität zu erhalten oder neu aufzubauen, doch sie stützen sich nicht auf traditionelle Berufsabgrenzungen, sondern [/S. 451:] empfehlen Aufgaben- und Tätigkeitsstrukturen, die oftmals quer zu überkommenen Berufen liegen. Daraus ergibt sich in der ersten Runde eine Tendenz zum Verzicht auf - konventionell - abgegrenzte Berufe. In einer zweiten Runde werden neue Berufsschneidungen vorgeschlagen, die der jeweiligen Aufgabenmischung und Arbeitsteiligkeit eher entsprechen. Diese Modelle haben aber die Tendenz zur Anreicherung und zunehmenden Komplexität der Aufgaben, sodass nur das obere Segment der Erwerbstätigen in der Lage ist, diese anspruchsvollen Strukturen abzudecken. Für das untere Segment ergeben sich aber Probleme: Gerade jene Personen, die den Beruf nötig als identitätsstiftendes Element brauchten, da sie in anderen Gesellschaftsbereichen nicht in der Lage waren, auf feste Einbindungen zurückzugreifen oder sie aufzubauen, verlieren offenbar mit der anspruchsvollen Neudefinition der Arbeitsstrukturen den einzigen noch zugänglichen Identifikationsanker und werden auf wenig identitätsstiftende Jobs mit kurzfristigen und flachen Aufgabenfeldern verwiesen.
Nach dem deutschen Berufsbildungsgesetz ist im Konsens der Sozialpartner festgelegt, in welcher Bündelung Arbeitsaufgaben und die ihnen zugehörigen Verrichtungen, den ökonomischen Notwendigkeiten folgend, als Ausbildungsordnungen etabliert werden sollen, um danach in einer meist dreijährigen Lehrzeit Jugendliche so zu qualifizieren, dass sie nach Abschluss dieser Ausbildung voll einsatzfähig sind, und zwar in der Weise, dass sie Arbeitsaufgaben leisten können, die nach den Tarifvereinbarungen für Facharbeiter bzw. qualifizierte Angestellte festgelegt sind.
Stünden wir am Ende des Berufs, wie dies bei Hesse (1972: 130 f.) konstatiert wird, dann müssen die bisherigen Vorstellungen, dass die spezifischen Qualifikationserwartungen der Betriebe mit spezifischen Arbeitsleistungen über das Scharnier Ausbildungsberuf verknüpft werden können, damit über "planvoll konstruierte Muster zur Qualifizierung und zum Tausch von Arbeitskraft" die Interessen der Unternehmen an der Beschaffung von Arbeitskraft abgedeckt werden, aufgegeben werden. Das Ende der Berufsform der Arbeit würde dann beschleunigt, wenn die Unternehmen ihre Arbeitskräfte nicht durch eigene Ausbildung von Nachwuchs nach dem Berufsbildungsgesetz rekrutieren, sondern andere Wege suchen und nutzen. Jenseits der Berufsform entstünden lediglich modulare Qualifikationsbündel, die auf einem offenen Markt in variabel angebotene Jobs eingebracht werden könnten. Damit ist die Vorstellung nicht mehr relevant, dass die berufsbezogenen Ausbildungsangebote der Betriebe Indikatoren dafür seien, dass die jeweiligen Profile dem betriebsinternen Bedarf an Fachkräften entsprächen und - zumindest tendenziell - eine Option für die Übernahme als Fachkraft darstellten.
Wenn Facharbeit die Berufsform verliert, dann muss dies auch für die Berufsausbildung gelten:
Die große Vielfalt der Ausbildungsgänge dürfte eine Folge veränderter Bedarfsstrukturen im Beschäftigungssystem sein. Immer häufiger werden - geboren aus singulären Bedarfsaussagen - zusätzliche Kombinationen von Qualifikationselementen zu neuen Berufsausbildungen zusammengesetzt. Dabei handelt es sich nur selten um völlig neue Qualifikationselemente, sondern meist um eine neue Mischung verstreut bereits vorhandener Elemente im Sinne aktueller Forderungen. Die Probleme beim Übergang aus der Ausbildung in die Erwerbstätigkeit haben die Autonomie der Ausbildung reduziert, da Ausbildungen immer spezifischer auf den aktuellen Bedarf hin ausgerichtet werden. Qualifikationen und ihre Vermittlung werden zunehmend unter dem unmittelbaren Verwertungsaspekt gesehen.
Wenn richtig ist, dass sich die Spezialisierung weiter erhöht, dann ist es nur plausibel, wenn auch die Vielfalt der angebotenen Berufsausbildungen zunimmt. Dies erfolgt vor allem im schulischen Bereich durch immer neue Kombinationen. Dort dienen Spezialisierungen der Abgrenzung, sie werden im Marketing privater Bildungsträger intensiv genutzt und sind oft Profilierungselement für die Lehrenden und Organisatoren.
In der Dualen Ausbildung existiert dagegen ein Bedarf nach Straffung, weil die Betriebe klare und übersichtliche Vorgaben benötigen und die Berufsschule berufsspezifische Angebote regional nur bei einer ausreichenden Zahl von Auszubildenden im jeweiligen Beruf verwirklichen kann. Bei dieser Erosion wird der Berufsbegriff gern umgangen, denn dieser signalisiert in der Ausbildung immer noch eine gewisse Abrundung und eine umfassende Basis der gebündelten Qualifikationsziele. Die erste Stufe dazu ist die Entfernung der Ausbildungsabschlussbezeichnung von der Bezeichnung des Zielberufs. Es ist bezeichnend, dass seit fast zwei Jahrzehnten Ausbildungsordnungen verabschiedet werden, die Berufsbezeichnungen transportieren, die den Voraussetzungen von Klarheit, Prägnanz und Kürze eklatant widersprechen. So sind erhebliche Veränderungen erfolgt (siehe dazu BIBB 1997, Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe), beispielsweise:
[/S. 452:]
Diese Wortungetüme sind Ergebnis einer differenzierten Optimierung von Qualifikationselementen, sie sind aber nicht transportabel für die Identifikation mit einer Rolle in der Gesellschaft. Es ist bedeutsam, dass im Gegensatz zu diesen ausdifferenzierten und spezialisierten Ausbildungsabschlussbezeichnungen die umgangssprachlichen Kurzformen wie beispielsweise "Mechaniker", "Kaufmann" oder "Elektroniker" immer häufiger bei Befragungen genannt werden. Offenbar lässt sich nur so berufliche Identität signalisieren.
Eine zweite Stufe bei dieser Zersplitterung wird durch die neue Kombination von Berufsinhalten ausgelöst. Immer wieder werden additiv zusätzliche Inhalte auf bestehende Ausbildungen aufgesetzt, bis sie ein inhomogenes Spektrum von Inhalten darstellen, das keine Identifikationsrelevanz mehr hat. Bindestrich- und Hybridberufe für integrative Aufgabenlösung, Aufbau- und Doppelausbildungen sowie die Ergänzung des Qualifikationsprofils durch Fort- und Weiterbildungen führen zu individuellen Qualifikationsmustern, die in dieser Vielfalt weder von den Erwerbstätigen noch von den Arbeitsorganisatoren überblickt werden können. Neben der inhaltsbezogenen Differenzierung der Ausbildungsabschlussbezeichnungen ist auch zu beobachten, dass ähnliche Ausbildungen mit unterschiedlichen Etiketten versehen werden.
Der Vorschlag, offene dynamische Berufsbilder zu schaffen (Heidegger/Rauner 1997: 20 ff.), führt ebenfalls zu einer neuen Vielfalt, die die Orientierung erschwert. So sollen nur 50 bis 60% der Inhalte betrieblicher Ausbildung als Kern bundeseinheitlich geregelt werden, 20 bis 30% betriebs- und regionalspezifisches Anwendungswissen und 20 bis 30% arbeitsplatz- und betriebsbezogenes Zusatzwissen sollen individuell ergänzt werden. Die Auszubildenden wären also - was ihre Qualifikationsbasis anbetrifft - nur im Bereich der Kerninhalte vergleichbar, die Arbeitgeber müssten zusätzlich analysieren, wann und wo der/die Bewerber/in diese Ausbildung absolviert hat, welcher Betriebsbezug in der Ausbildung wirkte und dabei die möglichen Lücken und ihren Ausgleich bedenken. Die heutige Regulierung mit bundeseinheitlichen Abschlussprofilen wäre ersetzt durch ein Spektrum verschiedener Profile, ohne dass dies durch die Abschlussbezeichnung deutlich würde. Dieses Modell ist eher dort relevant, wo Auszubildende unmittelbar an innerbetrieblichen Spezifika angepasst werden sollen, nicht für einen breiten Arbeitsmarkt. Dies macht Sinn vor allem dann, wenn auch alle Ausgebildeten im Betrieb übernommen würden, doch die erkennbare Entwicklung ist eher gegenläufig.
So ist es durchaus relevant, wenn durch die Öffnung der Ausbildung Mobilität gefördert werden kann. Ein Verzicht auf tradierte Beruflichkeit (siehe dazu die Übersichten 1 und 2) könnte Rekrutierungsstrategien fördern, wie sie aus dem anglo-amerikanischen Raum berichtet werden, bei denen die Frage, ob sich jemand einen Job, also eine spezifische Tätigkeit, die nicht im Rahmen eines mehrdimensional verorteten Berufes geleistet wird, zutraut, ob er/sie in knapper Zeit mit der Aufgabe zurechtkomme, neben der Sozial- und Humankompetenz über die Jobchancen entscheide. Ausbildung für die Erwerbsarbeit reduziert sich damit auf eine Sozialisation, die die nötige Handlungskompetenz aufzubauen hätte.
Parallel dazu ist dann aber zu erwarten, dass es weiterhin Semi- und Vollprofessionen gibt, bei denen schon wegen der Qualität der Leistungen auf "Professionals" (eine alte deutsche Bezeichnung war "Professionist") nicht verzichtet werden kann. In diesem Segment bleiben berufsbezogene Qualifizierungsmodelle mit spezifischer Berufseinmündung im Rahmen der angebotenen Arbeitsplätze erhalten, die Tendenz geht hier eher in eine enger gebündelte Grundausbildungsstruktur mit erst anschließender Spezialisierung.
Grund- und Ausgangshypothese jeglicher Berufsentscheidung ist (siehe dazu Übersicht 2) eine niveauadäquate Einstufung mit der Option der Verbesserung von Qualifikation und Status. Die Aufforderung zu flexiblem Verhalten ist vielfach mit der Mahnung verbunden, es sei überholt, an dieser Verknüpfung festzuhalten, da Statusverbesserungen zukünftig eher jenseits des erlernten Berufs zu finden seien. Die Flexibilitätsforschung hat dazu die Rolle der Marktseiten beschrieben, also Flexibilität
Wesentliche Befunde dazu sind, dass die Berufsverwandtschaft die meisten Bewegungen von Absolventen zwischen Ausbildungs- und Ausübungsberufen erklärt. Dass es aber durchaus viele Berufsfelder gibt (sog. Erwachsenenberufe), zu denen keine spezifischen Ausbildungen angeboten werden und die nur durch Realisierung beruflicher Mobilität erreicht werden. Und dass schließlich in manchen Berufen Erstausbildungen gefordert werden, die dann als Basis für deren spezifische Fachbildung vorausgesetzt werden.
Weitere Informationen zur beruflichen Flexibilität ergeben sich aus den Aufstiegsketten, in denen aus Fachberufen in globale Managementaufgaben umgestiegen wird, ohne dass die Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Grundberuf aufgeben oder obsolet würden, und schließlich dient Flexibilität und Mobilität dem Ausgleich im Arbeitsmarkt, soweit nicht unüberbrückbare Rigiditäten auftreten.
Angesichts der ausgewählten Formen flexiblen Verhaltens wurde zwischen funktionaler und dysfunktionaler Mobilität unterschieden (Hofbauer 1973). Maßstab für die Unterscheidung war das Ausmaß, in dem Berufswechsler Fertigkeiten und Kenntnisse aus dem Vorberuf im Übergangsberuf anwenden können, was als Transferqualität der Berufsqualifikation beschrieben wurde. Trotz aller Verschiebungen zwischen Qualifikation und Berufsverlauf werden Grundmuster erkennbar, in denen die Stabilität der Beschäftigung in Kombination mit dem Verbleib in der Heimatregion dominant erscheinen. So wird Berufswechsel ohne Wechsel des Arbeitgebers und der Region ohne besondere Probleme realisiert, während er bei Änderung auch des Arbeitgebers und der Region - möglicherweise durch Arbeitslosigkeit erzwungen - eher negativ eingeschätzt wird.
Die Flexibilitätskalküle der Betriebe und der Berufstätigen selbst berücksichtigen die Berufszuweisung und die jeweilige [/S. 453:] Berufsausbildung. Dass häufig der Verbleib im Beruf, insbesondere im eng abgegrenzten Beruf, anderen Bedingungen geopfert wird, heißt nicht, dass der Beruf seine Bedeutung verlieren muss, sondern dass es noch weitere Rahmenbedingungen gibt, die berufliche Strukturen überlagern.
Die gegenwärtige Diskussion um den Beruf vermittelt streckenweise den Eindruck, Beruf, Berufsförmigkeit, Berufskonstruktion und deren Bedeutungsgehalt würden wie eine Art Steinbruch genutzt, aus dem je nach dem spezifischen Anliegen größere oder kleinere Brocken herausgebrochen und in Erörterungen hineingerollt werden, ohne dass geklärt wird, welche Ecken und Kanten dabei sichtbar werden. Festzuhalten wäre anhand der bisher skizzierten konstituierenden Elemente des Berufs: "Der Berufsgedanke ist ein 'Stück deutscher Geschichte.' Ob dies aber eine Geschichte ist, von der man bald nur noch in der Vergangenheit reden kann...", wie Paul-Kohlhoff (1998: 11) fragt, wird unter anderem dadurch bestimmt, ob Beruf in all seinen Dimensionen gesehen und als Gegenstand der Erörterungen präsent ist. Geschieht dies nicht, kommt es oft vorschnell zu der Aussage, der Beruf sei randständig oder aber Beruflichkeit sei in der nachindustriellen Gesellschaft nicht mehr relevant oder würde nur noch in peripheren Aspekten auftauchen.
Traditionelle Vorstellungen gehen weiterhin vom Ziel einer Vollbeschäftigungsgesellschaft mit überkommenen Organisationsmustern aus, die in der Industriegesellschaft entstanden und entwickelt worden sind. Wie in allen Strukturwandelphasen erhalten dann überkommene Elemente, die zunächst eher negativ bewertet wurden, an die man sich dann aber gewöhnt hatte, bei ihrem Verschwinden eine - möglicherweise nostalgische - positive Bewertung und treten als Wunsch und Ziel zu einem Zeitpunkt hervor, an dem sie nicht mehr realisiert werden können.
Obwohl das "Normalarbeitsverhältnis" nicht klar festgelegt ist, lässt sich heute (noch) das folgende Arbeitsverhältnis als dominant erkennen und steckt als prägende Norm in den Köpfen der Menschen (siehe dazu auch Hoffmann/Walwei 1998):
Diese Vorstellungen verknüpfen Erwerbsarbeit eng mit der Deutung und Bedeutung von Beruf (vgl. Übersicht 1). Beruflichkeit war und ist weitgehend mit derartigen Normstrukturen von Arbeit verbunden. Diese Muster lösen sich derzeit auf: Offene Arbeitsverhältnisse entstehen, in denen auch die Beruflichkeit neu bestimmt werden muss. Im Sinne der Job-Definition, also der tätigkeitsorientierten lediglich auf aktuelle Aufgaben hin bezogenen Besetzung von Arbeitsplätzen, ohne dass dies verknüpft ist mit den übrigen Dimensionen von Beruf, wird versucht, die offenen Arbeitsverhältnisse lediglich funktional festzulegen. Geringfügige und befristete Arbeitsverhältnisse benötigen offenbar nicht die berufliche Einbindung, wie dies in professionalisierten Aufgabenfeldern erforderlich ist. Es reicht aus, wenn spezifische Aufgaben befriedigend gelöst werden. Im Sinne des Fordismus erlaubt Arbeitsteilung und Kontrolle derartige Arbeiten, ohne dass der Wertschöpfungsprozess dadurch grundsätzlich in Frage gestellt würde.
Neben der Öffnung der Arbeitsformen verändert auch der Übergang in eine nachindustrielle Gesellschaft die Rolle von Beruf. Zur Vereinfachung der Diskussion sollen hier dominante Arbeitstypen von morgen knapp beschrieben und in ihren Folgen für die Beruflichkeit bewertet werden. Diese Skizzierung möglicher Arbeitstypen kann nur sehr kursorisch sein und dient lediglich zur Beschreibung der relevanten Elemente für den Beruf.
Trotz aller Schrumpfungstendenzen der Produktion, insbesondere in den entwickelten Industriestaaten, wird ein gewisser Produktionskern in jedem Land erforderlich sein, dazu bedarf es spezifischer Arbeits- und Berufsstrukturen. Allerdings sind die Vorstellungen über den adäquaten Arbeitseinsatz im Laufe der Zeit immer wieder modifiziert worden.
Frühe Formen handwerklicher Fertigung durch qualifizierte, in detaillierte Berufstätigkeiten eingeordnete Fachleute mit langjähriger Arbeitsplatz- und Unternehmenstreue und hohem Produktbezug wurden zu Beginn des Jahrhunderts im Zuge einer massiven Expansion durch Ungelernte ersetzt, die an determinierenden Produktionseinrichtungen wie dem Fließband und Einzweckmaschinen jene Aufgaben übernahmen, die noch nicht mechanisiert bzw. automatisiert werden konnten oder bei denen dies nicht wirtschaftlich erschien. Dies löste einen Prozess aus, der den Berufsbezug auflöste und bei dem die Arbeitskräfte in hohem Maße austauschbar wurden. Allerdings sind in diesem Organisationsmodell neue Berufe in der Kontroll- und Überwachungshierarchie neu entstanden. Aus fachlichen Berufszuweisungen wurden statusbezogene.
Die steigende Komplexität und Flexibilität von Produkten erzwang dann ab den Jahren um 1930 neue Qualifikations- und mit ihnen Berufsstrukturen, in denen Integrationsaufgaben als besonders wichtig erschienen. Die Entberuflichung im Taylorismus und Fordismus war immer nur auf die unterste Ebene der Erwerbstätigkeit bezogen, während sich darüber durchaus neue Beruflichkeit entwickelte, die aber keine Anknüpfungsstellen zur handwerklichen Organisation zeigte, sieht man von den Meistern ab. Aber gerade auf dieser unteren Ebene wurden Defizite deutlich, die offenbar durch die Entberuflichung ausgelöst wurden: mangelnde Identifikation mit der Aufgabe, nicht zureichende Qualifikationen, leichtfertiger Umgang mit Ressourcen und Infrastrukturen. Je komplexer und wertvoller die Arbeitsmittel und die Vorprodukte wurden, umso folgenreicher waren unbewusste oder bewusste Störungen und Fehlhandlungen.
Im Zuge der Arbeitsstrukturierung wurde deshalb versucht, wieder eine Basis für die Genese einer neuen Beruflichkeit zu [/S. 454:] legen. Dass dies zunächst vor allem im Sinne von Aufgabenanreicherung erfolgte, hat zunächst nahe gelegt, hier von einer Erosion von Beruf zu sprechen (siehe dazu auch Baethge/Baethge-Kinsky 1998), zumal dabei immer wieder sog. Hybridberufe (beispielsweise Mechatroniker) entstanden sind. Doch bei genauer Analyse wird deutlich, dass diese Strukturierung das Ziel hatte, Tugenden, die vormals mit der Beruflichkeit verknüpft waren, neu zu beleben, ohne die Starrheit beruflicher Segmentation zu übernehmen. Bei diesen Entwicklungen entstehen durchaus neue Beruflichkeiten - zwar mit breiteren oder neu geschnittenen Inhalten -, die einerseits die nötige integrative Kompetenz sichern, andererseits auch durch die Vielfalt der Arbeitsaufgaben die Zufriedenheit erhöhen. Die massiv unterstrichene Bedeutung extrafunktionaler Qualifikationen lässt sich auch im Sinne eines Wunsches nach zunehmender Beruflichkeit interpretieren, und zwar nach jenen Berufselementen, die eher querschnittsorientiert sind, also zusätzlich zu den funktionalen aus einem Job einen Beruf machen.
Neuere Entwicklungen hin zur Null-Fehler-Produktion begünstigen möglicherweise wieder tayloristische Strukturen, da die erwünschte Fehlerfreiheit bei Standardprodukten wohl eher durch deterministische Vorrichtungen und Verriegelungen auf der Seite der technischen Vorrichtungen und der eingesetzten Software als durch noch so umfassende Schulung des Personals erreicht werden kann. Bei innovativen Produkten bleibt dagegen die qualifizierte und spezialisierte Fachtätigkeit bedeutsam.
Ob die Innovationsraten in unserer Gesellschaft wirklich so massiv steigen oder ob dies eher Folge spezifischer Interpretationen ist, sei hier dahingestellt. Frühere Arbeiten des IAB [2] (Lahner/Ulrich 1969 und die Innovationsdokumentation, siehe auch Dostal 1983) haben deutlich gemacht, dass Messung und Bewertung von Innovationen äußerst komplexe Aufgaben sind und dass gerade in diesem Bereich die Planung und Determinierung von Aktivitäten nur hilfsweise möglich sind.
Es stellt sich die Frage, ob Innovationen innerhalb einer traditionellen arbeitsteiligen und auf Berufe bezogenen Organisation möglich sind, oder ob sie eher dann auftreten, wenn die Struktur traditioneller Berufe aufgebrochen wird. "Querdenker", Interdisziplinarität und evolutionäre Denkstrukturen scheinen in diesem Bereich von besonderer Bedeutung. Ohnehin gibt es die Berufsbezeichnungen "Erfinder" oder "Innovator" in der Berufsklassifikation nicht, lediglich Hilfskräfte mit determinierten Aufgabenstellungen als "Innovationsassistenten/innen" (technischer Umweltschutz, Berufsklasse 6293 - Statistisches Bundesamt 1992: 262). In der Gesellschaft sind aber derartige Berufsabgrenzungen durchaus gegenwärtig und anerkannt. Die These von der Entberuflichung speziell im innovativen Bereich geht wohl darauf zurück, dass die klassische überkommene Schneidung von Berufen den Innovationsprozess behindert und andere Kombinationen erforderlich sind, die bislang noch wenig analysiert sind. Die Behauptung, eine neue Zuweisung beruflicher Elemente würde die Innovationsfähigkeit reduzieren, lässt sich nicht belegen. Es ist durchaus möglich, dass neue Allokationen geeigneter beruflicher Elemente in der Aggregation von beruflichen Strukturen eine hohe Innovativität erlauben, die - weil sie "professionell" sind - Defizite nichtprofessioneller innovativer Aktivitäten vermeiden.
Doch auch in Forschung und Entwicklung gilt, dass nach einer anfänglichen Öffnung verkrusteter überkommener Berufsstrukturen interdisziplinäre und wenig determinierte Aufgabenfelder erkennbar sind, die zunächst von Personen mit breiten und kaum durch in traditionelle Berufe kanalisierten Kompetenzen abgedeckt werden. Danach beginnt zunächst bei den Hilfskräften, später auch in der mittleren Ebene eine Professionalisierung, bei der auch die spezifische fachliche Beruflichkeit an Bedeutung gewinnen wird. Berufliche Spezialisierung wird also insbesondere in der mittleren Qualifikationsebene bedeutsam bleiben.
Branchen, Berufe und Tätigkeiten, die dominant Informationen verarbeiten, haben sich in den letzten Jahren massiv in den Vordergrund geschoben. Die zunehmende Individualisierung hat eine steigende Komplexität ausgelöst, die individuelle Informationsverarbeitung erfordert. Durch den Einsatz von Computern besteht die Möglichkeit extremer Differenzierung und gleichzeitig wird eine Automatisierung der Informationsverarbeitung erleichtert. Informationsnetze hoher Leistungsfähigkeit erzwingen die Computerisierung auch bei der Kommunikation.
Auch hier stellt sich die Frage, ob die Informationsverarbeitung besser in berufsbezogenen Strukturen, also "professionell" aufgebaut und benutzt werden sollte, oder ob diese eher schädlich weil zu sehr determinierend sind. Weiterhin ist zu prüfen, ob anspruchsvolle Computerroutinen, die im Rahmen der künstlichen Intelligenz entwickelt und genutzt werden, Rückschlüsse auf die Beruflichkeit der Informationsverarbeitung zulassen (siehe dazu Dostal 1993).
Folgende Tendenzen sind in diesem Umfeld derzeit zu erkennen:
Die Gestaltbarkeit von Informationsarbeit scheint durch die hohe Flexibilität der Instrumente deutlich breiter zu sein als die anderer Arbeitstypen. Überdies geschieht der Umgang mit Informationen und Informationssystemen gleichermaßen in Erwerbsarbeit, in sonstiger Arbeit und in der Freizeit. Allein durch diese Universalität der Informationsverarbeitungsaufgaben könnte sich die Polarisierung in Berufsausübung und Freizeittätigkeit reduzieren.
[/S. 455:]
Dienstleistungen sind in der volkswirtschaftlichen Zuordnung Sammelbegriff für alle jene Aktivitäten, die nicht im primären und sekundären Sektor stattfinden, wobei die Grenzen unterschiedlich gezogen sind.
Dienstleistungsberufe sind nach der Klassifikation sehr eng eingegrenzt; die technischen Berufe (Ingenieure, Techniker, Naturwissenschaftler, Laboranten etc.) werden nicht dazugerechnet. Auch im Alltag sind Unterscheidungen im Detail nicht gebräuchlich. So wird ein Installateur, wenn er im Neubau installiert, meist als Produzent eingeordnet, wenn er vorhandene Einrichtungen repariert, wäre er eigentlich Dienstleister, dies wird aber in der Klassifikation nicht berücksichtigt. Die deutsche Berufsklassifikation trennt innerhalb der Produktionsberufe nicht zwischen Fertigung im eigentlichen Sinn und Wartung sowie Reparatur (vgl. dazu Übersicht 3 - Sektor A "Produktions- und Wartungsberufe").
Die massive Zunahme von Dienstleistungsaktivitäten, seien sie gemessen anhand der Zuordnung zu Sektoren oder Berufen, verstärkt die Beschäftigung in Bereichen, die sich nicht alle auf eine traditionelle Beruflichkeit beziehen können. Die Frage, ob die Beruflichkeit in den Dienstleistungen eine steigende oder fallende Bedeutung hat, ist in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung.
Dienstleistungen haben eine lange Tradition. Es waren insbesondere die haushalts- und personenbezogenen Dienstleistungen, in denen meist keine besonderen Qualifikationsanforderungen gestellt wurden und die somit auch im Geflecht anderer Tätigkeiten nur gering eingestuft waren. Ähnliche Tätigkeiten wurden auch außerhalb des Erwerbssystems geleistet. Die Unterschiede zwischen beruflicher Dienstleistung und privat erbrachter Dienstleistung bestehen lediglich in der Vorgabe des Berufsbegriffs, der lediglich Erwerbsarbeit, die vergütet wird, erfasst und statistisch als Erwerbstätigkeit ausweist.
Folgende Entwicklungen sind in diesem Bereich erkennbar:
In der Dienstleistungsarbeit sind kaum noch Zwänge zu finden, sie nach dem überkommenen Modell der Produktionsarbeit zu organisieren. Dies öffnet breite Freiräume für die Gestaltung von Erwerbsarbeit und Tätigkeiten außerhalb der Erwerbsarbeit. Es dürfte in vielen Fällen Ergebnis individueller Haltungen und Kalküle sein, ob spezifische Aufgaben in berufsbezogener Erwerbsarbeit oder als Freizeitaktivität geleistet werden.
Vordergründig scheint also der Beruf in seiner überkommenen Form mit dem Übergang in eine nachindustrielle Gesellschaft zwar seine Bedeutung zu verlieren, aber gleichzeitig zeigen sich Tendenzen, die eine Renaissance beruflicher Strukturen erkennen lassen. Die gewachsenen Gestaltungsmöglichkeiten von Arbeit führen zu neuen Varianten, bei denen der Berufsbezug in unterschiedlicher, oft in gegensätzlicher Weise erkennbar ist.
Die teilweise widersprüchlichen Entwicklungstendenzen - einerseits weitere Spezialisierung bei den Berufen, andererseits unscharfe und undifferenzierte Bedarfsstrukturen, die sich nur schwer mit Berufen traditionellen Zuschnitts abdecken lassen - sind am ehesten über das im folgenden beschriebene Segmentierungsmodell erklärbar (Übersicht 5).
Übersicht 5: Strukturmodell Erwerbssegmente nach der "Beruflichkeit"
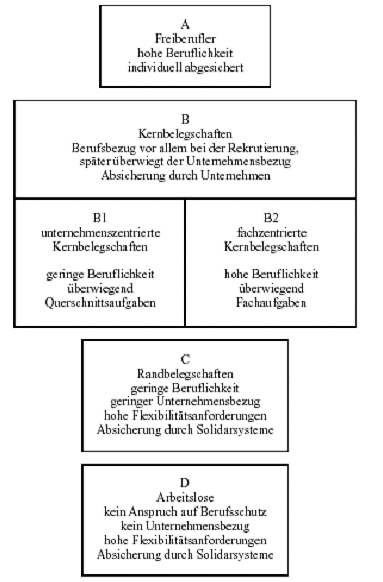 |
Das Segment B entspricht am ehesten der überkommenen Beschäftigung. Es umfasst die Kernbelegschaften und ist weiter aufgespalten:
Eine besondere Beruflichkeit höchster Spezialisierung zeigt sich vor allem im Segment A. Dort sind Selbstständige und Freiberufler verortet, die in einer ausdifferenzierten "Professionalität" ihre Dienste auf einem offenen Markt anbieten. In diesem Segment werden sich die Arbeitsstrukturen weiter öffnen, Netzwerke, virtuelle Unternehmen und Telearbeit werden hier zur Normalität. Die berufliche Spezialisierung wird in diesem Bereich weiter zunehmen. Querschnittsqualifikationen werden zwar eine gewisse Rolle spielen, doch längerfristig werden alle Elemente, die nicht unmittelbar mit der fachlichen Ausrichtung harmonieren, wieder abgestoßen und an Mitarbeiter oder Dienstleister abgegeben. Diese Gruppe hat sich in den letzten Jahren verbreitert, sie wird weiter expandieren und möglicherweise international vernetzt ihre Dienste anbieten.
Bei den Randbelegschaften (Segment C) geht die Beschäftigungssicherheit weitgehend verloren. Die Erwerbsarbeit erfolgt befristet und/oder geringfügig. Damit kann sich kein langfristiger Unternehmensbezug entwickeln. Die Ansprüche an die Flexibilität sind hoch. Eine Beruflichkeit kann sich nur begrenzt entwickeln. Flankierende Hilfen für soziale Absicherung und für die Anpassungsqualifizierung müssen angeboten werden.
Weiterhin verbleibt das Segment D mit den Arbeitslosen, um deren Einmündung in die Erwerbsarbeit sich spezialisierte Institutionen kümmern (wie bei C). Beruflichkeit und langfristiger Unternehmensbezug können nicht aufgebaut werden. Möglicherweise können durch ein Rotationsmodell die Segmente C und D integriert werden.
Im Prinzip benötigen Kernbelegschaften keine berufliche Zuweisung. Das Unternehmen sorgt für die Einordnung, die Identifikation und für die Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen. Berufszuordnungen als Gliederungsmuster werden zwar häufig genutzt, könnten aber durchaus ersetzt werden durch betriebsinterne Zuweisungen, die - wenn sie in Abkürzungen auftreten - innerbetrieblich zwar klar abgegrenzt, aber für Außenstehende kaum verständlich sind. Lediglich bei der Rekrutierung von Personal sind Berufsangaben nützlich, weil damit die Ansprache der gewünschten Personen ohne interne Kenntnisse der Unternehmensorganisation erleichtert wird. Unternehmen haben die Tendenz, die Aufgaben und Funktionen ihrer Mitarbeiter recht unscharf zu beschreiben und im Rahmen ihrer Personalplanung eher universell einsetzbare Arbeitskräfte zu suchen. Daneben gibt es immer wieder - oft kurzfristigen - Bedarf nach eng ausgerichteten Spezialisten, die möglichst ohne weitere Einarbeitung anstehende Fachaufgaben sofort übernehmen können. Aus diesem Grunde sind in diesem Modell in der Kernbelegschaft diese beiden Gruppen voneinander abgesetzt. In einer ersten Vermutung dürften die fachzentrierten Kernbelegschaften eher eine Berufsallokation zeigen.
Bei den unternehmenszentrierten Kernbelegschaften, also den eher global abgegrenzten Mitarbeitern mit hoher Flexibilität sind die innerbetrieblich definierten Aufgabenstrukturen dominant und scheinen sich erheblich von den im Bildungssystem vermittelten Inhalten und den darauf aufgebauten Zertifikaten zu unterscheiden. Dies wird deutlich im Rekrutierungsprozess, wo die fachlichen, aus der Berufsausbildung bezogenen Spezialisierungen keine besondere Rolle spielen, sondern eher extrafunktionale Qualifikationen angesprochen werden. In diesem Segment werden dann spezifische Persönlichkeitsmerkmale und außerordentlich hohe Flexibilitätspotenziale erwartet. Wenn hier eine berufliche Allokation gesucht wird, wird sie vom Arbeitgeber her entweder weitgehend unternehmensspezifisch ausgerichtet sein - bei der Berufsangabe werden überwiegend betriebliche Hierarchiepositionen angegeben - oder es bleiben bei den Arbeitnehmern Berufsausbildungszertifikate auch als Berufsbezeichnung erhalten, wenn diese ein gehobenes Image ausstrahlen. Im Grunde genommen benötigen diese Beschäftigten keine detaillierte berufliche Allokation, weder für die Signalisierung ihrer Position im Unternehmen, noch für die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt. Höchstens für die Allokation in der Gesellschaft könnte eine Berufszuordnung hilfreich sein, sie ist aber nicht unbedingt erforderlich.
Mit dieser Loslösung von beruflichen Mustern, die oft auch als Fesseln angesehen werden, bestimmen die Unternehmen mit ihren unternehmenszentrierten Kernbelegschaften in erheblichem Maße die Diskussion um die Bedeutung von Beruf. Ihr Votum, traditionelle Berufsmuster seien eher störend und behinderten innerbetriebliche Flexibilisierung, sie bedeuteten Gewohnheitsrechte, die abgebaut werden müssten und ähnliche Inflexibilitäten, ist zwar verständlich, sollte aber nicht durch einen vollständigen Verzicht auf Berufe beantwortet werden.
Die fachzentrierten Kernbelegschaften sind dagegen überwiegend über ihre fachlichen Spezialisierungen und Qualifikationen definiert und finden durch sie auch einen leichten Zugang zu beruflichen Allokationen. Der Unternehmensbezug ist bei diesen Fachleuten weniger intensiv, oft sind sie auch unternehmensübergreifend orientiert. Bei der Kommunikation mit Fachkollegen innerhalb und außerhalb des Unternehmens sind berufliche Einordnungen durchaus nützlich. So ergibt sich hier ein gewisser Bedarf nach Beruflichkeit.
Allerdings sind bei diesen Personen - im Unterschied zu den unternehmenszentrierten Kernbelegschaften - die in der Ausbildung erworbenen Fachqualifikationen von besonderer Bedeutung und schließlich berufsprägend. Allerdings liegt bei diesen Personen die Berufsausbildung oft weit zurück, sodass die in der Berufstätigkeit erworbenen Qualifikationen besonders wertvoll sind. Absolventen des Bildungssystems benötigen deshalb auch erhebliche Einarbeitungszeiträume, um die betriebsspezifischen Know-how-Elemente aufzunehmen. Ist eine berufliche Einordnung für diese Gruppe notwendig oder [/S. 457:] nur nützlich oder schadet sie möglicherweise? Oder wird der Unternehmensbezug dominant und verdrängt den Berufsbezug?
Diese Fragen lassen sich auf der Basis vorliegender empirischer Studien kaum klären. Zwar gibt es eine Vielzahl von Untersuchungen zu den betrieblichen Arbeitsstrukturen und den jeweiligen Rahmenbedingungen, doch die Berufsangabe und -zuordnung wird nie hinterfragt. In einer Befragung einer kleinen Gruppe von Mitgliedern der Gesellschaft für Informatik - hier handelt es sich überwiegend um Mitglieder fachzentrierter Kernbelegschaften (dies geht aus den anderen Frageelementen hervor - wurde bewusst eine doppelte Frage gestellt: a) nach der Berufsbezeichnung und b) nach der Funktionsbezeichnung. Die angegebenen Berufsbezeichnungen wurden standardisiert und zusammengefasst. Die dabei entstandene Matrix enthält Übersicht 6. Deutlich wird, dass die Angaben zu Beruf und Funktion auseinander gehen und dass die Hauptdiagonale - abgesehen von den Hochschullehrern, die offenbar eine glückliche Symbiose aus Beruf und Funktion eingegangen sind - nur sehr schwach besetzt ist (Dostal 1995b: 156).
Prinzipiell kann also davon ausgegangen werden, dass in Kernbelegschaften eine Berufszuordnung möglich ist, dass sie aber wenig nötig erscheint und dass sie eher nach außen hin verwendet wird, beispielsweise bei der Rekrutierung oder bei fachlichen unternehmensübergreifenden Kontakten. Hinweise aus dem Sprachgebrauch, dass manche Mitglieder von Kernbelegschaften bei der Berufsangabe eher den Betriebsnamen angeben als ihren Beruf, deuten darauf hin, dass in diesen Fällen einerseits das vermutete Image des Betriebs höher eingestuft wird als das des jeweiligen Berufs, sich andererseits die aktuelle Tätigkeit von der angestammten Berufsausbildung so weit entfernt hat, dass eine Nutzung einer Ausbildungsabschlussbezeichnung als Berufsbezeichnung nicht mehr sinnvoll erscheint.
Die unteren Randbelegschaften, zu denen auch die Arbeitslosen gerechnet werden sollten, lassen sich nach traditionellen Maßstäben nicht mehr spezifischen Berufen zurechnen. Sie bringen zwar über ihre Berufsausbildung eine Berufszuordnung mit, können bzw. konnten diese aber nicht durch spezifische Tätigkeitsbezüge anreichern. Ihre jeweiligen aktuellen Tätigkeiten sind nicht genügend entwickelt und spezifisch, um als Beruf im klassischen Sinne eingestuft werden zu können.
Für die Arbeitslosen ist es aufschlussreich, dass beim Übergang vom AFG zum SGB III die unterwertige Beschäftigung, die auch als Beschäftigung unterhalb des bisherigen oder erlernten Berufes interpretiert werden kann, die im AFG § 2, Abs. 1 aufgeführt war, im SGB III nicht mehr enthalten ist. Dort steht in § 2, Abs. 2, 3. "Die Arbeitnehmer haben ... jede zumutbare Beschäftigung anzunehmen." In einer vom BMA [7] herausgegebenen Schrift zum neuen Arbeitsförderungsrecht (BMA 1998: 38) wird folgendes erläutert: "Abweichend vom früheren Recht erfolgt keine Zuordnung von Arbeitslosen zu Qualifikationsstufen. Dies entspricht der Erfahrung, dass Arbeitnehmer bei einem Wechsel der beruflichen Tätigkeit ihre Entscheidung mehr auf die Veränderung der beruflichen Situation und das Einkommen abstellen als darauf, ob die Beschäftigung einem bestimmten Berufsabschluss entspricht." Beruflichkeit ist also in diesen unteren Randbelegschaften zumindest nicht über die Erwerbsarbeit und wohl auch nicht über die früher erworbene Qualifikation zu begründen. In diesem Segment dürfte eine Entberuflichung erfolgt sein, hier kann also von einem Job gesprochen werden, wie dies in der Umgangssprache üblich ist und wie dies in der Bezeichnung "Job-Vermittlung" der speziellen Dienstleistung der Arbeitsämter [1] deutlich wird.
Übersicht 6: Matrix Berufsbezeichnung/Funktionsbezeichnung für Computerberufe
| Abbildung vergrößern [8] |
[/S. 458:]
Schließlich gibt es derzeit deutliche Anzeichen für eine Öffnung von Arbeitsstrukturen hin zu freiberuflichen und selbstständigen Existenzen im oberen Statusbereich, in dem das eigene Know-how frei vermarktet wird bis hin zu weltweiten Aktivitäten. Im Rahmen von Informationsverarbeitung und Telekommunikation sind derartige offene Arbeitsverhältnisse bis hin zu virtuellen Unternehmen heute schon sichtbar und werden sich möglicherweise auch weiter entfalten.
Diese offenen Strukturen bedürfen - wie dies bereits in früheren offenen Arbeitsgesellschaften, beispielsweise des Mittelalters erkennbar ist - detaillierter Gestaltung. Die Auftragsvergabe an Individuen bzw. die Aufnahme von Individuen in ein Netz eines virtuellen Unternehmens beruht auf gewissen Erwartungen bezüglich der fachlichen Eignung, der Solidität in der Auftragsabwicklung, der spezifischen Flexibilität und anderer Elemente, die - siehe oben - als konstituierend für den Beruf in seiner vollen Mehrdimensionalität gelten. Aus diesem Grunde benötigen diese oberen Randbelegschaften eine Einordnung in ein Raster, mit der sie ihre Leistungs- und Kooperationsfähigkeit nach außen hin deutlich machen können. Die Instrumente dazu sind detaillierte Leistungspotenzialbeschreibungen und Referenzen über erfolgreiche Projektarbeiten. Da die Hülle des Unternehmens fehlt, die möglicherweise für die einzelnen Mitarbeiter diese Garantien bereitstellen würde, muss dies durch das Individuum selbst aufgebaut werden. Damit erhält Beruf in diesem Segment eine neue und deutlich gewichtigere Bedeutung, als dies bei Kernbelegschaften jemals nötig war und ist.
So ist erkennbar, dass in diesem Segment berufliche Einordnungen ein besonderes Gewicht erhalten und dass es sinnvoll wäre, alle Entwicklungen bei der Professionalisierung, bei der Neubewertung von Beruf, in der Berufsforschung und in ähnlichen Aufgabenfeldern speziell in Bezug auf diese oberen Randbelegschaften zu diskutieren und zu analysieren. Gleichzeitig ist dies eine Möglichkeit, die Tendenzen der Internationalisierung, die in diesem Segment besonders deutlich sind, mit in diese Arbeiten einzubeziehen.
Bei einer Zuordnung der Erwerbstätigen zu diesen Segmenten ist damit zu rechnen, dass das Segment der Kernbelegschaften weiterhin Bestand haben dürfte (siehe dazu Seifert/ Pawlowsky 1998). Lag der Anteil der Kernbelegschaften lange Zeit recht hoch, so wird er im Zuge des Leanmanagements und des Outsourcings zurückgehen. Allerdings wird ein massiver Kern bestehen bleiben. Eine vollständige Auflösung in virtuell strukturierte Unternehmen (siehe dazu Reichwald u. a. 1998, dort insbesondere S. 231 ff.) ist nicht zu erwarten. Allerdings ist denkbar, dass die Unternehmen, je nach ihrer aktuellen Situation und ihren spezifischen Aufgaben, ein optimales Verhältnis zwischen Kern- und Randbelegschaften suchen und finden.
Die Individuen werden sich durch die Segmente hindurchbewegen: Ein Umstieg zwischen den Segmenten wird häufig sein und durch die jeweiligen Marktbedingungen bestimmt. Ob eine Funktion in die obere Randbelegschaft hineinfällt oder in die untere, ist auch eine Folge der Bedarfs- und Angebotsrelation in den spezifischen Aufgabenstellungen. Traditionelle Vorstellungen und historische Besitzstände scheinen hier keine allzu große Rolle mehr zu spielen. Auch erworbene Qualifikationen und Zertifikate aus dem Bildungsbereich, ja selbst Berufserfahrungen können obsolet werden, wenn die Nachfrage sinkt und das Angebot zunimmt.
Für die Beruflichkeit in der Zukunft lassen sich daraus keine einlinigen, ausschließlichen Folgerungen ableiten. Je nach Brauchbarkeit beruflicher Allokation werden die Akteure in der Beschäftigung und auf dem Arbeitsmarkt sich dieses Abgrenzungs- und Strukturierungsmerkmals bedienen. Der Berufsbegriff mit seiner impliziten Mehrdimensionalität dürfte gerade in Umbruchzeiten besonders hilfreich sein, um komplexe Strukturen anschaulich zu beschreiben.
Beruf beschreibt gleichermaßen aussagekräftig, vollständig und bewertend Erwerbsaktivitäten von Menschen. Er ist mehrdimensional angelegt und somit an komplexe Realitäten anpassbar. Darüber hinaus ist er in der Lage, auch Veränderungen aufzunehmen und zu transportieren. In einer von Wandel geprägten Welt kann Beruf weiterhin die Aufgaben übernehmen,
Auflösungstendenzen sind erkennbar, weil
Diese Auflösungstendenzen bieten aber zugleich neue Chancen für den Beruf. Wenn die Stabilität von Beschäftigung abnimmt und gleichzeitig hohe Anforderungen an die Mobilität gestellt werden, wenn sich weiterhin die Arbeitsaufgaben häufig verändern, dann lassen sich aus der Erwerbsarbeit immer weniger identitätsstiftende Faktoren ableiten. Unabhängig vom Arbeitgeber und einem spezifischen Arbeitsplatz erhält der Beruf eine neue Bedeutung, da er für die Berufswahl, die Qualifizierung und für den Arbeitsmarkt ein Raster anbietet, das wegen seiner Mehrdimensionalität und Anpassungsfähigkeit bei gleichzeitiger Stabilität als Instrument zum Ausgleich und zur Bewältigung der erkennbaren Herausforderungen verwendet werden kann. Der Beruf als Allokationsprinzip sollte deshalb nicht leichtfertig aufgegeben werden, da er auch in einer nachindustriellen Gesellschaft mit offenen Arbeitsformen sinnvoll und nützlich ist.
Für die Berufsforschung ergibt sich daraus die Aufgabe, die Rolle und Bedeutung von Beruf in dieser Umbruchsituation herauszuarbeiten und Instrumente zu entwickeln, die Veränderungen im Umfeld von Beruf und innerhalb der Berufe zu analysieren und zu bewerten. Dazu gehören die Akzeptanz der Mehrdimensionalität, die Ausweitung der Kategorien bei der Erfassung und Strukturierung auch neuer Berufsfelder und Berufe, die Kategorisierung und Clusterung der vielfältigen Informationen sowie die Bereitschaft, die Berufelandschaft aus verschiedenen Blickrichtungen wahrzunehmen. Neben einer eher beschreibenden und quantitativ orientierten [/S. 459:] Berufsforschung sollte auch eine gestaltende, kreativ orientierte Berufsforschung betrieben werden, die bisherige und erwartbare Veränderungen beschreibt und zugleich neue Strukturierungshilfen erarbeitet und ihre Anwendung fördert.
Arimond, H. (1959): Vom Zweck der Berufskunde. In: V. Siebrecht: Handbuch der Arbeitsvermittlung und Berufsberatung, Band 2. München, S. 201-206.
Baethge, M./ Baethge-Kinsky, V. (1998): Jenseits von Beruf und Beruflichkeit? Neue Formen von Arbeitsorganisation und Beschäftigung und ihre Bedeutung für eine zentrale Kategorie gesellschaftlicher Integration. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Jg. 31, H. 3, S. 461-472.
Beck, K./ Krumm, V. (1994): Wirtschaftskundlicher Bildungstest (WBT). In: Testkatalog 1994/95. Göttingen.
Beck, U./ Brater, M./ Tramsen, E. (1975): Beruf, Herrschaft und Identität - ein subjektbezogener Ansatz zum Verhältnis von Bildung und Produktion. Unveröffentlichtes Manuskript des SFB 101,Teilprojekt A 1, München.
Blankertz, H. (1975): Deutsche Bildungstheorie und vorindustrielles Berufsverständnis; "Berufspädagogik". Neue wissenschaftliche Bibliothek Band 82.
Blaschke, D./ Plath, H.-E. (1994): "Beruf" und "berufliche Verweisbarkeit". In: MittAB 4, S. 300-322.
Büschges, G. (1975): Beruf, Berufswahl und Berufsberatung. In: Lange, E./ Büschges, G.: Aspekte der Berufswahl in der modernen Gesellschaft. Frankfurt/M.
Bußhoff, L. (1984): Berufswahl. Schriftenreihe Siebrecht-Kohl. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer.
Chaberny, A./ Fenger, H./ Reiter, A. (1972): Tätigkeitsschwerpunkt als Strukturmerkmal in der Erwerbsstatistik. In: MittAB 3, S. 230-257.
Chaberny, A./ Parmentier, K./ Schnur, P. (1981): Berufsspezifische Strukturdaten - Ergänzungen zum ABC-Handbuch. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (BeitrAB) 60. Nürnberg.
Crusius, R./ Wilke, M. (1979): Plädoyer für den Beruf. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B48, S. 3-13.
Dostal, W. (1983): Bildung und Beschäftigung im technischen Wandel. BeitrAB 65, Nürnberg.
Dostal, W. (1988): Der Informationsbereich. In: D. Mertens (Hrsg.): Konzepte der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. BeitrAB 70, 3. erweiterte und überarbeitete Auflage. Nürnberg, S. 858 - 882.
Dostal, W. (1989): Arbeitsmarktwirkungen moderner Technologien. Neue Erkenntnisse aus der Meta-Studie? In: MittAB 2, S. 187-201.
Dostal, W. (1993): Expertensysteme und Beschäftigung. In: MittAB 1, S. 63-77.
Dostal, W. (1995a): Die Informatisierung der Arbeitswelt: Multimedia, offene Arbeitsformen und Telearbeit. In: MittAB 28, S. 527-543.
Dostal, W. (1995b): Berufsbilder in der Informatik. In: Informatik-Spektrum 18, S. 152-162.
Dostal, W./ Parmentier, K./ Schade, H.-J. (1999): Möglichkeiten und Grenzen der quantitativen Berufsforschung im IAB - eine Bestandsaufnahme. (erscheint in MittAB 1/1999)
Dunkmann, H. (1922): Die Lehre vom Beruf. Berlin, S. 204-206.
Emnid (1997): Jugend und Beruf: Am liebsten Unternehmer. In: iwd 17, S. 8.
Fenger, H. (1968): Arbeitsmarktforschung, Berufsforschung, Bildungsforschung: Versuch zur Bestimmung von Schwerpunkten, Abgrenzungen und Überschneidungsbereichen. In: MittAB 5, S. 325-335.
Frieling, E. (1980): Verfahren und Nutzen der Klassifikation von Berufen. München.
Frieling, E./ Graf Hoyos, C. (1978): Fragebogen zur Arbeitsanalyse (FAA). Bern, Stuttgart, Wien.
Giarini, O./ Liedtke, P.M. (1998): Wie wir arbeiten werden. Der neue Bericht an den Club of Rome. Hamburg.
Hartmann, H. (1972): Arbeit, Beruf, Profession. In: Luckmann, Th./ Sprondel, W. M. (Hrsg.): "Berufssoziologie". Neue Wissenschaftliche Bibliothek, Band 55: Soziologie. Köln.
Henninges, v. H./ Stooß, F./ Troll, L. (1976): Berufsforschung im IAB - Versuch einer Standortbestimmung. In: MittAB 1, S. 1-18.
Hesse, H. A. (1970): Der Einzelne und sein Beruf: Die Auslegung des Art. 12 Abs. 1 GG durch das Bundesverfassungsgericht aus soziologischer Sicht. In: Archiv des öffentlichen Rechts, 95. Band. Tübingen: Siebeck, S. 449 ff.
Hesse, H. A. (1972): Berufe im Wandel. 2, überarbeitete Auflage. Stuttgart.
Heidegger, G./ Rauner, F. (1997): Reformbedarf in der beruflichen Bildung. In: Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), pro Ausbildung - Gutachten. Düsseldorf, S. 7-45.
Hofbauer, H./ König, P. (1973): Berufswechsel bei männlichen Erwerbspersonen in der Bundesrepublik Deutschland. In: MittAB 6, S. 37-66.
Hoffmann, E./ Walwei, U. (1998): Normalarbeitsverhältnis: ein Auslaufmodell? Überlegungen zu einem Erklärungsmodell für den Wandel der Beschäftigungsformen. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Jg. 31, H. 3, S. 409-425.
Huth, A. (1961): Beruf und Seele, 1. Auflage. München: Ehrenwirth. Diesem Werk sind auch die Zitate von Fischer, A. und Arnold, W. entnommen.
Klassifizierung der Berufe (1975): Systematisches und alphabetisches Verzeichnis der Berufsbenennungen. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.
Klassifizierung der Berufe (1988): Systematisches und alphabetisches Verzeichnis der Berufsbenennungen. Gliederung nach Berufsklassen für die Statistik der Bundesanstalt für Arbeit. (Nach dem Stand vom 1. September 1988 überarbeitete Fassung der Berufsklassen mit Zuordnung der Berufsbenennungen zu Berufsklassen für die Statistik der Bundesanstalt für Arbeit). Nürnberg: Bundesanstalt für Arbeit 1988 (frühere Ausgaben 1961, 1970, 1975, 1980).
Kosta, J./ Krings, I./ Lutz, B. (1970): Probleme der Klassifikation von Erwerbstätigen und Tätigkeiten. In: Gutachten des ISF. München (hektographiertes Manuskript).
Lahner, M./ Ulrich, E. (1969): Analyse von Entwicklungsphasen technischer Neuerungen. In: MittAB 6, S. 417-446.
Maier, H. (1996): Der Bildungswert des Berufs. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 280, 30. Nov. 1996.
Marx, K./ Engels, F. (1978): Die deutsche Ideologie. In: Dies.:Werke, Band 3. Berlin.
Mertens, D. (1968): Empirische Grundlagen für die Analyse der beruflichen Flexibilität. In: MittAB 5, S. 336-344.
Mertens, D. (1969): "Berufsprognosen": Realisierung und Modifikationen. In: MittAB 6, S. 5-16.
Molle, F. (1968): Definitionsfragen in der Berufsforschung, dargestellt am Beispiel der Begriffe Beruf und Berufswechsel. In: MittAB 3, S. 148-159.
Molle, F. (1968): Handbuch der Berufskunde. Köln, Berlin, Bonn, München.
Molle, F. (Hrsg.) (1951): Wörterbuch der Berufsbezeichnungen. Gross-Denkte über Wolfenbüttel: Verlag Wörterbuch der Berufsbezeichnungen.
Nietzsche, F. (1930): Morgenröte, Werke, Ausgabe Bäumler. Leipzig.
Parmentier, K./ Stooß, F./ Troll, L. (1992): Ostdeutsche Berufsstrukturen unterscheiden sich nicht grundlegend von denen im Westen der Bundesrepublik. IABkurzbericht Nr. 11. Nürnberg.
[/S. 460:]
Parmentier, K./ Plicht, H./ Stooß, F./ Troll, L. (1993b): Berufs- und Erwerbsstrukturen West- und Ostdeutschlands im Vergleich - Ergebnisse aus der BIBB/IAB-Erhebung 1991/92. In: BeitrAB 176. Nürnberg.
Paul-Kohlhoff, A. (1998): Das Berufsprinzip als Grundlage der beruflichen Ausbildung: ein Stück deutscher Geschichte? In: DGB, DAG sfs (Hrsg.): Ist der Beruf noch zu retten? Dokumentation einer Veranstaltung am 12. Mai. Dortmund: Dokumentation.
Reichwald, R./ Möslein, K./ Sachenbacher, H./ Englberger, H./ Oldenburg, S. (1998): Telekooperation. Verteilte Arbeits- und Organisationsstrukturen. Berlin u. a.
Sacherl, K. (1954): Berufsmensch und Privatmensch. Göttingen.
Scharmann, Th. (1956): Arbeit und Beruf. Tübingen.
Schelsky, H. (1965): Die Bedeutung des Berufs in der modernen Gesellschaft. In: Schelsky, H. (Hrsg.): Auf der Suche nach der Wirklichkeit. Düsseldorf.
Schleiermacher, F. (1913): Ausgewählte Werke von Otto Braun. Leipzig.
Schneider, J. in Zusammenarbeit mit Bauschke, H.-J./ Egle, F./ Ertelt, B.-J./ Flachowsky, G. (1990): Der Beruf - ein vielschichtiges Gebilde. Berufskunde im Spannungsfeld der Wissenschaften. Bundesanstalt für Arbeit: Handreichungen für die Aus- und Fortbildung. Nürnberg.
Seifert, M./ Pawlowsky, P. (1998): Innerbetriebliches Vertrauen als Verbreitungsgrenze atypischer Beschäftigungsformen. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Jg. 31, H. 3, S. 599-611.
Statistisches Bundesamt Wiesbaden (Hrsg.) (1961): Klassifizierung der Berufe - Ausgabe 1961. Stuttgart und Mainz.
Stooß F. (1977): Die Systematik der Berufe und der beruflichen Tätigkeiten. In: Seifert, K.H., (Hrsg): Handbuch der Berufspsychologie, S. 69-98.
Stooß, F. (1979): Beruf und Berufsbild. In: Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.): Handbuch zur Berufswahlvorbereitung. Ausgabe 1979, S. 169-178.
Stooß, F. (1980): Zur Analyse beruflichen Wandels - Überblick zum Stand der Überlegungen. In: Bohl, K./ Stooß, F./ Troll, L.: Berufs und Tätigkeitsinhalte im Wandel. BeitrAB 12. Nürnberg, S. 167-170.
Stooß , F. (1984): Nach der Berufsgesellschaft. Clemens Hemming blickt zurück. In: MittAB 1, S. 48-51.
Stooß , F. (1985): Verliert der "Beruf" seine Leitfunktion für die Integration der Jugend in die Gesellschaft? In: MittAB 2, S. 198-208.
Stooß , F. (1990): Exkurs zur Prognosefähigkeit beruflicher Systematiken. In: MittAB 1, S. 52-62.
Stooß , F. (1992): Beruf. In: Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.): Handbuch zur Berufswahlvorbereitung. Ausgabe 1992. Nürnberg, S. 251-265.
Stooß, F./ Stothfang, E. (1985): Berufskunde. Stuttgart.
Thome, R. (1997): Arbeit ohne Zukunft ? Organisatorische Konsequenz der wirtschaftlichen Informationsverarbeitung. München.
Treiman, D.J. (1979): Probleme der Begriffsbildung und Operationalisierung in der international vergleichenden Mobilitätsforschung. In: Pappi, F.U. (Hrsg.): Sozialstrukturananlysen mit Umfragedaten. Königstein.
Troll, L. (1981): Unschärfen bei der Erfassung des ausgeübten Berufs und Ansätze zur Verbesserung statistischer Nachweise. In: MittAB 2, S. 163-179.
Ulich, E. (1991): Arbeitspsychologie Zürich: Verlag der Fachvereine.
Ulrich, E./ Lahner, M. (1970): Zur Prognose "neuer Berufe". In: MittAB 1, S. 33-44.
Voigt, W. (1975): Einführung in die Berufs- und Wirtschaftspädagogik. München.
Voß, G. (1994): Berufssoziologie. Rohwohlts Enzyklopädie. Reinbek bei Hamburg, S. 132.
Wallendy, P. (1949): Zwille wille wick. Ein fröhliches Buch der Arbeit für unser Kind, mit Reimen, Märlein und Liedern dem Volksmund entnommen. Stuttgart.
In: Wissenschaftliche Begleitung des Programms "Schule - Wirtschaft/Arbeitsleben" (Hrsg.): "Schule - Wirtschaft/Arbeitsleben". Dokumentation 2. Fachtagung Bielefeld 30.05.2001 - 31.05.2001. SWA-Materialien Nr. 7, Bielefeld 2001, S. 7 - 38.
[/S. 7:] Meine sehr verehrten Damen und Herren, "Berufsorientierung im Wandel - Vorbereitung auf eine veränderte Arbeitswelt" mit diesem Thema wollen wir uns an diesen zwei Tagen befassen. Ich bin der Einladung, hierzu eine Einführung zu geben, gerne nachgekommen - nicht nur als Vertreterin der Bundesanstalt für Arbeit [1], zu deren gesetzlich definierten Aufgaben die Berufsberatung und Berufsorientierung junger Menschen gehört und die dazu das wohl umfassendste Angebot an Veranstaltungen und Medien in Deutschland bereitstellt, sondern auch weil ich über lange Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB) [9] über die Veränderungen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes und deren Auswirkungen auf das Berufswahlverhalten Jugendlicher geforscht habe.
Lassen Sie mich vorweg noch etwas zur Begrifflichkeit sagen. Wir haben es in den letzten Jahren mit einer Inflation immer neuer und kreativer Worte zu tun, die das Handlungsfeld beschreiben. Diese reichen von dem etwas altertümlichen Wort "Berufsaufklärung" aus den 20er Jahren über den weit verbreiteten und in der Bundesanstalt für Arbeit üblicherweise verwendeten Begriff "Berufsorientierung" bis hin zu "Berufswahlvorbereitung", "Berufswahlorientierung", "Berufsfrühorientierung", "Arbeitsweltorientierung", "Job- und Karriereorientierung" usw. Diese Begriffsvielfalt und -unschärfe signalisiert die Desorientierung, in der sich die professionellen "Orientierer" befinden, und deutet den Paradigmenwechsel an, in dem sich die Berufsorientierung derzeit befindet. Ist es wirklich der "Beruf" in seiner klassischen Bedeutung, auf den wir junge Menschen heutzutage vorbereiten sollten oder benötigen wir auch in der Berufsorientierung ein neues "Leitbild" erwerbswirtschaftlicher Arbeit?
[/S. 8:] Das Thema Berufsorientierung hat seit einigen Jahren wieder einmal Konjunktur - Konjunktur deswegen, weil allenthalben Defizite in dem derzeitigen Stand der Berufswahlvorbereitung junger Menschen ausgemacht werden. Insbesondere Betriebe beklagen das häufig unzureichende Informationsniveau der Bewerberinnen und Bewerber über die Berufe und deren Anforderungen. Ausbildungsabbrüche oder -wechsel seien die häufige Folge dessen, dass Jugendliche sich falsche Vorstellungen von dem gewählten Beruf machten. Vielfach werden die angeblich unrealistischen beruflichen Vorstellungen vieler Jugendlicher und deren Fixierung auf wenige, meist überlaufene "Mode- oder Traumberufe" kritisiert und diese als Grund für "mis-match" auf dem Ausbildungsmarkt - Bewerbermangel auf der einen, Lehrstellenmangel auf der anderen Seite - angesehen.
Noch ein weiterer Aspekt veranlasst insbesondere Vertreter der Wirtschaft, sich in dem Handlungsfeld Berufsorientierung verstärkt zu engagieren: Da ist zum einen der angesichts der demografischen Entwicklung zu befürchtende Fachkräftemangel. Jugend wird zur Mangelware - fatal in einer Volkwirtschaft, deren wichtigstes Kapital das Humankapital ist. Aber nicht nur das quantitative Problem drückt die Unternehmen, sondern mehr noch ein qualitatives: Es mangelt Jugendlichen heutzutage ihrer Einschätzung nach an unternehmerischem Denken, an Eigeninitiative, Verantwortungsbereitschaft und Risikofreudigkeit, aber auch an grundlegenden ökonomischen Kenntnissen - Eigenschaften und Fähigkeiten, die in der künftigen Arbeitswelt mehr denn je gefragt sein werden. Und auch deshalb engagieren sie sich neuerdings in Schulprojekten, Schulpatenschaften und dergleichen, um auf diesem Wege die Belange der Wirtschaft und mehr betriebliche Praxis in die Berufswahlvorbereitung der Schulen einzubringen - bis hin zu den jüngsten Forderungen nach der Einrichtung eines eigenen Schulfachs "Ökonomische Bildung". Dahinter steht aber auch die Skepsis gegenüber Lehrern, die Arbeitslehre und Berufswahlvorbereitung unterrichten sollen, obwohl sie die betriebliche Realität nie kennen gelernt haben. Raus aus der Schule und hinein in die Betriebe lautet daher eine der wichtigsten Forderungen nach neuen Wegen in der Berufsorientierung.
Kritik und Probleme gibt es nicht nur an der praxis- und betriebsfernen Berufswahlvorbereitung in der Sekundarstufe I und für Schüler, die für eine duale Berufsausbildung in Frage kommen, sondern auch bezogen auf die Berufs- und Studienvorbereitung der Gymnasiasten und Abiturienten. So wird u. a. die angebliche Technikfeindlichkeit der Schule und der Berufsberatung mit dafür verantwortlich gemacht, dass sich nach wie vor nur vergleichsweise wenige Abiturienten für ein ingenieur- oder naturwissenschaftliches Studium entscheiden.
[/S. 9:] Aber auch die Politik sorgt sich um den Bildungs- und Wirtschaftsstandort Deutschland und befürchtet Nachwuchsmangel in den naturwissenschaftlich-technischen und High-Tech-Berufen. Das Programm "Schule-Wirtschaft-Arbeitsleben" [10] ist eine Antwort darauf: Durch eine Verbesserung und Intensivierung der Berufsorientierung sollen die Voraussetzungen für fundiertere, rationale und vor allem marktgerechtere Berufsentscheidungen der Jugendlichen geschaffen werden.
Nicht zuletzt fühlen sich auch viele Jugendliche unzureichend auf die Berufswahl vorbereitet; manche - und davon können Berufsberater/ -innen ein Lied singen - haben überhaupt noch keine Vorstellung, wohin die Reise denn gehen soll. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes "orientierungslos" in Bezug auf ihre Berufs- und Lebensplanung und machen die aus ihrer Perspektive ohnehin unsicheren Zukunftsperspektiven dafür verantwortlich. Andere beklagen, dass niemand ihnen sagen könne, welche Berufe "Zukunft haben". Und schließlich sei es sowieso egal, welchen Beruf man erlerne, da in Zukunft ohnehin jeder mindestens 3mal im Leben seinen Beruf wechseln müsse. Manche lassen sich einfach treiben, schieben die Berufsentscheidung noch hinaus, gehen erst einmal weiter zur Schule oder jobben. Andere überlassen es dem Zufall und nehmen die erst beste Lehrstelle, die sie bekommen können; wieder andere können sich überhaupt nicht entscheiden und zögern zu lange, bis Termine verstrichen oder Ausbildungsplätze anderweitig besetzt sind. Ausbildungs- und Berufsentscheidungen werden so nicht selten zum Lotteriespiel - zumal trotz verbesserter Lehrstellensituation noch lange nicht jeder Berufswunsch erfüllbar ist.
Nun liegt dies alles ja nicht daran, dass es zu wenig Angebote zur Berufsorientierung gäbe - im Gegenteil: Noch nie in der Geschichte gab es so vielfältige, zahlreiche, umfassende und - so glaube ich sagen zu können - auch qualitativ gute Angebote wie gegenwärtig - sowohl seitens der Berufsberatung und der Schulen, aber auch aus der Wirtschaft, der Jugendhilfe und vieler, vieler anderer Institutionen bis hin zu dem vermehrten Angebot privater Anbieter (Banken, Versicherungen). Die Fülle scheint eher das Problem zu sein. Die Informationsflut überfordert die Jugendlichen und ihre Eltern in einer an Informations- und Medienreizen nicht gerade armen Welt und erreicht sie deswegen häufig nicht. Es bedarf also dringend einer Strukturierung, Koordinierung und Transparenz der Angebote, einer verbesserten Kooperation der Hauptakteure, die dazu auch gesetzlich berufen sind. Außerdem bedarf es angesichts der sehr unterschiedlichen inhaltlichen Qualität auch einer Bewertung der Angebote, um Jugendlichen bei der Auswahl geeigneter und seriöser Angebote zu helfen, denn nicht jedes jugendlich-modern daherkommende Angebot ist auch seriös, objektiv, neutral und inhaltlich richtig.
[/S. 10:] Berücksichtigen sollte man allerdings auch, dass angesichts der zunehmenden Komplexität und Unübersichtlichkeit der Bildungs- und Ausbildungswege und des raschen Wandels in der Arbeitswelt die persönliche Orientierung und Entscheidung immer schwieriger wird und noch mehr und noch bessere Orientierungsangebote dabei auch nicht immer hilfreich sind, sondern eher eine zusätzliche Belastung darstellen. Wenn man als junger Mensch erst zahlreiche aufwändige Berufsorientierungsmaßnahmen durchlaufen muss, sie vielleicht gar noch zertifizieren lassen muss, um reif für die Ausbildungs- und Berufswahl zu sein, sollte man doch vielleicht darüber nachdenken, das Ausbildungs- und Erwerbssystem transparenter und leichter zugänglich zu gestalten. Schließlich soll Berufswahl und die Vorbereitung darauf auch Spaß machen.
Die gegenwärtige Kritik an der Praxis der Berufsorientierung hat dennoch ihr Gutes: Berufsorientierung wird nämlich plötzlich auch aus ökonomischer Perspektive wichtig und dies fördert die Bereitschaft, darin zu investieren und Ressourcen für Berufsorientierung bereitzustellen. Diese Chance sollten alle Beteiligten nutzen - nutzen, um neue innovative Wege zu gehen und besser als bisher miteinander zu kooperieren, nicht um mit neuem Geld das Rad immer wieder neu zu erfinden. Ich sage dies mit Blick auf die vielfältigen Angebote zur Berufsorientierung, die in den vergangenen 30 Jahren von den Berufsberaterinnen und Berufsberatern, Lehrerinnen und Lehrern schon entwickelt und umgesetzt wurden.
Berufsorientierung gibt es in Deutschland schon seit geraumer Zeit als schulisches und außerschulisches Angebot. Beide haben ihre je spezifische Entwicklung genommen, die ihre Ziele und ihr Selbstverständnis prägen und ihre Fähigkeit zur Weiterentwicklung und Öffnung für neue Formen, Inhalte und Kooperationen mit bestimmen. In einem kurzen Überblick über die bisherige Entwicklung will ich dies verdeutlichen.
- Schulische Berufswahlvorbereitung -
"Non scholae sed vitae" war schon immer das Motto, unter dem Schule antrat, junge Menschen auf das Leben nach der Schule vorzubereiten. Vor rund 100 [/S. 11:] Jahren bis in die 50er und 60er Jahre hinein beinhaltete dies jedoch für einen nicht unbeträchtlichen Teil der Schülerschaft, insbesondere die jungen Frauen und die künftige ungelernte Arbeiterschaft eine Vorbereitung auf Lebensbereiche außerhalb bezahlter Erwerbsarbeit. Schule hatte für die niedrigeren Sozialschichten vor allem auch die Funktion, sie als künftige Staatsbürger, als Hausfrauen und Mütter oder als sonstwie nützliche Mitglieder der Gesellschaft heranzubilden. Berufsvorbereitung oder gar Berufswahlvorbereitung war in einer traditionell und noch weitgehend ständisch organisierten Gesellschaft nicht vonnöten. Was später bei der Arbeit gebraucht wurde, wurde entweder unmittelbar "on the job", wie wir heute sagen, erlernt oder für einen kleineren Teil der nachwachsenden Generation in einer formalisierten, zunftmäßig organisierten Berufsausbildung, der sog. "Meisterlehre" gelehrt.
Die dazu erforderlichen Grundvoraussetzungen, die die Schule zu liefern hatte, beschränkten sich auf die bekannten grundlegenden Kulturtechniken - von frühen reformpädagogischen Ansätzen, z. B. Kerschensteiners "Arbeitsschule" einmal abgesehen (Kahsnitz 1997). Doch auch hier ging es in erster Linie um "Arbeitstugenden" und Anpassung an vorgegebene Arbeitsstrukturen, nicht um kritisches Reflektieren oder gar Berufswahlkompetenz. Auch im Bereich der sog. "höheren" Bildung diente Schule im Sinne des Humboldt'schen Bildungsideals vor allem der Persönlichkeitsbildung, der sittlichen Bildung und der Hinführung zur Humanität. Daneben bereitete sie vorrangig auf ein Universitätsstudium und wissenschaftliches Arbeiten vor, nicht aber auf Beruf und Arbeitsleben.
Dieses Aufgabenverständnis von Schule hinsichtlich der Vorbereitung auf Beruf und Arbeit änderte sich mit fortschreitender ökonomisch-technologischer Entwicklung, der weiteren Ausdifferenzierung von Tätigkeitsfeldern und mit den steigenden Anforderungen sowohl in der industriellen Produktion als auch in den Dienstleistungen. Nun wurde auch von der Schule gefordert, dass sie Jugendliche konkreter als bisher auf die Berufs- und Arbeitswelt und den Eintritt ins Berufsleben vorbereitet. In Westdeutschland waren die Empfehlungen des Deutschen Ausschusses für das Erziehungswesen von 1964 der entscheidende Anstoß für die sukzessive Einrichtung und curriculare Verankerung des Faches Arbeitslehre in den einzelnen Bundesländern. Der Akzent lag damals noch nicht so sehr auf der konkreten Berufswahlvorbereitung als vielmehr auf grundlegenden Kenntnissen über die Arbeitswelt verbunden mit einer emanzipatorisch-kritischen Ausrichtung gegenüber den Anforderungen der Arbeitswelt an das Individuum. In der DDR begann die Entwicklung bereits früher mit der Einführung des polytechnischen Unterrichts für alle Schüler - unabhängig von der [/S. 12:] Schulart -, um junge Menschen sehr konkret auf die Anforderungen und Bedarfslagen der sozialistischen Produktion vorzubereiten (Kahsnitz 1997).
Seither hat ein kontinuierlicher Ausbau der schulischen Berufswahlvorbereitung in Deutschland stattgefunden, u. a. durch stundenmäßige Ausweitung in den dafür speziell vorgesehenen Fächern (Arbeitslehre u. a.), durch die verpflichtende Einführung von Schülerbetriebspraktika, deren schulischer Vor- und Nachbereitung, durch die curriculare Einbindung der Berufswahlvorbereitung auch in andere Schulfächer oder durch fächerübergreifenden Unterricht (KMK 1997). Zu einer Intensivierung und Verstetigung berufswahlvorbereitender Angebote an Schulen haben auch die Vereinbarungen zwischen der Kultusministerkonfrenz (KMK) [11] und der Bundesanstalt für Arbeit (BA) [12] von 1971 über die Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung (1) und zwischen der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) [13], der KMK und der BA von 1992 über die Zusammenarbeit in der Sekundarstufe II (2) bzw. die entsprechenden aktuellen Vereinbarungen auf Landesebene (3) beigetragen. Darin wurden (und werden) die Aufgaben der jeweiligen Partner in der Berufswahlvorbereitung (Schule, Berufsberatung, Studienberatung, Wirtschaft) beschrieben und die Beteiligung der Berufsberatung der Arbeitsämter (bzw. der Studienberatungen der Hochschulen) im Rahmen der schulischen Angebote sowie gemeinsame Aktivitäten geregelt. Ein Blick auf die wesentlichen Inhalte der Rahmenvereinbarung von 1971 (Abbildung 1) zeigt, dass diese bereits damals sehr modern und offen konzipiert waren, insbesondere für kooperative Strukturen und mögliche Weiterentwicklungen. Dem ist auch aus heutiger Sicht eigentlich nichts hinzuzufügen. Die in der Rahmenvereinbarung eröffneten Optionen wurden freilich von der Praxis nicht immer genutzt.
In der jüngsten Vergangenheit kamen neue Impulse in die schulische Berufswahlvorbereitung durch die Öffnung der Schulen in Richtung Wirtschaft und umgekehrt und die dadurch entstandenen kooperativen Berufswahlprojekte sowie andere Formen der Zusammenarbeit mit Betrieben, über die wir auf dieser Fachtagung ja noch mehr hören werden.
Berufsorientierung in der Schule hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten von einem Unterricht über die Arbeitswelt weiterentwickelt hin zu einem Unterrichtsangebot, das darüber hinaus auch den einzelnen Jugendlichen bei seiner individuellen Berufswahl unterstützen soll. Schule übernimmt damit - zumindest [/S. 13:] in dem Bereich der Sekundarstufe I - zunehmend Verantwortung für die Berufswahlvorbereitung und für die berufliche Integration ihrer Schülerinnen und Schüler.
- Außerschulische Berufswahlvorbereitung -
Früher als die schulischen Angebote entwickelten sich außerschulische Maßnahmen zur Berufswahlvorbereitung, und zwar im Zuge der ersten Schritte hin zur Etablierung einer öffentlichen Berufsberatung. Im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert wurde Berufsberatung interessanterweise durch die damalige Frauenbewegung befördert und in den Auskunftsstellen für Frauenberufe erstmals angeboten und institutionell verankert (Meyer-Haupt 1995). Parallel dazu begannen Handwerkskammern und Innungen mit der Einrichtung von Lehrstellennachweisen für das Handwerk, um die Gewinnung ihres Berufsnachwuchses zu sichern. Etwa um die gleiche Zeit boten vereinzelt auch Gewerkschaftsvereine, caritative Verbände und Träger der Jugendfürsorge für ihre jeweilige Klientel Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung an.
Mit dem Ende des 1. Weltkrieges und der damals herrschenden wirtschaftlichen Not und Arbeitslosigkeit begann die Einrichtung öffentlicher Ämter für Arbeitsnachweise in Verantwortung der Kommunen, die im Arbeitsnachweisgesetz (ANG) von 1922 ihre rechtliche Grundlage fanden. Mit der in diesem Gesetz geregelten Einrichtung einer öffentlichen Berufsberatung und deren Zuordnung zu den Arbeitsnachweisämtern begann der Ausbau der öffentlichen Berufsberatung in Deutschland, deren Aufgabenstellung damit erstmals in den Allgemeinen Bestimmungen über die Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung bei den öffentlichen Arbeitsnachweisämtern vom Reichsamt für Arbeitsvermittlung gesetzlich geregelt wurde. Im Jahre 1927, mit Inkrafttreten des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (AVAVG) und der Errichtung der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung wurden öffentliche Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung Pflichtaufgabe der Arbeitsämter. Gleichzeitig wurde gewerbsmäßige Berufsberatung verboten (Meyer-Haupt 1995).
Bereits seit den 20er Jahren gehörten Maßnahmen zur Berufsorientierung - damals nannte man dies "Berufsaufklärung" - zum Berufsberatungsangebot der Arbeitsämter; gesetzlich verankert wurde "Berufsaufklärung" jedoch erst 1957 im AVAVG (§45) als wichtige Voraussetzung für die berufliche Beratung. Als gleichrangige Pflichtaufgabe der Arbeitsämter wurde sie schließlich im [/S. 14:] Arbeitsförderungsgesetz (AFG) von 1969 festgeschrieben, das das AVAVG ablöste (§§ 31-32 AFG) (Wanders, Schneider 2001). Dort wurde auch die Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung, den für die Berufsausbildung zuständigen Stellen, den Einrichtungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie mit den Trägern der Sozial-, Jugend- und Gesundheitshilfe begründet. Seit Anfang der siebziger Jahre wurden mit all diesen Einrichtungen entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen, die i. d. R. auch heute noch Gültigkeit haben. Diese Vereinbarungen bilden die Basis und den Rahmen für die Beteiligung der Berufsberatung der Arbeitsämter an der kooperativen Berufswahlvorbereitung in der Schule im Zusammenwirken der verschiedenen Träger und Anbieter (siehe oben).
Seither hat sich die Berufsorientierung als Aufgabe der Berufsberatung der Arbeitsämter [1] inhaltlich und organisatorisch kontinuierlich weiterentwickelt und wurde zu einem flächendeckenden Angebot innerhalb und außerhalb der Schule ausgebaut. Abbildung 2 gibt einen Überblick über die berufsorientierenden Angebote der Arbeitsämter in Kooperation mit und in Ergänzung zu dem schulischen Angebot. Das Dritte Sozialgesetzbuch (SGB III), das seit 1998 die Aufgaben der Arbeitsförderung einschließlich der Berufsberatung regelt, hat den gesetzlichen Auftrag der Arbeitsämter zur Berufsorientierung noch einmal verstärkt und um weitere Zielgruppen, z. B. Arbeitgeber, erweitert.
Ausschlaggebend für die Übertragung der Aufgabe zur Berufsorientierung und Berufsberatung auf die Bundesanstalt für Arbeit war die Nähe der Arbeitsämter zu Wirtschaft und Betrieben und deren know how über den Arbeitskräfte- und Qualifikationsbedarf der Wirtschaft. Dies wurde auch als ein entscheidender Vorteil für eine an den Bedürfnissen und Möglichkeiten des Arbeitsmarktes orientierte Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung für jugendliche Berufswähler angesehen (vgl. dazu die sog. Troisdorfer Beschlüsse, 1968). Die konzeptionelle Entwicklung der Berufsorientierung in der BA geht einher mit der Entwicklung der Berufsberatung von einer früher primär auf die Lehrstellenvermittlung hin ausgerichteten Aktivität hin zu einem umfassenden Angebotskonzept zur optimalen Unterstützung des individuellen Berufswahlprozesses, in dessen Verlauf unterschiedliche Maßnahmen und Angebote zum Tragen kommen bzw. abgerufen werden können: Vorträge, Seminare, Medien zur Selbstinformation und Selbsterkundung, individuelle Beratung, Ausbildungs- und Arbeitsmarktinformation, Bewerbungstrainings, Lehrstellenvermittlung, Förderungs- und Qualifizierungsangebote. Anstelle eines starren Angebots- und Ablaufschemas sollen die berufsorientierenden Maßnahmen des Arbeitsamtes flexibel auf die Bedarfslagen der Jugendlichen und unserer Kooperationspartner (Schulen, Betriebe, Einrichtungen der Jugendhilfe usw.) reagieren und eingesetzt werden (BA 1999). [/S. 15:] Dabei misst die BA kooperativen Strukturen in der Berufsorientierung, insbesondere der Zusammenarbeit mit Schulen, Lehrkräften, Betrieben und Ausbildern einen hohen Stellenwert bei (Strijewski 2001).
Neben der Schule und den Arbeitsämtern gehören Maßnahmen zur Verbesserung der Chancen auf berufliche Eingliederung und Teilhabe an der Erwerbsarbeit auch zu den Aufgaben der Jugendhilfe. Nicht erst seit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfe-Gesetzes (KJHG) haben die Träger der öffentlichen und der freien Jugendhilfe die von ihnen betreute Klientel auf die Berufswahl und Ausbildungsplatzsuche vorbereitet - also Berufsorientierung betrieben. Die Berufsorientierungsangebote der Jugendhilfe konzentrieren sich auf jene Jugendlichen, die aus unterschiedlichen Gründen besondere Probleme beim Berufsstart haben. Die Maßnahmen sind in der Regel sozialpädagogisch orientiert und arbeiten ganzheitlicher als dies in den eher punktuellen Angeboten der Schule und der Berufsberatung möglich ist. Mit dem Programm des Bundesjugendministeriums [14] "Arbeitsweltorientierte Jugendsozialarbeit" wurden und werden zahlreiche berufsvorbereitende Projekte gefördert, die auch in der Berufsorientierung benachteiligter junger Menschen innovative Wege gehen (Braun u. a. 1997). Sie haben damit vielfach auch Vorbildcharakter für andere Maßnahmen und Projekte zur Berufsorientierung.
Ich habe die verschiedenen Entwicklungslinien der Entstehung und institutionellen Einbettung der Berufsorientierung im Rahmen von Schule, Berufsberatung, Jugendhilfe und Wirtschaft hier etwas ausführlicher dargestellt, um deutlich zu machen, dass es auf diesem Gebiet kein Primat irgendeiner Institution gibt, sondern dass wir heute an einem Punkt angekommen sind, wo die getrennten Entwicklungslinien zusammenlaufen (müssen) und sich die Hauptakteure ihrer gemeinsamen Verantwortung in diesem Handlungsfeld bewusst werden (müssen). Kooperation nicht Konkurrenz ist das Gebot der Stunde!
Die Veränderung der Arbeitswelt lässt sich anhand folgender dominanter Trends beschreiben
(Abbildung 3):
- Zu 1.: Informatisierung und Übergang zur wissensbasierten Gesellschaft -
Wirtschaft und Gesellschaft befinden sich auf dem Weg von der Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft in die Wissens- und Informationsgesellschaft. Augenfällig wird das an der Veränderung der Erwerbstätigenanteile in einem "Vier-Sektoren-Modell", das die Erwerbstätigen nicht nach ihrer Zugehörigkeit zu den traditionellen Wirtschaftssektoren zuordnet, sondern nach ihrer dort vorrangig ausgeübten Tätigkeit. Danach üben bereits jetzt über 50 % der Erwerbstätigen Informationstätigkeiten aus, während nur noch jeweils ein Fünftel bis ein Viertel Produktions- oder Dienstleistungstätigkeiten verrichten (Abbildung 4). Während der Anteil der Produktionstätigkeiten noch weiter schrumpfen wird, werden künftig noch mehr Erwerbstätige Dienstleistungen und Informationsleistungen erbringen.
Sichtbares Zeichen der Informatisierung ist die allgegenwärtige Nutzung von programmgesteuerten Arbeitsmitteln an ganz unterschiedlichen Arbeitsplätzen und in fast allen Berufen - seien es PC und Internet, seien es programmgesteuerte Werkzeugmaschinen oder Prüf- und Messgeräte. Zwischen 1992 und 1999 hat sich die Nutzung computergesteuerter Arbeitsmittel fast verdoppelt (von 36 % der Erwerbstätigen auf 62 %; Abbildung 5) mit besonders hohen Anteilen in technischen, Planungs- und Laborberufen sowie in Verwaltungs- und Büroberufen oder in kaufmännischen Berufen und personenbezogenen Dienstleistungen. Auch in bestimmten Produktionsberufen arbeiten fast 60 % mit programmgesteuerten Arbeitsmitteln (Troll 2000).
- Zu 2.: Globalisierung der Wirtschaft und der Arbeitsmärkte -
Die Globalisierung verändert die Arbeitswelt zunächst für Menschen, die unmittelbar auf internationaler Ebene zusammenarbeiten - etwa durch erhöhte Anforderungen an berufliche Mobilität, an Fremdsprachenkenntnisse und [/S. 17:] sonstige interkulturelle Kompetenzen. Sie verändert aber auch für jene Menschen, die nicht unmittelbar von internationaler Zusammenarbeit an ihren Arbeitsplätzen betroffen sind, die Arbeitsanforderungen und die Arbeitsorganisation, die Konkurrenzsituation und die Zumutbarkeit an diesen Arbeitsplätzen, weil Unternehmen angesichts des internationalen Wettbewerbs kaum noch regionale Sonderwege bei der Produktion, der Arbeitsorganisation oder der Beschäftigung von Arbeitskräften gehen können.
- Zu 3.: Flexibilisierung der Arbeitsorganisation und der Erwerbsformen -
Die "Erosion des Normalarbeitsverhältnisses" ist in aller Munde, ohne dass immer überall klare Vorstellungen darüber bestehen, was darunter zu verstehen ist und in welchem Ausmaß eine solche Erosion stattgefunden hat. Neuere empirische Befunde aus einer EU-weiten Untersuchung zeigen, dass 1998 (nur) noch 62 % der deutschen Erwerbstätigen in einem unbefristeten Vollzeit-Arbeitsverhältnis standen gegenüber 67 % 10 Jahre zuvor (Hoffmann, Walwei 2000).
Obwohl diese Daten noch keine dramatische Veränderung signalisieren, zeigt dieselbe Studie, dass "atypische" Beschäftigungsverhältnisse in allen westeuropäischen Ländern an Bedeutung gewonnen haben: So befanden sich EU-weit im Jahre 1998 29 % der Erwerbstätigen in atypischen Arbeitsverhältnissen gegenüber 25 % im Jahre 1988. West-Deutschland liegt mit 27 % leicht über dem EU-Durchschnitt und hatte in den vergangenen Jahren auch einen stärkeren Zuwachs zu verzeichnen (Anstieg von 19,7 % auf 27,0 %). In Ostdeutschland liegt der Anteil der "atypischen" Beschäftigungsverhältnisse (4) bei rund 22 %. Eine weitere Zunahme solcher atypischen Beschäftigungsformen in Ost und West ist zu erwarten aufgrund weiterer Deregulierungen der Arbeitsmärkte im Zuge der EU-Rechtsangleichungen und bedingt durch internationalen Wettbewerbsdruck, aber auch als zwangsläufige Folge des sektoralen und beruflichen Strukturwandels und der Informatisierung aller Lebensbereiche.
Eine andere Untersuchung, die sich dem Problem "unsicherer" oder "prekärer" Beschäftigungsformen widmet (5), kommt zu dem Ergebnis, dass 1998/99 in West-Deutschland rund 10 % der Erwerbstätigen in solchen "unsicheren" Arbeitsverhältnissen waren, in Ost-Deutschland hingegen 16 % (Schreyer 2000). In [/S. 18:] dieser Studie wird deutlich, dass es insbesondere die Un- oder Niedrigqualifizierten sowie jüngere Arbeitskräfte sind, die sich in prekärer Beschäftigung befinden (Westdeutschland: 20 % aller Erwerbstätigen ohne abgeschlossene Berufsausbildung gegenüber 9 % derer mit abgeschlossener Lehre/ Berufsfachschule, in Ostdeutschland sogar 32 % gegenüber 14 %), aber auch akademische Berufsanfänger. Hauptkomponente unsicherer Beschäftigung ist in Westdeutschland die geringfügige, in Ostdeutschland die befristete Beschäftigung (z. B. ABM).
Zu den neuen Erwerbsformen gehört auch die "Telearbeit", die durch die Informatisierung der Arbeitswelt befördert wird und den Erwerbswünschen vieler Arbeitnehmergruppen entgegenkommt, z. B. dem Wunsch nach besserer Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder dem Wunsch nach größerer persönlicher Freiheit und Selbstbestimmung in der Arbeitsgestaltung. Allerdings ist Telearbeit in Deutschland noch nicht sehr weit verbreitet, wenn auch im Wachsen begriffen: Im Mai 2000 hatten rund 1 % der Erwerbstätigen in Deutschland einen Telearbeitsplatz, rund die Hälfte davon mit überwiegender Beschäftigung am PC. Am häufigsten kommt diese Erwerbsform bei Selbstständigen und bei Frauen vor (Statistisches Bundesamt 2001).
Die Abkehr vom Normalarbeitsverhältnis und die Entstehung neuer Erwerbsformen werden häufig auch unter dem Aspekt gesehen, dass der Mensch dadurch zunehmend zum "Unternehmer seiner eigenen Arbeitskraft" wird, für deren Ausprägung, Reproduktion und Weiterbildung er ganz allein verantwortlich ist. Auch dieses Phänomen gehört zum Paradigmenwechsel in der Berufsorientierung.
- Zu 4.: Höherqualifizierung und Alterung der Erwerbsbevölkerung -
Mit den beschriebenen Trends der Informatisierung und Globalisierung, den Veränderungen in der Arbeitsorganisation und dem Entstehen neuer Erwerbsformen verändern sich auch Qualifikationsanforderungen sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung. Anspruchsvollere und teurere Technik, abstraktere Produktionsabläufe und Geschäftsprozesse und rascherer Wandel bei Produkten und Verfahren erfordern von allen Beschäftigten höhere und breitere Qualifikationen. Arbeitsplätze für Ungelernte fallen zunehmend weg. 2010 sind voraussichtlich nur noch 11 % der Erwerbstätigen auf solchen Arbeitsplätzen beschäftigt, die keinerlei formale Berufsausbildung erfordern. Der Trend zur Akademisierung der Erwerbsbevölkerung wird also anhalten und von [/S. 19:] gegenwärtig rund 15 % auf rund 17 % im Jahre 2010 und vermutlich auch danach noch weiter ansteigen (Abbildung 6a und b).
Neben dem Anstieg des formalen Qualifikationsniveaus erhalten außerfachliche, extrafunktionale Qualifikationen (Schlüsselqualifikationen) immer größere Bedeutung. Diese beziehen sich vor allem auf:
Fachliche Qualifikationen sind nach wie vor wichtig, unterliegen aber einem raschen Verfall und müssen ständig aktualisiert werden. Daraus resultiert neben der Forderung nach einem hohen Allgemeinbildungsniveau und einer möglichst hohen und qualifizierten Erstausbildung als Voraussetzung für den Einstieg in den Arbeitsmarkt, die Forderung nach lebensbegleitendem Lernen, das die fachlichen Qualifikationen ständig auf den neuesten Stand bringt und die außerfachlichen Qualifikationen trainiert.
In vielen dualen Ausbildungsgängen und auch in manchen Studienfächern werden schon derzeit vermehrt curriculare Elemente eingebaut, die dem Erwerb außerfachlicher Kompetenzen dienen sollen. Von vielen Seiten wird gefordert, dass dieser Prozess bereits in den Schulen einsetzen müsse und auch Gegenstand der schulischen und außerschulischen Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung sein sollte.
Schaut man sich vor dem Hintergrund dieser prognostizierten Qualifikationsentwicklung die aktuelle Bildungslandschaft an, so wird deutlich, weshalb gegenwärtig wieder eine intensive Bildungswerbung anläuft. Die westdeutsche Bildungsexpansion der 70er und 80er Jahre ist in den 90ern nämlich ins Stocken geraten. Experten sprechen von einer "Bildungsstagnation" (Reinberg/ Hummel 2001a). So hat sich in Westdeutschland zwischen 1990 und 1998 weder das Abschlussniveau der Schulabgänger aus dem allgemein bildenden Schulwesen noch die Übergänge der Schulabgänger in berufliche Ausbildungsgänge und Studium nennenswert weiter "nach oben" entwickelt, so dass von der jetzt ins Erwerbsleben eintretenden Generation keine Fortsetzung des Höherqualifizierungstrends in der Erwerbsbevölkerung zu erwarten ist. Auch in den neuen Ländern zeigt sich nach der starken Erhöhung der Bildungsbeteiligung bis 1995 [/S. 20:] eine deutliche Abflachung des Höherqualifizierungstrends (Abbildung 7a/b und 8a/b).
Berücksichtigt man zudem die demografische Entwicklung - sinkende Geburtenraten, Alterung der Erwerbsbevölkerung (Abbildung 9a/b) - so wird deutlich, dass Deutschland vor einem dramatischen Fachkräftemangel im Bereich der mittleren und der höheren Qualifikationen steht, wenn nicht rasch Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Das erfordert u. a. auch die Bereitstellung von Nachqualifizierungsprogrammen für jüngere Erwachsene, die derzeit als Ungelernte in den Erwerbsprozess eintreten, und erhöhte Anstrengungen zur Weiterqualifizierung der Beschäftigten im mittleren und höheren Alter (lebensbegleitendes Lernen).
Für die Arbeit der Berufsorientierer und -berater bedeutet dies Ermutigung - Jugendlichen Mut zu machen für eine Zukunft, in der ihre Arbeitskraft gebraucht wird, Mut zu machen und zu zeigen, dass es sich lohnt, in die eigene Arbeitskraft zu investieren und eine möglichst qualifizierte Ausbildung zu absolvieren.
- Zu 5.: Entkoppelung der Erwerbsarbeit von Qualifizierung und Sozialer Sicherung -
Auch dieser Prozess hat bereits eingesetzt und lässt sich zum einen an der Diskussion um die Reformen in der Renten- und Krankenversicherung (private Altersvorsorge, Ausklammerung von Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung) und der Ausweitung von prekären Beschäftigungsverhältnissen ohne soziale Sicherung belegen.
Zum anderen sind im Bereich der beruflichen Qualifizierung Tendenzen einer Entkoppelung der Erwerbsarbeit von der Berufsaus- und Weiterbildung erkennbar. Zwar geben Unternehmen nach wie vor viel Geld für die Aus- und Weiterbildung ihrer Beschäftigten aus, doch ist der Trend hin zu vermehrter Privatisierung von Ausbildungskosten durch Verlagerung in die Freizeit oder Kostenbeteiligung der Beschäftigten unübersehbar. In der dualen Berufsausbildung sinkt die Ausbildungsquote (Anteil Auszubildende an Beschäftigten) und nach wie vor bilden nur rund 30 % aller Betriebe selbst aus, obwohl sehr viel mehr eine Ausbildungsberechtigung haben (IAB 2001). Immer mehr Betriebe gehen dazu über, für bestimmte Positionen, die früher mit weitergebildeten Fachkräften aus dem eigenen Unternehmen besetzt wurden, Hochschulabsolventen zu rekrutieren, für deren Ausbildung sie nichts zahlen mussten und bei denen nur noch die Einarbeitungskosten anfallen. [/S. 21:]
Investitionen in die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern und deren soziale Absicherung würden Unternehmen künftig - so die Meinung von Experten - nur noch für ein bestimmtes Segment ihrer Belegschaft, die sog. Kernbelegschaften, selbst übernehmen (Dostal, Stooß, Troll 1998).
Neue Arbeitsformen und selbstständige Arbeit in vielen Facetten und mit hohen Anforderungen an die Eigenaktivität und Eigenverantwortung für die eigene Qualifizierung und soziale Sicherung prägen das künftige Anforderungsprofil, auf das Jugendliche vorbereitet werden müssen.
- Zu 6.: Entstandardisierung von Erwerbsbiografien -
Die beschriebenen Entwicklungen befördern und unterstützen eine Entstandardisierung traditioneller Lebens- und Erwerbsverlaufsmodelle. Die traditionelle berufliche Normalbiografie, die - nebenbei bemerkt - immer nur eine männliche war, hat zwar noch nicht ausgedient, löst sich aber tendenziell auf. Insbesondere die Notwendigkeit lebensbegleitenden Lernens, aber auch die Verbreitung neuer Erwerbsformen, die Forderung nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Männer und Frauen und nicht zuletzt der Wertewandel in der Gesellschaft befördern andere Lebensmodelle als die traditionelle Verteilung von Lernen, Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, Familienarbeit, gesellschaftlicher Arbeit ("Bürgerarbeit") und Nichtarbeit ("Freizeit"). Mit solchen neuen und vielfältigeren Verteilungsmodellen, die selbstverständlich flankiert werden müssen von veränderten Modellen der Sicherung des Lebensunterhalts in diesen verschiedenen Phasen, ergibt sich auch eine Entzerrung und Dekomprimierung des derzeit gültigen Modells von Ausbildung - Erwerbstätigkeit - (relativ frühzeitiger) Ruhestand hin zu einem Modell verteilter und z. T. wiederkehrender Phasen von Lernzeiten, Erwerbszeiten, Unterbrechungen der Erwerbsarbeit und (relativ spätem) Ruhestand (Abbildung 10).
Solche Entwicklungen sind vereinzelt, wenn auch in bescheidenem Umfang, bereits sichtbar, z. B. beim Elternurlaub, Sabbatjahr, Bildungsfreistellungen, Seniorenstudium, aber bei weitem noch nicht gesellschaftliche Normalität. Am deutlichsten erkennbar sind die Auflösungstendenzen beim Berufseinstieg. Hier beobachten wir schon seit längerem eine tendenzielle Auflösung traditioneller Übergangsmuster von der Schule in den Beruf (6). Das lange Zeit gültige "Zwei-Schwellen-Modell" des Übergangs vom Bildungs- ins Beschäftigungssystem [/S. 22:]
und die sich daran knüpfenden politischen Handlungsfelder (Mertens/ Parmentier 1988) haben sich überholt. Jugendbiografien sehen heutzutage vielfach schon anders aus - nicht zuletzt bedingt durch Arbeitslosigkeit und Ausbildungsstellenmangel in den 80er und 90erJahren. Nach dem Ende der allgemein bildenden Schule (mit oder ohne Abschluss) diversifizieren sich die Übergänge und die Abfolge der Stationen:
In dieser Situation sind die für Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung Verantwortlichen gefordert, Jugendlichen bei der Konstruktion ihrer Biografie zu helfen, um aus den möglichen Stationen und Optionen kein zielloses, undurchschaubares Labyrinth und "Sich-Treiben-Lassen" werden zu lassen, sondern eine planvolle und kohärente, individuelle Karriere zu begründen.
- Zu 7.: Entberuflichung von Qualifizierungsprozessen und Arbeitsmärkten -
Die Bedingungen der Informatisierung und Globalisierung der Erwerbsarbeit und die Qualifikationsanforderungen in den neuen Beschäftigungsfeldern erfordern eine hohe Flexibilität des Arbeitskräfteeinsatzes und eine "Just-in-time"-Qualifizierung der Arbeitskräfte auf der Basis eines soliden und breit angelegten Qualifikationsfundaments. Damit wird sich in Deutschland der Trend zur Entberuflichung des Arbeitsmarktes, d. h. zu einer tendenziellen Auflösung der beruflich strukturierten Zugangswege zum Arbeitsmarkt und der beruflich strukturierten Arbeitsteilung in den Betrieben, in Teilbereichen des Arbeitsmarktes [/S. 23:] fortsetzen. Ein Blick in die Stellenanzeigen von Firmen des sog. "neuen Marktes" verdeutlicht dies: Hier lässt sich weder von der Stellenbezeichnung noch von den geforderten Qualifikationen auf einen "Beruf" oder eine "Berufsausbildung" schließen, die da gesucht wird:

Beruflichkeit - so die Einschätzung von Experten - wird vor allem in folgenden Bereichen auch in Zukunft noch eine Rolle spielen (Abbildung 11):
Für Angehörige der sog. Randbelegschaften und für Erwerbslose wird die Beruflichkeit weder bei der Rekrutierung noch bei der Tätigkeit künftig eine nennenswerte Rolle spielen (Dostal, Stooß, Troll 1998).
Gründe für das Festhalten am Beruf und am Berufskonzept in der Berufsbildung, wie sie von den für die Berufsbildung Verantwortlichen vorgebracht und verteidigt werden, sind vornehmlich soziologisch, psychologisch und pädagogisch-didaktisch legitimiert. Beruf und Beruflichkeit haben nämlich in der Gesellschaft und im Beschäftigungssystem neben der Qualifikations- und Allokationsfunktion auch eine Sozialisations- und Integrationsfunktion sowie eine identitäts- und sinnstiftende Funktion für den Einzelnen. Letztere sind für die soziale Verortung der Individuen in der Gesellschaft und für das Berufswahlverhalten von Jugendlichen von nicht zu unterschätzender Bedeutung.
Die seit einigen Jahren geführte Modularisierungsdebatte in der Berufsbildung verdeutlicht den Spagat zwischen Entberuflichungstendenzen auf dem Arbeitsmarkt und dem Festhalten am Berufskonzept in der beruflichen Ausbildung. Modularisierung soll einerseits im Interesse von Jugendlichen und von Betrieben mehr Flexibilität und Differenzierung in die starren Regelungen des dualen Systems bringen, andererseits soll sich Modularisierung am Berufskonzept als pädagogisch-didaktischer Klammer einzelner Ausbildungsmodule und als Orientierungsrahmen gegen die totale Beliebigkeit und Unübersichtlichkeit [/S. 24:] einer vollständig modularisierten Ausbildungslandschaft orientieren (Kloas 1997).
Inwieweit allerdings die orientierungs- und identitätsstiftende Funktion des "Berufs" für die Berufswahl und Berufsorientierung von Jugendlichen noch gewährleistet ist, scheint fraglich angesichts der Erosion der Beruflichkeit in den neuen Ausbildungsgängen:
"Die große Vielfalt der Ausbildungsgänge dürfte eine Folge veränderter Bedarfsstrukturen im Beschäftigungssystem sein. Immer häufiger werden - geboren aus singulären Bedarfsaussagen - zusätzliche Kombinationen von Qualifikationselementen zu neuen Berufsausbildungen zusammengesetzt. (...) Die Probleme beim Übergang aus der Ausbildung in die Erwerbstätigkeit haben die Autonomie der Ausbildung reduziert, da Ausbildungen immer spezifischer auf den aktuellen Bedarf hin ausgerichtet werden. Qualifikationen und ihre Verwertung werden zunehmend unter dem unmittelbaren Verwertungsaspekt gesehen. (...) Bei dieser Erosion wird der Berufsbegriff gern umgangen, denn dieser signalisiert in der Ausbildung immer noch eine gewisse Abrundung und eine umfassende Basis der gebündelten Qualifikationsziele. Die erste Stufe ist die Entfernung der Abschlussbezeichnung von der Bezeichnung des Zielberufs. Es ist bezeichnend, dass seit fast zwei Jahrzehnten Ausbildungsordnungen verabschiedet werden, die den Voraussetzungen von Klarheit, Prägnanz und Kürze eklatant widersprechen. (...) Diese Wortungetüme sind Ergebnis einer differenzierten Optimierung von Qualifikationselementen, sie sind aber nicht transportabel für die Identifikation mit einer Rolle in der Gesellschaft. (...) Eine zweite Stufe bei dieser Zersplitterung wird durch die neue Kombination von Berufsinhalten ausgelöst. Immer wieder werden additiv zusätzliche Inhalte auf bestehende Ausbildungen aufgesetzt, bis sie ein inhomogenes Spektrum von Inhalten darstellen, das keine Identifikationsrelevanz mehr hat. Bindestrich- und Hybridberufe für integrative Aufgabenlösung, Aufbau- und Doppelausbildungen sowie die Ergänzung des Qualifikationsprofils durch Fort- und Weiterbildungen führen zu individuellen Qualifikationsmustern, die in dieser Vielfalt weder von den Erwerbstätigen noch von den Arbeitsorganisatoren überblickt werden können." (Dostal, Stooß, Troll 1998, S.451 f)
Nimmt man diese Bedenken ernst, so ist künftig in der Berufswahlvorbereitung die Vermittlung einer neuen "Orientierung" gefragt, die nicht mehr den traditionellen Beruf im Zentrum hat, sondern die Ausprägung der [/S. 25:]
Versuchen wir zusammenzufassen welche Anforderungen sich aus den dargestellten Veränderungen an die nachwachsende Generation und damit auch an eine moderne Berufsorientierung in Schule und außerhalb von Schule ergeben:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung vom 5.12.1971, in: KMK (1997).
2) Gemeinsame Empfehlung der HRK, KMK und BA über die Zusammenarbeit in der Sekundarstufe II vom 12. Februar 1992, in: KMK (1997).
3) Die Vereinbarungen zwischen den Kultusministerien der Länder und den jeweiligen Landesarbeitsämtern sind ebenfalls veröffentlicht in: KMK (1997).
4) Unter "atypischen" Arbeitsverhältnissen versteht die Studie folgende Beschäftigungsformen: alle Teilzeitarbeitsverhältnisse, alle befristeten Arbeitsverhältnisse ohne Auszubildende in Universität und Forschung, Selbstständige außerhalb der Landwirtschaft ohne Beschäftigte.
5) Befristete Beschäftigung ohne Auszubildende, inklusive ABM, Leiharbeit, geringfügige Beschäftigung und Freie Mitarbeit.
6) Verschiedene Jugendstudien des Deutschen Jugendinstituts, München [15] haben hierzu eindrucksvolle Belege erbracht; vgl. z. B. Raab u. a. (1996).
Braun, F., Felber, H., Lex, T. (1997): Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit - Gesamtwerk in drei Bänden; Band 1: Lokale Politik gegen Jugendarbeitslosigkeit; Band 2: Berufliche Chancen für benachteiligte Jugendliche?, Band 3: Berufswege Jugendlicher zwischen Integration und Ausgrenzung, Weinheim - München.
BA (Bundesanstalt für Arbeit) (1999): Dienstblatt Runderlass Nr. 37/99 vom 15. September 1999. Durchführung der Berufsorientierung in der Berufsberatung/ Ausbildungsmarktpartner, in: Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit (ANBA) 47(1999)10, S. 1067 ff.
Dostal, W., Stooß, F., Troll, L. (1998): Beruf - Auflösungstendenzen und erneute Konsolidierung, in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 31(1998) 3.
Hoffmann, E., Walwei, U. (2000): Strukturwandel der Erwerbsarbeit - Was ist eigentlich noch "normal"?, IAB-Kurzbericht Nr. 14/ 25.10.2000.
IAB (2001): Betriebliche Berufsausbildung. Was du heute kannst besorgen ... Aktuelle Ergebnisse aus dem IAB-Betriebspanel 1999, in: IAB-Materialien Nr. 1/2001, S. 14 ff.
Kahsnitz, D. (1997): Arbeit und Arbeitslehre, in: Kahsnitz, D., Ropohl, G., Schmid, A. (Hrsg.), a. a. O.
Kahsnitz, D., Ropohl, G., Schmid, A. (Hrsg.) (1997): Handbuch zur Arbeitslehre, München.
Kloas, P.W. (1997): Modularisierung, Bielefeld.
KMK (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder) (1997): Dokumentation zur Berufsorientierung an Allgemeinbildenden Schulen, Band 1, Bonn.
Mertens, D., Parmentier, K. (1988): Zwei Schwellen - acht Problembereiche. Grundzüge eines Diskussions- und Aktionsrahmens zu den Beziehungen zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem, in: Dieter Mertens (Hrsg.), Konzepte der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung - Eine Forschungsinventur des IAB, Nürnberg, 3. überarbeitete Auflage 1988.
Meyer-Haupt, K. (1995): Berufsberatung. 2. neubearbeitete Auflage, Stuttgart.
Raab, E. u. a. (1996): Jugend sucht Arbeit. Eine Längsschnittuntersuchung zum Berufseinstieg Jugendlicher, Weinheim und München.
Reinberg, A.(1999): Der qualifikatorische Strukturwandel auf dem deutschen Arbeitsmarkt - Entwicklungen, Perspektiven und Bestimmungsgründe, in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 30 (1999) 4.
Reinberg, A. (2001a): Bildungsexpansion in Westdeutschland - Stillstand ist Rückschritt, IAB-Kurzbericht Nr. 8/ 18.4.2001.
Reinberg, Hummel (2001b): Die Entwicklungen im deutschen Bildungssystem vor dem Hintergrund des qualifikatorischen Strukturwandels auf dem Arbeitsmarkt. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Band 245, Nürnberg.
Schober, K. (1997): Berufswahlverhalten, in: Kahsnitz, D., Ropohl, G., Schmid, A. (Hrsg.), a. a. O.
Schreyer, F. (2000): "Unsichere" Beschäftigung trifft vor allem die Niedrigqualifizierten, IAB-Kurzbericht Nr. 15/ 31.10.2000.
Statistisches Bundesamt (2001): Mikrozensus: Leben und Arbeiten in Deutschland 2000, in: Wirtschaft und Statistik, Heft 4, S. 43.
Strijewski, C. (2001): Berufsorientierung in der Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung: Der Beitrag der Arbeitsämter, in: Schudy, J. (Hrsg.), Berufsorientierung in der allgemein bildenden Schule.
Troll, L. (2000): Arbeitsmittel in Deutschland, Teil 1: Moderne Technik bringt neue Vielfalt in die Arbeitswelt, IAB-Kurzbericht Nr. 6/ 16.5.2000; Teil 2: Moderne Technik kommt heute überall gut an, IAB-Kurzbericht Nr.7/ 17.5.2000.
Wanders, G., Schneider, J. (2001): Die geschichtliche Entwicklung der Berufsberatung in der deutschen Arbeitsverwaltung, in: Ertelt, B.-J. u. a. (Hrsg.), Facetten des Wandels. Aufgabenfelder der Bundesanstalt für Arbeit - nicht nur aus hochschulischer Sicht. Texte für die Aus- und Fortbildung in der Bundesanstalt für Arbeit (AuF Print) Nr. 7. Mannheim 2001.
Weidig, I., Hofer, P., Wolff, H. (1999): Arbeitslandschaft 2010 nach Tätigkeiten und Tätigkeitsniveau. Ergebnisse der IAB/ Prognos Projektion 1998/99. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Band 227, Nürnberg.
In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, Bd. 37, Bonn 1999, S. 13 - 20.
[/S. 32:] In der Berufsbildung hat sich ein Zielsystem etabliert, das aus der Diskussion um die Schlüsselqualifikationen hervorgegangen ist. An dieser Diskussion hat sich die universitäre Berufs- und Wirtschaftspädagogik zunächst nicht sonderlich intensiv beteiligt.
Die erste Diskussionsrunde erfolgte im Anschluss an Mertens' 1973/74 veröffentlichtes Plädoyer für ein Konzept von Schlüsselqualifikationen, dass das arbeitsmarktbezogene Argument der mangelnden Prognostizierbarkeit konkreter Arbeitsanforderungen im Betrieb zum Programm erhob. Wegen der Mängel einer auf Qualifikationsforschungen aufbauenden Prognostik und wegen der so genannten beschleunigten Zerfallszeit von Bildungsinhalten ("Obsoleszenztempo") wollte Mertens die Qualifikationen der Arbeitskräfte flexibilisieren anhand der bekannten vier Typen von Schlüsselqualifikationen:
| Basisqualifikation: z. B. Denkschulung; | |
| Lehrstoffbeispiel: formale Logik | |
| Horizontalqualifikationen: z. B. Informationsnutzung; | |
| Lehrstoffbeispiel: Bibliothekskunde | |
| Breitenelemente: Spezialkenntnisse, die allgemein bedeutsam geworden sind; | |
| Lehrstoffbeispiel: Messtechnik | |
| Vintagefaktoren: Inhalte, die die Bildungsdifferenz zwischen den Generationen aufheben sollen; | |
| Lehrstoffbeispiel: Programmiertechniken | |
Die damalige Kritik bezog sich vor allem auf Art und Form der vorgeschlagenen Inhalte, da die angestrebten Schlüsselqualifikationen offenbar nicht an komplexen Arbeitsaufgaben und ohne Bezug auf konkrete Arbeitsprozesse an abstrakten Lehrgegenständen wie formale Logik, Netzplantechnik usw. vermittelt werden sollten. Verwiesen wurde kritisch besonders auf die sich dadurch verschärfende Transferproblematik. Die nicht unproblematische These von der schnellen Entwertung konkreten Fachwissens schien einigermaßen plausibel, aber der bloße Austausch derartigen Fachwissens durch abstraktes Schlüsselwissen gab offenbar doch kein didaktisch befriedigendes Programm ab (Boehm et.al. 1974; Elbers et.al. 1975; Reetz 1976). [/S. 33:]
Die zweite Diskussionsrunde gegen Ende der 80er Jahre verschaffte dem Terminus der Schlüsselqualifikationen und dem dahinter sich verbergenden Ansatz mehr berufspädagogische Aufmerksamkeit, erbrachte Begründungsansätze und zeigte bildungspolitische Wirkungen. Gleichwohl verlief die Rezeption der "Schlüsselqualifikationen" in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik zunächst eher zurückhaltend:
"Bevor auf ausbildungspolitischer Ebene curriculare Entscheidungen über ein revidiertes Zielkonzept der Berufserziehung fallen, bevor "Schlüsselqualifikationen" zur verbindlichen Vorgabe für die Ausbildung in Betrieb und Schule erklärt werden, sollte eine gründliche und vorurteilslose Aufklärung des Sachverhaltes erfolgen, auf denen sich die Wortführer der didaktischen Reform beziehen" (Zabeck 1989).
Einer derartigen Aufklärung galten fortan meine Bemühungen, weil ich der Meinung war und bin, dass sich mit dem Konzept der Schlüsselqualifikationen die Chance eröffnet, Berufsbildung auf Basis der Fachbildung für eine fach- und berufsübergreifende Qualifizierung zu öffnen, die beruflichen Lernprozesse in Betrieb und Schule als Förderung der Persönlichkeitsentwicklung zu gestalten und damit auch an die berufspädagogische Tradition der Berufserziehung als "Bildungsprozess" anzuknüpfen.
Um einen solchen berufspädagogischen Anspruch der Persönlichkeitsbildung sichern zu helfen, wurde 1989 auf dem Symposium "Schlüsselqualifikationen - Fachwissen in der Krise?" ein Konzept entworfen, mit dem die Förderung von Schlüsselqualifikationen in den pädagogischen Zusammenhang von "Bildsamkeit und Bestimmung" bzw. von "Entwicklung und Erziehung" gestellt werden konnte:
Dies sind die Titel der beiden Bände der Pädagogischen Anthropologie von Heinrich Roth. Im ersten Band legt Roth die interdisziplinären Befunde über Bildsamkeit und Lernfähigkeit in Form einer pädagogischen Persönlichkeits- und Handlungstheorie vor; im zweiten Band stellt er die Entwicklungs-, Lern- und Erziehungsprozesse dar, die den Menschen im Zuge der Ausformung seiner Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz "in die mündige Selbstbestimmung zu führen vermögen" (Roth 1971, S. 17, S. 388 f.). Insgesamt hat Roth hier eine umfassende Entwicklungspädagogik vorgelegt, welche die ihr gebührende Aufmerksamkeit in der Erziehungswissenschaft erst in jüngster Zeit zu finden scheint (Achtenhagen 1996, S. 24; Aufenanger 1992, S. 15 ff.; Bauer 1997, S. 102 f.).
Die ähnliche Verwendung des Kompetenzbegriffes in Roths pädagogischer Anthropologie wie in der Schlüsselqualifikationsdiskussion ist sicher nicht zufällig, [/S. 34:] vor allem wenn man sieht, dass Roth über den von ihm maßgeblich mitbeeinflussten zweiten Deutschen Bildungsrat zur Verbreitung des Kompetenzbegriffes in der Erziehungswissenschaft beigetragen hat (Achtenhagen 1996; Deutscher Bildungsrat 1974, S. 49).
Der Kompetenzbegriff hat in der Schlüsselqualifikationsdiskussion von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt. So habe ich z. B. in meinen grundlegenden Aufsätzen zu diesem Thema (Reetz 1989, 1990, S. 17 f.) darauf aufmerksam gemacht, dass die Zielformel der Schlüsselqualifikationen nicht nur qualifikations- und arbeitsmarkttheoretisch oder curriculumtheoretisch, sondern vor allem kompetenztheoretisch zu interpretieren sei.
Inzwischen hat der Kompetenzbegriff Eingang in die Ordnungsmittel der Berufsbildung gefunden (vgl. Stiller 1998). Besonders aber angesichts der ausufernden Verwendung des Kompetenzbegriffes in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik, vornehmlich in der berufspädagogischen Weiterbildungsdiskussion stelle ich mit einiger Verwunderung fest, dass dieser Terminologie nicht annähernd so viel didaktische bzw. ideologiekritische Auseinandersetzung zuteil wird, wie dem Begriff der Schlüsselqualifikationen.
Ich möchte deshalb im Folgenden einige Anmerkungen zur Kompetenz-Thematik machen, die der Klärung des Verhältnisses von Schlüsselqualifikationen - Kompetenz und Bildung dienlich sein könnten (Abschnitt 3).
In Weiterführung dieser Gedanken geht es mir hier dann um die Frage, wie mit der Einbindung der Schlüsselqualifikationen in das Konzept einer Persönlichkeitsentwicklung (Reetz 1990) eine Rückbesinnung auf das pädagogische Grundprinzip der Bildung wirksam werden kann; und zwar in der Weise, dass Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen über die kurzfristigen Qualifizierungsergebnisse hinaus auf Persönlichkeitsförderung des einzelnen Menschen in Richtung beruflich-fachlicher, sozialer und humaner Mündigkeit angelegt sind oder sein sollten.
Dass dieses Postulat, nämlich "die individuelle Förderung der Persönlichkeit ins Zentrum von Lehr-Lernprozessen zu stellen", gegenwärtig Realisierungschancen hat, darauf verweist auch Frank Achtenhagen (Achtenhagen 1996, S. 27) im Kontext seiner Konzeptionierung von "ökonomischer Kompetenz":
"Diese genuin pädagogische Zielsetzung hat ihre eigene Berechtigung und darf nicht instrumentalisiert werden. Das ist deswegen besonders hervorzuheben, weil inzwischen auch die Betriebe immer deutlicher erkennen, dass die umfassende Persönlichkeitsentwicklung eine wichtige Vorbedingung für das Erbringen ausgezeichneter Arbeitsleistung darstellt, so dass man in dieser Perspektive [/S. 35:] von einer "Koinzidenz ökonomischer und pädagogischer Vernunft" sprechen kann" (Deutsche Forschungsgemeinschaft 1990, S. VII).
In diesem Zitat wird auf die sich verdichtende Annahme verwiesen, dass Veränderungen in dem Produktionsformen der großen Industrie wie auch im Dienstleistungssektor zu einer Konstellation geführt haben, in der Qualifikation und Bildung nicht von vornherein als unvereinbare Ansprüche auftreten, sondern eher als einander bedingende komplementäre Größen.
Demgegenüber war es in den 70er Jahren in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik eine der bevorzugten Thesen, dass Persönlichkeitsentwicklung unter restriktiven Bedingungen der betrieblichen Sozialisation kaum möglich sei, dass also der Mensch hinter seinen Werdemöglichkeiten (Bildung) zurückbleiben müsse zugunsten sozialer Anpassung und eng geführter betrieblicher Qualifizierung.
Diese Argumentationsfigur der Berufs- und Wirtschaftspädagogik reicht zurück in die bildungstheoretisch inspirierte langjährige Diskussion um Berufs- und Allgemeinbildung und hängt dadurch zusammen mit einem weiteren Argument bildungstheoretischer Tradition: dem Verweis darauf, dass das Schlüsselqualifikationskonzept formale Bildung bedeute, deshalb abzulehnen, zumindest skeptisch zu beurteilen sei.
Da ich dieser Frage an anderer Stelle ausführlich nachgegangen bin (Reetz 1999), werde ich hierauf nur kurz an entsprechender Stelle eingehen, wenn ich in Abschnitt 4 den Gedanken einer entwicklungspädagogischen Orientierung von Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen am Bildungsbegriff skizziere. Zuvor jedoch möchte ich auf die Aktualität der Schlüsselqualifikationen aus der Perspektive der Qualifikationsforschung aufmerksam machen.
Die entscheidenden Impulse für die Aufnahme von Schlüsselqualifikationen in das Zielsystem der Berufsbildung gingen von dem betrieblichen Partner des dualen Systems aus. Symptomatisch hierfür waren die Aktivitäten der betrieblichen Ausbilder, wie sie etwa in den Jahrestagungen der gewerblichen und kaufmännischen Ausbildungsleiter der 80er Jahre und insbesondere im "Petra"-Projekt der Firma Siemens zum Ausdruck kamen (Boretty et.al. 1988; Litzenberg/ Tripp 1987). Den Hintergrund dieser Aktivitäten bildeten gravierende Veränderungen im Beschäftigungssystem. Sie betrafen vor allem Tätigkeits- und Anforderungsveränderungen aufgrund des beginnenden Wandels der Marktstrukturen und im Zusammenhang der breiten Einführung der neuen Technologien sowie den damit verbundenen organisatorischen Veränderungen in den [/S. 36:] Betrieben. Ähnlich der These Kern/ Schumanns (1984) vom "Ende der Arbeitsteilung" gewerblich-technischer Tätigkeiten prognostizierten Baethge/ Oberbeck 1986 den "Abschied vom Taylorismus". Demnach hat die Einführung von neuen Technologien eine "systemische Rationalisierung" zur Folge, die im gewerblich-technischen Sektor den Facharbeiter zum planenden, steuernden und kontrollierenden "Systemregulierer" werden lässt und die im Dienstleistungssektor eine neue Stufe der Entwicklung von Büroarbeit darstellt. Durch das Zusammenwirken von systemischer Rationalisierung und unmittelbarem EDV-Einsatz ergibt sich für die Büroarbeit eine neue Handlungsstruktur qualifizierter Sachbearbeitung.
Nahezu zehn Jahre später wird immer deutlicher, dass die Bewältigung dieser Handlungsstruktur "eines vielfältigen und hochdifferenzierten Qualifikationsprofils" bedarf (Baethge/ Baethge-Kinsky 1995, S. 150 f.). Zu dem vornehmlich zu rechnen sind:
Anstelle technisch-organisatorisch determinierter Arbeitsvollzüge treten sichtbar "Selbstorganisation", "Selbstverantwortung" und "sozialkommunikatives Handeln" als Bestandteile der Arbeitsprofile, wie Baethge und Baethge-Kinsky (Baethge/ Baethge-Kinsky 1995, S. 150 ff.) zusammenfassend feststellen.
Man kann also die wachsende Bedeutung, die den Schlüsselqualifikationen in den 80er Jahren beigemessen wurde, als ein Symptom für die zunehmenden Strukturveränderungen unseres Beschäftigungssystems in Richtung Flexibilität betrachten.
In den 90er Jahren setzt sich dieser Trend verstärkt fort: Betriebe sehen sich einem gewaltigen Veränderungsdruck ausgesetzt, der aus der technologischen, der ökonomisch-wettbewerbsmäßigen und der gesellschaftlichen Entwicklung resultiert. [/S. 37:]
Die technologische Entwicklung vor allem der Kommunikationsmedien hat eine Temposteigerung der Informationsübermittlung zur Folge, die zugleich das Wissen über weit entfernte gleichzeitige Geschehnisse erhöht. Damit wachsen Komplexität und Dynamik der Umwelt- und Umfeld-Bedingungen erheblich an.
Davon ist vor allem auch die ökonomische Entwicklung des Wettbewerbs betroffen. Die Betriebe verändern ihre Marktstrategien und betrieblichen Organisationsstrukturen. Dabei geht die Personalentwicklung mit der Organisationsentwicklung eine enge Verbindung ein und wird zur "strategieorientierten" Personalentwicklung (Riekhof 1992; Sattelberger 1991). Im Zuge dieser Entwicklungen werden die im Menschen schlummernden Kräfte und Fähigkeiten zu Kreativität und Selbstorganisation "entdeckt" (Antoni 1992). Die Aktivierung dieser "Human-Ressourcen" wird gar zum "Bestimmungsfaktor für die Wettbewerbsposition" (Laukamm 1992) erklärt.
Man begreift deshalb Unternehmen als lernende Organisationen (Geißler 1994a, 1994b) und mit dem Wandel von Verkäufermärkten zu Käufermärkten orientiert sich die betriebswirtschaftliche Wertschöpfung zunehmend am Kunden. Konzepte von Lean-Production und Lean-Management (Pfeiffer/ Weiss 1994) sowie Business-Prozess-Reengineering (Hammer/ Champy 1994) verschaffen sich auch in Deutschland Geltung und führen zur Abkehr von den traditionellen Organisationsprinzipien, wie sie im Zuge der Massenproduktion nach Ford und Taylor das organisatorische Denken unseres Jahrhunderts beherrscht haben (vgl. auch Lumpe/ Wagner 1997).
Aus berufssoziologischer Sicht charakterisieren Baethge/ Schiersmann (1998; 1999) diese Entwicklungen - nicht generalisierend, sondern in Form von Trendaussagen - als Prozesse der "internen" und der "externen" Flexibilisierung. Demzufolge verlangt die beginnende Globalisierung der Märkte eine innere organisatorische Flexibilisierung, die den "Wandel von einer funktions-/ berufsorientierten zu einer prozessorientierten Betriebs- und Arbeitsorganisation bestimmt". In engem Zusammenhang mit dieser internen Flexibilisierung wird die externe Flexibilisierung gesehen. Sie betrifft die Entstehung neuer Beschäftigungsformen, die nicht mehr durch hohe berufliche Kontinuität, stabile Betriebsbindung und lebenslange Vollerwerbstätigkeit gekennzeichnet sein werden. Tendenzen der Segmentierung verstärken sich.
Im Zuge der internen Flexibilisierung durch stärkere Prozessorientierung ergeben sich auch erhebliche Veränderungen bezüglich des Einsatzes und der Akzentuierung der erforderlichen Qualifikationen:
Dezentralisation, Projektförmigkeit und Querfunktionalität der Arbeitsprozesse führen z. B. dazu, dass die "schnelle und jeweils aufgabenbezogene [/S. 38:] Integration unterschiedlicher Fachlichkeiten von entscheidender Bedeutung" wird.
Das bedeutet auch, dass an die Flexibilität des Wissens, genauer: an die flexible Verfügbarkeit und Erweiterbarkeit des Wissens, erhöhte Anforderungen zu stellen sind. In diesem Zusammenhang "wachsen die Anforderungen an Selbstständigkeit, Selbstorganisation, Koordinierungs- und Kommunikationsfähigkeit erheblich" (Baethge/ Schiersmann S. 8 f.; Schumann/ Gerst 1996; Gerst 1998).
Insgesamt erhält die Vermittlung von sozial-kommunikativen Kompetenzen in der Aus- und Weiterbildung ein starkes Gewicht.
Gerade weil die aktuelle Relevanz von "Sozialkompetenz" so hervortritt, dürfte eine Besinnung auf den Zusammenhang der Kompetenzen, ihren Systemcharakter, von Bedeutung sein.
Mein Versuch, Schlüsselqualifikationen mit Bezugnahme auf Roths Pädagogische Anthropologie als ein System von Kompetenzen zu konzeptionieren, geschah unter anderem in der Absicht, die bereits damals ausufernden Listen von "Schlüsselqualifikationen" überprüfbar zu machen und ggf. auf Persönlichkeitspotenziale, eben Kompetenzen, zurückzuführen, die für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit als grundlegend zu betrachten sind. Systemcharakter sollte dieses Konzept bekommen einerseits durch die Relationen der Kompetenzen/ Schlüsselqualifikationen zur Zielkategorie der Handlungskompetenz, andererseits durch die Relationen der Kompetenzen untereinander.
Bevor ich jedoch näher darauf eingehe, möchte ich einiges zur begrifflichen Klärung des Verhältnisses von "Schlüsselqualifikationen" und "Kompetenzen" voranstellen.
In pädagogischer Sicht zielt der Begriff der Kompetenz auf menschliche Fähigkeiten, die dem situationsgerechten Handeln zugrunde liegen und dieses erst ermöglichen. So wird mit beruflicher Handlungskompetenz das reife Potenzial beruflicher Fähigkeiten bezeichnet, das es dem Menschen erlaubt, entsprechend den Leistungsanforderungen, die in konkreten beruflichen Situationen gestellt werden, zu handeln. Aus der Sicht des Beschäftigungssystems werden die jeweils nachgefragten, aktuell verwertbaren Fähigkeiten, derartigen Leistungsanforderungen gerecht zu werden, als Qualifikationen bezeichnet. Aus der pädagogischen Perspektive einer Kompetenz bilden die abgeforderten Qualifikationen [/S. 39:] aber nur einen Teil des Potenzials, das mit beruflicher Handlungskompetenz umschrieben wird. Der Kompetenzbegriff ist also gegenüber dem Qualifikationsbegriff nicht nur umfassender, er bringt auch die jeweilige Fähigkeit zur Erzeugung von Verhalten auf Basis von individueller Selbstorganisation stärker zum Ausdruck (Bunk 1994, S. 10; Erpenbeck/ Heyse 1996, S. 38 f.). Dieser, dem pädagogischen Kompetenzbegriff zugehörige Grundgedanke, ist auf Einflüsse der linguistischen Kompetenztheorie Chomskys zurückführbar. Seine Unterscheidung von "Kompetenz" und "Performanz" geht von der Tatsache aus, dass dem Oberflächen-Verhalten (Performanz) des aktuellen Sprechens in der Tiefenstruktur der Person und seines Wissens ein Sprachpotenzial (Kompetenz) zugrunde liegt, aus dem heraus mehr Sätze erzeugt werden können, als jemals tatsächlich geäußert werden (vgl. Witt 1975).
Im Unterschied zu Chomsky geht man in der Pädagogik davon aus, dass auch die zugrunde liegende Tiefenstruktur der Kompetenz nicht angeboren, sondern erworben ist. Ihre Erforschung ist vor allem Piaget und den ihm verbundenen kognitiven Lern- und Entwicklungstheoretikern zu verdanken. Sie richten ihr Hauptaugenmerk auf den Erwerb von Kompetenzen als Folge von Entwicklungs- bzw. Lernprozessen. Wenn man den Sachverhalt der Erzeugung von Sprachhandeln auf berufliches Handeln schlechthin bezieht, kann man von Erschließungsfähigkeit oder - bildkräftiger - von Schlüsselfähigkeit sprechen. Da diese Fähigkeit auf die Generierung von verwertbaren Verhaltensweisen (Qualifikationen) gerichtet ist, liegt es nahe, von Schlüsselqualifikationen zu sprechen; und dies, obwohl in diesem Sprachmodell nicht die anforderungs- und situationsnahen Qualifikationen, sondern eher die personennahen gleichwohl auch in Relation zu Handlungssituationen befindlichen Kompetenzen das generierende und erschließende Potenzial darstellen. Kath hat aus ähnlichen Erwägungen heraus daher 1990 vorgeschlagen, von "Schlüsseldispositionen" zu sprechen (vgl. auch Erpenbeck/ Heyse 1996, S. 36). Mit anderen Worten: Der Terminus "Schlüsselqualifikationen" gibt zu Missverständnissen Anlass, weil er seiner Bedeutung nach nicht Qualifikationen sondern Kompetenzen intendiert. Er ist aber eine - wie sich gezeigt hat - recht wirksame Metapher, den dahinter stehenden Kompetenzgedanken transportieren zu helfen. Nun hat diese bereits eine sozialnormative Bedeutung erlangt, so dass man sie als Bestandteil einer "öffentlichen Semantik" ansehen kann (Jutzi 1997, S. 307). Die in dieser Semantik enthaltenen Bedeutungen weisen eine große Bandbreite auf: Einerseits erhalten recht enge Qualifikationen - wie z. B. im Siemens-Projekt PETRA (Boretti et.al. 1988) - den Status von "Schlüsselqualifikationen", andererseits werden auch Personeigenschaften, die von beruflichem Handeln losgelöst erscheinen, als Schlüsselqualifikationen bezeichnet (Jutzi 1997, S. 319 ff.). Auf diese Weise kommen dann ausgedehnte Schlüsselqualifikations-Listen zustande, deren Volumen gelegentlich kritisch gegen das Konzept überhaupt eingewandt wird. [/S. 40:]
Die öffentliche Semantik findet ihren Niederschlag in der Diktion der Ordnungsmittel der Berufsbildung. Hierzu heißt es pragmatisch eindeutig: "Der Begriff Schlüsselqualifikationen wird im Zusammenhang mit Neuordnungen von Ausbildungsberufen synonym für methodische, soziale und personale Kompetenzen thematisiert und operationalisiert" (Stiller 1998; Reisse 1997).
Nun darf die Kodifizierung der das Schlüsselqualifikationskonzept bestimmenden Kompetenztrias (Methoden-, Sozial-, humane Selbstkompetenz) in den Ordnungsmitteln nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Operationalisierung dieser Kompetenzen noch immer eine zu lösende Aufgabe bleibt. Dass es sich dabei nicht um die gleiche Art der Operationalisierung handeln kann, die die seinerzeit vorherrschende behavioristische, also performanzorientierte Lernzielprogrammatik bestimmte, liegt an der Komplexität des Kompetenzbegriffes, dessen Auftreten zu Beginn der 70er Jahre ja zugleich auch ein sich änderndes Lehr- und Lernziel-Verständnis mit sich brachte, nachdem der Deutsche Bildungsrat 1974 Kompetenzen als Ziele von Lernprozessen herausgestellt hatte. Vielfach geht es also eher um Konkretisierung, um "Kleinschreiben" der großen Ziele und um Sequenzierung der Lerninhalte und Teilziele in Form von Aufgabenstellungen, die Grundlage der Kompetenzen sind (Meyer 1975, S. 59).
Die von mir - in Anlehnung an Roth - bevorzugte Systematik von Sach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz kann auch als Einstieg in eine "Operationalisierung" und Aufklärung über die "wechselseitige Bedingtheit" (Achtenhagen 1996, S. 24) der kompetenzbeschreibenden Kategorien gesehen werden.
Betrachtet man in diesem Zusammenhang z. B. die Schlüsselqualifikations-Systematik, die dem Hamburger Modellversuch "Schlüsselqualifikationen für Kaufleute im Einzelhandel" zugrunde gelegt wurde (Schopf 1992), so wird eine Komplexionshierarchie erkennbar, die vertikal auf die Zielkategorie der Handlungskompetenz bezogen ist und die horizontal die Relationen der Kompetenzen untereinander andeutet. [/S. 41:]
|
So erscheint plausibel, dass z. B. "Verhandlungsfähigkeit" als marktkommunikative Fähigkeit eine Spielart von Kommunikationsfähigkeit bzw. ein Indikator von Sozialkompetenz sein kann. Andererseits überlagert diese "vertikale" Zuordnung (gemäß einer eher nach Abstraktionsgraden gestuften Merkmalshierarchie) die "horizontalen" Relationen, etwa zwischen Sach- und Methodenkompetenz und zwischen den anderen Kompetenzvarianten.
Diese Beziehungen ließen sich etwa folgendermaßen skizzieren:
Sachkompetenz betrifft die allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit des Individuums, d. h., die Fähigkeit zu sacheinsichtigem und problemlösendem Denken und Handeln.
Mit dem Begriff wird also auf die Fähigkeit verwiesen, sachstrukturelles und strategisches Handlungswissen so aufeinander zu beziehen, dass Problemlösungen in spezifischen Bereichen anforderungsgerecht gelingen.
Eine Erweiterung der Sachkompetenz ergibt sich durch Ausformung situativ erlernter, gleichwohl übergreifender Strategien und Heurismen (Findungs- und Lösungsverfahren). Ein breites und flexibles Inventar an Handlungsalgorithmen und Heurismen begründet Methodenkompetenz. Sie beruht im Wesentlichen darauf, dass jemand seine Sachkompetenz auf gut ausgebauter epistemischer und heuristischer Wissensstruktur gründen kann (Doerner 1987). Als Merkmal der Kreativität wird angesehen, wenn jemand über ein breites und gut ausgebautes [/S. 42:] Inventar von Heurismen verfügt und selbst ad hoc neue Heurismen erstellen kann. Damit haben wir auch den Kern dessen bloßgelegt, was wir (kreative) Methodenkompetenz nennen können. Von ihr ist zu sprechen, wenn das Anwenden können unterschiedlichster Verfahrensweisen auf der Fähigkeit basiert, über ein breites Repertoire von Heurismen zu verfügen und dies bei Bedarf durch Neukonstruktionen zu erweitern.
Das von Frank Achtenhagen vorgestellte Konzept zur "Entwicklung ökonomischer Kompetenz als Zielkategorien des Rechnungswesens" kann als Ausdruck von Sachkompetenz und von fachspezifischer Methodenkompetenz angesehen werden, wobei auch die Vernetzungen zu Sozial- und Selbstkompetenz deutlich erkennbar werden. Denn: Sach- und methodengerechtes Handeln allein entsprechen nicht schon mündiger Handlungskompetenz. Handeln muss auch sozial vertretbar und moralisch verantwortbar sein; d. h., Handlungskompetenz als Fähigkeit zu mündigem Handeln umschließt auch Sozialkompetenz und humane Selbstkompetenz (vgl. Erpenbeck/ Heyse 1996, S. 39).
Sozialkompetenz betrifft ebenso kooperatives und solidarisches, wie sozialkritisches und kommunikatives Handeln können. Kommunikative Kompetenz zielt auf Fähigkeiten zu diskursiver Verständigung möglichst unter den Bedingungen symmetrischer (chancengleicher) Kommunikation.
Selbstkompetenz betrifft die Fähigkeit zu moralisch selbstbestimmtem humanen Handeln. Dazu gehört neben der Behauptung eines positiven Selbstkonzeptes (Selbstbildes) vor allem die Entwicklung zu moralischer Urteilsfähigkeit.
Diese Zusammenhänge werden z. B. unter anderem thematisiert in den Untersuchungen zur kommunikativen Kompetenz bei Van Buer 1995, Van Buer/ Matthäus (1994) und Wittmann (1996; 1998). Mit Bezugnahme auf Habermas (1981) wird am Beispiel des "gelungenen" marktkommunikativen Verkäuferhandelns (bei Bank-/ und Einzelhandelskaufleuten) der konflikthafte Dualismus von strategischem und auf Konsensbildung und kommunikativem Handeln verdeutlicht (Van Buer/ Matthäus 1994, S. 74 f.; Wittmann 1998).
Wenn man diese beiden "Grundrichtungen" kommunikativen Handelns operationalisierend in die didaktische Ebene transformiert, so tritt der Zusammenhang von kommunikativer Sozialkompetenz und humaner Selbstkompetenz zutage: Ein Beispiel hierfür bieten die von dem St. Gallener Wirtschaftsethiker P. Ulrich herausgegebenen Lehreinheiten zum Thema "Ethik in Wirtschaft und Gesellschaft", die u. a. auch die Dilemma-Fallstudie zum Widerstreit zwischen ökonomisch-strategischem und human bestimmtem kommunikativem Handeln beim Verkaufen enthält (Ulrich 1996, S. 105 ff.). Es handelt sich bei diesem fallbasierten Lernarrangement um curriculare Inhalte und Anlässe, mit denen [/S. 43:] versucht werden kann, moralische Urteils- und Handlungsfähigkeit - etwa gemäß dem Kohlbergschen Stufenaufbau - durch reflexives "Sich-Bilden" höher zu entwickeln (Oser/ Althoff 1992, S. 41 ff.).
Das entspräche der Aufgabe, die z. B. Zabeck der wirtschaftsberuflichen Erziehung stellt, der zufolge der einzelne Mensch dazu befähigt werden soll, "den ökonomischen Aspekt zu beachten und ihn im Handeln in Verantwortung zu relativieren" (Zabeck 1991, S. 535). Eine solche - auch in der Geschichte der Pädagogik und ihrer Bildungstheorie tief verwurzelte - Aufgabenstellung, erhält allerdings in jüngst veröffentlichten wirtschaftspädagogischen Forschungen und Empfehlungen zur "Kompetenzentwicklung" eine Alternative: Beck (1996) und Beck et. al. (1998) haben in ihren Untersuchungen bei Versicherungslehrlingen herausgefunden, dass ihre Probanden in privaten Situationen anders, nämlich im Sinne Kohlbergs ethisch anspruchsvoller urteilen, als in marktbezogenen Situationen (Segmentierungsthese). Die Autoren nehmen ihre Befunde zum Anlass, zu fordern, "dass junge Auszubildende lernen sollen, moralisch zu differenzieren, sich etwa in marktbezogenen Kontexten am strategischen Prinzip der Stufe 2 zu orientieren, in teambezogenen Kontexten dagegen an den Prinzipien von Stufe 3 und 4" (Beck et. al. 1998, S. 208).
Logik und Konsequenzen einer solchen marktorientierten Moral können an dieser Stelle nicht diskutiert werden. Hier geht es in erster Linie um die Verdeutlichung des Zusammenhanges von Ziel komplexen innerhalb einer Systematik von Schlüsselqualifikationen, in diesem Falle um den Zusammenhang von sachbezogen ökonomischer, sozialer und moralischer Kompetenz.
Mit der Feststellung, dass ein Zusammenhang zwischen Kompetenzen besteht und dass sich dieser in der konkreten lernenden Auseinandersetzung mit relevanten komplexen Lehr-Lern-Arrangements entfaltet, bleibt die Frage nach pädagogischen Aufbauprinzipien von Kompetenzentwicklung noch nicht beantwortet.
Auch die unter dem Etikett "Kompetenzentwicklung" vor allem in der betrieblichen Weiterbildung stark zunehmenden Veröffentlichungen lassen Auskünfte hierüber vielfach vermissen (Kompetenzentwicklung '96; '97). Die derzeitige kompetenzorientierte Wende stehe deutlich in der Tradition wirtschaftswissenschaftlicher und arbeitspsychologischer Konzeptionen, stellt Arnold kritisch fest. Der Kompetenzentwicklungsbegriff werde in diesem Sprachzusammenhang kaum als eine auf Identitätsentwicklung bezogene pädagogische Kategorie verwendet. So bleibe auch "die Frage einer erforderlichen bzw. möglichen Wertorientierung im Lernprozess" ungeklärt (Arnold 1997, S. 289 f.). [/S. 44:]
Ähnlich kritisch sehen Baethge/ Schiersmann das neue Weiterbildungs-Label "Kompetenzentwicklung": "Dieses Spiel mit Begriffen mag eine richtige Auswirkung der veränderten Anforderungen in Richtung stärkerer Selbstorganisation und Gestaltungsfähigkeiten beschreiben und es ist unbestritten, dass einer subjektbezogenen Gestaltung von Bildungsprozessen große Bedeutung ... zukommt. Es stellt sich dennoch die Frage, ob es klug ist, vorschnell den Begriff der Bildung über Bord zu werfen und ihn durch einen Begriff zu ersetzen, der eher einer (psychologischen, L. R.) Persönlichkeits- als einer Bildungstheorie zuzuordnen ist" (Baethge/ Schiersmann 1999, S. 19).
Der Hinweis auf den Begriff der Bildung ist vor allem auch deshalb plausibel, weil das deutsche Bildungsprinzip ja den Entwicklungsgedanken enthält, im Sinne der Entelechie des Menschen als die - mit Goethe zu sprechen - "geprägte Form, die lebend sich entwickelt".
Seit Sprangers und Kerschensteiners - eher auf Goethes Wilhelm Meister als auf W. v. Humboldt zurückgehender Deutung des Verhältnisses von Berufs- und Allgemeinbildung im Sinne einer Entwicklungssequenz hat der Entwicklungsgedanke in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik wenig Resonanz gefunden. Vielmehr beherrschte das Räsonnement um die "Dichotomie" von Beruf/ Qualifikation und Bildung die Diskussion (Arnold 1994; 1996; Reetz 1999).
Demgegenüber wird in der neueren bildungstheoretischen Diskussion (Koch/ Marotzki/ Schäfer 1997) wieder der prozessuale Charakter von Bildung hervorgehoben. Bildung wird dabei im Kontext, von neueren Lern- und Entwicklungstheorien als "gerichteter Transformationsprozess der Grundstrukturen im Umgang mit sich selbst und mit sozialer und natürlicher Welt" gesehen (a. a. O. S. 9). In diesem Zusammenhang wird eine bildungstheoretisch-prozessuale Lerntheorie skizziert, zu deren Fundierung explizit auf Heinrich Roths Pädagogische Anthropologie zurückgegriffen wird (Bauer 1997, S. 102 f.). Dies geschieht vor allem deshalb, weil Roth darin einen interdisziplinär angelegten entwicklungspädagogischen Ansatz formuliert hat, der auf den Begriffen der Persönlichkeit, des Lernens und der Entwicklung basiert (Aufenanger 1992, S. 18). Das bedeutet, dass hier - anders als in manchen Konzepten zur "Kompetenzentwicklung" - "Kompetenzen" in den Zusammenhang von Persönlichkeitsentwicklung als Persönlichkeitsbildung gestellt werden.
In der genannten Tradition des prozessualen Bildungsgedankens stehend entwirft Roth seine Theorie menschlichen Handelns als Entwicklung. Er sieht [/S. 45:] dabei die "entscheidenden Fortschrittsstufen der menschlichen Handlungsfähigkeit" (S. 446) in der Abfolge einer Entwicklung, die auf der Basis frühkindlicher Erfahrung, "sich Ziele setzen zu können und die Mittel dafür zu entdecken" vom
"Erlernen sacheinsichtigen Verhaltens (Entwicklung und Erziehung zu Sachkompetenz und intellektueller Mündigkeit)" - über
das "Erlernen sozialeinsichtigen Verhaltens und Handelns (Entwicklung und Erziehung zu sozialkompetenter und sozialer Mündigkeit)" - zum
"Erlernen werteinsichtigen Verhaltens und Handelns (Entwicklung und Erziehung zu Selbstkompetenz und moralischer Mündigkeit)" führt (S. 448).
Selbstkompetenz im Sinne moralischer Mündigkeit baut demzufolge auf sachkompetent-intellektueller und sozialer Mündigkeit auf (S. 382, S. 389). Um das Individuum auf den Weg dorthin in konstruktive Bahnen zu lenken, stellt sich zuerst die Aufgabe, in der Auseinandersetzung mit den Sachen "die Sachkompetenz des Kindes zu erhöhen, die ihm die Meisterung der Dinge in der äußeren Natur ermöglicht" (S. 456). Gleichwohl ist der intelligent-sacheinsichtig handlungsfähige Mensch "als solcher noch nicht sozial-handlungsfähig". Er muss auch lernen - und dies möglichst gleichzeitig - seine Handlungen nach Maßstäben zu beurteilen, die als den Mitmenschen "Schaden zufügend" oder "Schaden von ihm wendend" bezeichnet werden können (S. 482). Andererseits sei erforderlich, dass der Handelnde über Sacheinsicht und Sachkompetenz verfügen können muss, um überhaupt sozialeinsichtig handeln zu können (S. 482).
Damit gibt sich ein gegenseitiges Fundierungsverhältnis der Kompetenzen, in dem der Sachkompetenz eine lernsequenziell grundlegende Funktion zukommt. Diese grundlegende Funktion, die der Sachkompetenz und damit dem Sach- und Fachwissen in diesem Ansatz zuteil wird, widerspricht Ansätzen, die einer funktionalen formalen Bildung zu neigen (Lehmsick 1926), in denen die Bedeutung der Wissensinhalte auf "Lernanlässe" reduziert werden (Brater 1997, S. 162).
Sie zeigt aber auch deutlich, dass ein Schlüsselqualifikationskonzept auf kompetenz-theoretisch-entwicklungspädagogischer Basis der Vorwurf inhaltsbeliebiger formaler Bildung nicht treffen kann, wobei auf die Lehmensicksche Unterscheidung zwischen funktionaler, kategorialer und methodischer Formalbildung und ihre transfertheoretischen Bedingungen und Möglichkeiten verwiesen sei (vgl. Reetz 1999). [/S. 46:]
Die Konzeptionierung von Schlüsselqualifikationen respektive -Kompetenzen als Persönlichkeitsbildung legt es also nahe, dem Gedanken der Persönlichkeitsentwicklung mehr Raum zu geben. Dabei wäre ein Entwicklungsbegriff ins Auge zu fassen, der nicht nur an der Kindheits- und Jugendphase als Zusammenfassung von biologischer Reifung und Lernen orientiert ist, sondern der in analoger Beziehung zum "Lebenslangen Lernen" gesehen wird.
Hierbei gewinnen neuere entwicklungspädagogische Ansätze (Aufenanger 1992; Bauer 1997; Garz 1999; Gruschka/ Kutscha 1983; Oser/ Gmünder 1988; Peukert 1979) und entwicklungspsychologische Theorien besondere Bedeutung. Dies gilt vor allem für strukturgenetische Ansätze im Anschluss an Piaget. Flammer (1988, S. 318) stellt bei der Sichtung solcher Entwicklungstheorien bzw. -Ansätze heraus, dass Handeln (Brandstedter 1985) und Problemlösen (Case 1985) zu den wichtigsten Entwicklungsbedingungen beim Aufbau von Kompetenzen gehören. Weiterhin zeigen Ansätze, die struktur- und soziogenetische Betrachtung und Forschung miteinander verbinden, dass insbesondere soziale Interaktionen konstitutiven Charakter für Entwicklung und entwicklungsbezogenes Lernen haben (Aufenager 1992; Doise 1978).
Dabei hat sich erwiesen, dass die Teilnahme an Sozialinteraktionen mit soziokognitiven Konflikten wichtige Bedingungen für die Herausbildung von Kompetenzen darstellen.
Die didaktischen Konsequenzen der Theorien und Befunde liegen in der Öffnung didaktischen Denkens und Handelns für Entwicklungsprozesse, die im Kontext von Sozialisationsprozessen als Prozesse des Lernens und Lehrens zu erforschen und als Bildungsprozesse zu konzipieren sind. Dabei sprechen die Befunde im starken Maße für didaktische Konzepte mit sozial-interaktiven handlungs- und problemorientierten komplexen Lehr-Lern-Arrangements (vgl. z. B. Achtenhagen/ John 1992; Tramm/ Rebmann 1997).
Evaluationen zeigen, dass die kognitiven, emotionalen und sozialen Kompetenzen sich messbar positiv entwickeln in Richtung der angestrebten Förderung der Persönlichkeit (Achtenhagen 1995). Möglicherweise könnte die Etablierung von "Entwicklungssequenzen", die nach strukturgenetischen Vorbild gestuft sind, den didaktischen Bezug zur Bildung im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung verstärken. Dabei können dann Lehr-/ Lern-Arrangements, die ein "Lernhandeln in komplexen Situationen" erlauben (Achtenhagen/John 1992), zunehmend "Entwicklungsaufgaben" (Havighurst 1948; Flammer 1988, S. 305 f.) integrieren, wie überhaupt Lehr-Lern-Prozesse über die Förderung beruflicher Handlungskompetenz hinaus "die personale Entwicklung der Individuen zu stützen und zu gewährleisten" haben (Achtenhagen 1994, S. 191). [/S. 47:]
Achtenhagen, F./ John, E.G. (1992): Mehrdimensionale Lehr-Lern-Arrangements. Innovationen in der kaufmännischen Aus- und Weiterbildung. Wiesbaden: Gabler.
Achtenhagen, F. (1994): Neue Lehr-Lern-Konzepte in der beruflich-kaufmännischen Erstausbildung und Weiterbildung - Ein Überblick. In: A. Kell & H. Schanz (Hrsg.): Computer und Berufsbildung (S. 185 - 197). Stuttgart: Holland u. Josenhans.
Achtenhagen, F. (1995): Zur Evaluation komplexer Lehr-Lern-Arrangements als neue Formen des Lehrens und Lernens in beruflichen Schulen. In: P. Gonon (Hrsg.): Evaluation in der Berufsbildung (S. 57 - 83). Aarau: Sauerländer.
Achtenhagen, F. (1996a): Entwicklung ökonomischer Kompetenz als Zielkategorie des Rechnungswesenunterrichts. In: P. Preiß & T. Tramm (Hrsg.): Rechnungswesenunterricht und ökonomisches Denken (S. 22 - 44). Wiesbaden: Gabler.
Achtenhagen, F. (1996b): Zur Operationalisierung von Schlüsselqualifikationen. In: P. Gonon (Hrsg.): Schlüsselqualifikationen kontrovers (S. 107 - 113). Aarau: Sauerländer.
Achtenhagen, F. & John, E. G. (1992) (Hrsg.): Mehrdimensionale Lehr-Lern- Arrangements. Wiesbaden: Gabler.
Antoni, M. (1992): Menschliche Arbeit: Grundbedürfnis oder fremdgesetzte Norm? Konsequenzen für die Personalentwicklung. In: H.-Chr. Riekhof (Hrsg.): Strategien der Personalentwicklung (S. 23 - 46). Wiesbaden: Gabler.
Arnold, R. (1994): Für eine Pädagogik des "Und" - Ein Plädoyer für Komplementarität in der Theoriediskussion zur Berufsbildung. In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 23 (1), 34 - 38.
Arnold, R. (1997): Von der Weiterbildung zur Kompetenzentwicklung. In: Kompetenzentwicklung '97 (S. 253 - 307). Münster: Waxmann.
Aufenanger, S. (1992): Entwicklungspädagogik. Die soziogenetische Perspektive. Weinheim.
Baethge, M. & Baethge-Kinsky, V. (1995): Die Entwicklung von Qualifikationsstruktur und qualitativem Arbeitsvermögen. In: R. Arnold & A. Lipsmeier (Hrsg.): Handbuch der Berufsbildung (S. 142 - 156). Opladen: Leske.
Baethge, M. & Oberbeck, H. (1986): Die Zukunft der Angestellten. Frankfurt a. M.: Campus.
Baethge, M. & Schiersmann, Ch. (1998): Prozeßorientierte Weiterbildung - Perspektiven und Probleme eines neuen Paradigmas der [/S. 47:] Kompetenzentwicklung für die Arbeitswelt und Zukunft. In Kompetenzentwicklung '98 (S. 15 - 87). Münster: Waxmann.
Baethge, M. & Schiersmann, Ch. (1999): Prozeßorientierte Weiterbildung - Anforderungen an "Lebensbegleitendes Lernen aus berufssoziologischer Sicht". Gutachten In: F. Achtenhagen & W. Lempert: Entwicklung eines Programmkonzeptes "Lebenslanges Lernen" für das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (Anhang 3.3). Göttingen, Berlin.
Bauer, W. (1997): Bildung unter den Bedingungen einer reflexiven Moderne. In: L. Koch, N. Marotzky & A. Schäfer (Hrsg.): Die Zukunft des Bildungsgedankens (S. 102 - 120). Weinheim.
Beck, K. (1996): "Berufsmoral" und "Betriebsmoral" - Didaktische Konzeptualisierungsprobleme einer berufsqualifizierenden Moralerziehung. In: K. Beck et.al. (Hrsg.): Berufserziehung im Umbruch (S. 125 - 142). Weinheim: Deutscher Studienverlag.
Beck, K. et.al. (1998): Die moralische Urteils- und Handlungskompetenz von kaufmännischen Lehrlingen - Entwicklungsbedingungen und ihre pädagogische Gestaltung. In: K. Beck & R. Dubs (Hrsg.): Kompetenzentwicklung in der Berufserziehung (S. 188 - 210). Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Beiheft 14. Stuttgart: Steiner.
Boehm, U. et.al. (1974): Qualifikationsstruktur und berufliche Curricula. Schriften zur Berufsbildungsforschung (Band 20). Hannover: Schroedel.
Boretty, U. et.al. (1988): PETRA. Projekt- und Transferorientierte Ausbildung. Berlin, München: Siemens.
Brandstätter, J. (1985): Entwicklungsbezogene Handlungsorientierungen und Emotionen im Erwachsenenalter. In: Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 17, S. 41 - 52.
Brater, M. (1997): Schule und Ausbildung im Zeichen der Individualisierung. In: U. Beck (Hrsg.): Kinder der Freiheit (3. Aufl.) (S. 149 - 174). Frankfurt a.M.
Buer, J. van & Matthäus, S. (1994): Kommunikative Alltagskultur in der beruflichen Erstausbildung - Ansprüche und Befunde. In: J. van Buer, S. Matthäus & D. Squarra (Hrsg.): Neuere Arbeiten aus der Wirtschaftspädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin (Studien Bd. 1.5) (S. 36 - 120). Humboldt- Universität Berlin.
Bunk, G. P. (1994): Kompetenzvermittlung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Deutschland. In: Kompetenz: Begriff und Fakten. Europäische Zeitschrift Berufsbildung, (1), S. 9 ff.
Case, R. (1984): The processes of stage transition: A neo-piagetian view. In: R.J. Stemberg (Hrsg.): Mechanism of cognitive development (S. 19 - 44). San Francisco.
Deutsche Forschungsgemeinschaft (1990): Berufsbildungsforschung an den Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland. Denkschrift. Weinheim.
Deutscher Bildungsrat (1974): Empfehlungen der Bildungskommission. Zur Neuordnung der Sekundarstufe II. Stuttgart.
Doerner, D. (1987): Problemlösen als Informationsverarbeitung. Stuttgart: Kohlhammer. [/S. 48:]
Doise, W. (1978): Soziale Interaktion und kognitive Entwicklung. In: G. Steiner (Hrsg.): Piaget und die Folgen (S. 331 - 347). Zürich.
Elbers, D. et al. (1975): Schlüsselqualifikationen - ein Schlüssel für die Berufsbildungsforschung? In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 4, (4), S. 26 - 29.
Erpenbeck, J. & Heyse, V. (1996): Berufliche Weiterbildung und berufliche Kompetenzentwicklung. In: Kompetenzentwicklung '96 (S. 15 - 152). Münster: Waxmann.
Flammer, A. (1988): Entwicklungstheorien. Bern.
Garz, D. (1999): Sozial psychologische Entwicklungstheorien. Opladen.
Geißler, H. (1994a): Grundlagen des Organisationslernens. Weinheim: Beltz.
Geißler, H. (1994b): Wie Betriebe und Schulen (nicht) lernen. In: J. Beiler, A.
Gerst, D. (1998): Selbstorganisierte Gruppenarbeit. Gestaltungschancen und Umsetzungsprobleme. Eschbom: RKW.
Gruschka, A. & Kutscha, G. (1983): Berufsorientierung als Entwicklungs-aufgabe der Berufsbildung - Thesen und Forschungsbefunde zur beruflichen Identitätsbildung und Kompetenzentwicklung in der Sekundarstufe II. In: Zeitschrift für Pädagogik, 29, S. 877 - 891.
Habermas, J. (1981): Theorie des kommunikativen Handelns (2 Bände). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Hammer, M. & Champy, J. (1994): Business Reengineering. Frankfurt a.M.: Campus.
Havighurst, R. J. (1948): Developmental task and Education. New York.
Jutzi, K. (1997): Schlüsselqualifikationen und betriebliches Ausbildungspersonal. Kiel: IPN.
Kath, F. M. (1990): Schlüsselqualifikationen - Vorwärts in die Vergangenheit? In: L. Reetz & Th. Reitmann (Hrsg.): Schlüsselqualifikationen (S. 101 - 111). Hamburg: Feldhaus.
Kern, H. & Schumann, M. (1984): Das Ende der Arbeitsteilung? - Rationalisierung in der industriellen Produktion. München: Beck.
Koch, L., Marotzki, W. & Schäfer, A. (1997) (Hrsg.): Die Zukunft des Bildungsgedankens. Weinheim: Dt. Studienverlag.
Laukamm, Th. (1992): Strategisches Management von Human-Ressourcen. In: H.-Chr. Riekhof (Hrsg.): Strategien der Personalentwicklung (S. 77 - 119). Wiesbaden: Gabler.
Lehmensick, E. (1926): Die Theorie der formalen Bildung. Göttingen 1926.
Litzenberg, G. & Tripp, W. (1987): Methoden zur Förderung von Schlüsselqualifikationen. Berufliche Bildung und Innovation. Jahrestagung 1987 der kaufmännischen Ausbildungsleiter (S. 18 - 20). Bonn: Kuratorium der deutschen Wirtschaft für Berufsbildung. [/S. 49:]
Lumpe & L. Reetz (Hrsg.)(1994): Schlüsselqualifikation - Selbstorganisation - Lernorganisation (S. 96 - 121). Hamburg: Feldhaus.
Lumpe, A. & Wagner, M. (1997): Business-Process-Reengineering - organisatorischer Quantensprung im Unternehmen - auch in der Schule? In: J. Heiler, A. Lumpe & L. Reetz (Hrsg.): It's time for team (S. 111 - 146). Hamburg: Feldhaus.
Mertens, D.: Schlüsselqualifikationen (1974): Mitteilungen der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 7, S. 36 - 73.
Meyer, H. L. (1975): Trainingsprogramm zur Lernzielanalyse. Frankfurt a.M.: Fischer.
Oser, F. & Althoff, W. (1992): Moralische Selbstbestimmung. Stuttgart: Klett.
Peukert, U. (1979): Interaktive Kompetenz und Identität. Zum Vorrang sozialen Lernens im Vorschulalter. Düsseldorf.
Pfeiffer, W. & Weiß, E. (1994): Lean Management. Berlin: Schmidt.
Reetz, L. (1976): Beruf und Wissenschaft als organisierende Prinzipien des Wirtschaftslehre-Curriculums. In: Die Deutsche Berufs- und Fachschule, (11), S. 803 - 818.
Reetz, L. (1989): Zum Konzept der Schlüsselqualifikationen in der Berufsbildung, Teil 1 und 2. In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, (5), S. 3 - 10 und (6), S. 24 - 30.
Reetz, L. (1990): Zur Bedeutung der Schlüsselqualifikationen in der Berufsbildung. In: L. Reetz & Th. Reitmann (Hrsg.): Schlüsselqualifikationen (S. 16 - 35). Hamburg: Feldhaus.
Reetz, L. (1993): Personalentwicklung als Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung. Zur Rolle der Schlüsselqualifikationen im Betrieb. In: F. Ilse (Hrsg.): Berufliche Weiterbildung im Spannungsfeld von Theorie und Praxis (S. 85 - 96). Hamburg.
Reetz, L. (1999): Schlüsselqualifikationen aus bildungstheoretischer Sicht in der berufs- und wirtschaftspädagogischen Diskussion. In: R. Arnold & H. J. Müller (Hrsg.): Kompetenzentwicklung durch Schlüsselqualifikationsförderung. Hohengehren: Schneider.
Reisse, W. (1997): Schlüsselqualifikationen und kaufmännische Prüfungen. In: J. U. Schmidt (Hrsg.): Kaufmännische Prüfungsaufgaben - handlungsorientiert und komplex!? Bielefeld: Bundesinstitut für Berufsbildung.
Riekhof, H.-Chr. (1992). (Hrsg.): Strategien der Personalentwicklung. Wies- baden: Gabler.
Roth, H. (1966): Pädagogische Anthropologie. Band 1: Bildsamkeit und Bestimmung. Hannover.
Roth, H. (1971): Pädagogische Anthropologie. Band 2: Entwicklung und Erziehung. Hannover.
Sattelberger, Th. (1991). (Hrsg.): Innovative Personalentwicklung. Wiesbaden: Gabler.
Schopf, M. (1992). (Hrsg.): Schlüsselqualifikationen für Kaufleute im Einzelhandel. 1. Zwischenbericht des Modellversuchs. Hamburg: Amt für Schule. [/S. 50:]
Schumann, M. & Gerst, D. (1996): Innovative Arbeitspolitik - ein Fallbeispiel. Gruppenarbeit in der Mercedes Benz-AG. SOFI - Mitteilungen, 24, S. 35 - 52.
Stiller, I. (1998): Schlüsselqualifikationen - Neuordnung/ Ordnungsmittel. In: E. Wittmann & J. van Buer (Hrsg.): Schlüsselqualifikationen zwischen bildungspolitischem Anspruch, wissenschaflicher Grundlegung und wissenschaftsadäquater Umsetzung (Studien Bd. 18) (S. 5 - 15). Humboldt-Universität Berlin.
Tramm, T. & Rebmann, K. (1997): Handlungsorientiertes Lernen in und an komplexen, dynamischen Modellen - Die Modellierungsperspektive als notwendige Ergänzung des handlungsorientierten Ansatzes in der Wirtschaftsdidaktik. In: G. Lübke & B. Riesebieter (Hrsg.): Zur Theorie und Praxis des SIMBA-Einsatzes in der kaufmännischen Aus- und Weiterbildung (S. 1 - 38). Markhausen.
Ulrich, P. (1996) (Hrsg.): Ethik in Wirtschaft und Gesellschaft. Aarau: Sauerländer.
Witt, R. (1975): Sachkompetenz und Wissensstruktur. Dissertation, Hamburg.
Wittmann, E. (1998): Qualität betrieblicher Ausbildung und die Schlüsselqualifikation "kommunikative Kompetenz". In: E. Wittmann & J. van Buer (Hrsg.): Schlüsselqualifikationen zwischen bildungspolitischem Anspruch, wissenschaftlicher Grundlegung und wissenschaftsadäquater Umsetzung (Studien Bd. 18) (S. 17 - 47). Humboldt-Universität Berlin.
Zabeck, J. (1989): "Schlüsselqualifikationen" - zur Kritik einer didaktischen Zielformel. In: Wirtschaft und Erziehung, 41, S. 77 - 86.
Zabeck, J. (1991): Ethische Dimensionen der "Wirtschaftserziehung". In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 87, S. 534 - 564.
In: Duismann, G. H./ Oberliesen, R. (Hrsg.): Arbeitsorientierte Bildung 2010. Hohengehren 1995, S. 99 - 119.
In den Diskussionen um zukünftige Anforderungen an Fachkräfte unterschiedlicher Berufsbereiche sind seit einigen Jahren Veränderungen im Qualifikationsverständnis zu verzeichnen. Gefordert werden breitere fachliche Qualifikationen und zusätzliche Kompetenzen, die zumeist unter dem Begriff "Schlüsselqualifikationen" zusammengefasst werden. Als Leitbilder erscheinen zunehmend FacharbeiterInnen und Fachangestellte, die Zusammenhänge verstehen, auf nicht vorherbestimmbare Situationen kompetent reagieren, kommunikations- und kooperationsfähig sind, Entscheidungen treffen, Kritik üben und sich nach Maßgabe wechselnder Anforderungen weiterbilden und spezialisieren.
Hintergrund veränderter Qualifikationsanforderungen ist der Strukturwandel in Produktion, Verwaltung und Dienstleistung. Neue Informations- und Kommunikationstechnologien, veränderte Marktbedingungen und neue bzw. wiederentdeckte Formen der Organisations- und Arbeitsgestaltung führen zumindest in einigen Bereichen des Beschäftigungssystems zu einem veränderten Stellenwert der verbleibenden menschlichen Arbeit. Dieser Wandel wird in wissenschaftlichen und arbeitspolitischen Diskussionen unter Formeln wie "neue Produktionskonzepte", "systemische Rationalisierung", "Organisationsentwicklung" und mittlerweile auch "Lean-Production" gefasst (1). Sie repräsentieren die Abkehr von einer Sichtweise, in der Produktion und Verwaltung durch fortschreitenden Technikeinsatz voll automatisiert und von menschlicher Arbeitsleistung weitgehend "befreit" sein werden. Obwohl durch die Technisierung weiterhin Arbeitsplätze verloren gehen, wurde vielfach - gerade mit der Verbreitung der IuK-Technik und durch erhöhte Anforderungen an die Flexibilität der Unternehmen - deutlich, dass personengebundene Kompetenzen der Beschäftigten für den Arbeitsprozess unerlässlich sind.
Auffällig ist, dass die Etiketten, mit denen der Wandel der Qualifikationsanforderungen vor allem in der Wirtschaftspublizistik aber auch - mit größerer Zurückhaltung - in den wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen belegt wird, vielfach den Zielen einer Bildungsreform ähneln, die an gesellschaftlichen Widerständen, institutionellem Beharrungsvermögen und bürokratischen Hemmnissen weitgehend gescheitert ist. Viele Anforderungen, die heute an Arbeitskräfte gestellt werden, weisen hohe Affinitäten zu Idealen der Bildungsreform auf: Selbstständigkeit, Denken in Zusammenhängen, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit und - in der Debatte seltener benannt - die Kritikfähigkeit.
Die veränderten Qualifikationsanforderungen schlagen sich auch in einer Neuorientierung der Berufsausbildung nieder. Seit der Neuordnung der industriellen Metall und Elektroberufe, die 1987 in Kraft trat, wird in neuen Ausbildungsordnungen die Anforderung gestellt, dass die Auszubildenden zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit befähigt werden, die "insbesondere selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren einschließt". Facharbeits und Fachangestelltenberufe werden nicht mehr als ausschließlich ausführende Berufe auf der Basis eines Kanons von fachlichen Kenntnissen und Fähigkeiten aufgefasst, sondern als Berufe, die ein relativ hohes, wenn auch in den Ausbildungsordnungen nicht näher präzisiertes Maß an Selbstständigkeit erfordern. Eine Konkretisierung und Umsetzung wird jedoch seit einigen Jahren im Rahmen von Modellversuchen in der Berufsausbildung verfolgt, die zentral auf die Förderung von Schlüsselqualifikationen zielen. Die hier angewandten Methoden, Sozial- und Organisationsformen des Lernens weisen ihrerseits eine relative Nähe zur schulischen Reformdiskussion auf. Dies gilt in besonders hohem Maße für die Projektmethode, die in einigen Betrieben zum Eckpfeiler der Ausbildung geworden ist.
Die Veränderungen der Anforderungsprofile und einer in ersten Ansätzen darauf bezogenen Ausbildung haben in den letzten Jahren zu einer Neubewertung des Verhältnisses von Bildung, Arbeit und speziell der Berufsausbildung geführt. Wurden von kritischen PädagogInnen und SoziologInnen - durchaus im Einklang mit der traditionellen Pädagogik - seit Ende der 60er Jahre vornehmlich die Vereinseitigungen und Restriktionen der Berufsausbildung im Hinblick auf die Persönlichkeitsentwicklung behandelt und kritisiert (in der Berufsausbildung geht es darum, die "Lernenden in eine vorgegebene Norm einzupassen"; Brater 1987: 122), so ist in den letzten Jahren ein deutlicher Perspektivenwechsel festzustellen. Für viele BeobachterInnen mit einem vormals kritisch-distanzierten Verhältnis zu den Entwicklungstendenzen der Erwerbsarbeit und zur betrieblichen Berufsausbildung
Diese Einschätzungen beziehen sich allerdings auf eine gerade erst einsetzende Entwicklung zu veränderten Qualifikationsanforderungen und neuen Konzepten der Berufsausbildung. Die dominante betriebliche Praxis in Ausbildung und Beruf bleibt hinter den neuen Leitbildern deutlich zurück (2). Dementsprechend geht es den zitierten Autoren vor allem um die Identifikation von Chancen für eine Annäherung von Bildung, Ausbildung und Beruf und um die Entwicklung einer Bildungs- und Ausbildungspolitik, die geeignet sein könnte, eine solche Annäherung zu fördern. Der Blick auf positive Ansätze wird daher in der Regel mit Hinweisen auf den vorläufigen Charakter von Überlegungen und auf neue Risiken ergänzt. Zu befürchten sind unter anderem eine verschärfte Segmentierung und Spaltung beruflicher Perspektiven zu Lasten von Problemgruppen am Arbeitsmarkt sowie Tendenzen, Bildung für betriebs- und volkswirtschaftliche Anforderungen zu funktionalisieren. Darüber hinaus ist in Rechnung zu stellen, dass Schlüsselqualifikationen im betrieblichen Kontext mit anderen Verhaltenserwartungen verbunden sein können, als in bildungspolitischen Reformansätzen. Prinzipiell liegt hier die Vermutung nahe, dass der Gebrauch von Schlüsselqualifikationen in vielen Betrieben seine Grenze in der Befolgung betrieblicher Normen findet, die prinzipiell nicht hinterfragt und reflexiv gehandhabt werden dürfen. Eine derartige Verkürzung ließe eine kritische Abgrenzung schulischer Lernprozesse von betrieblichen Erwartungen an Schlüsselqualifikationen notwendig erscheinen.
Die derzeitige Praxis in den Schulen rechtfertigt jedoch die Annahme, dass die Unterrichtspraxis in den Schulen noch hinter einem funktional verkürzten Begriff von Schlüsselqualifikationen zurückbleibt. Der Wandel im Beschäftigungssystem trifft auf ein Bildungssystem, das in vielen Strukturelementen eher dem überkommenen tayloristischen Arbeitsteilungsprinzip entspricht als den - bislang noch minoritären - ganzheitlicheren und kooperativen Aufgabenzuschnitten in der Erwerbsarbeit. Zentrale Qualifikationsanforderungen und die Ziele der reformierten Ausbildung stehen in offensichtlichem Widerspruch zu einem schulischen Lernen, das zu drei Vierteln unter die Kategorie "Frontalunterricht" subsumiert werden muss (Hage u. a. 1985: 149), in dem Kooperation in der Klasse, in der Gruppe oder mit PartnerInnen nur einen untergeordneten Stellenwert besitzt, in dem selbstständige SchülerInnentätigkeit marginal ist (vgl. ebd., 47), Hierarchien festgeschrieben sind und Unterrichtsinhalte zentral festgelegt werden. Hier drängt sich fast zwangsläufig die These auf, dass die veränderten Rahmenbedingungen der Erwerbsarbeit inhaltliche, methodische und organisatorische Veränderungen in den Schulen erfordern.
Die weitere Verfolgung dieser These zwingt jedoch vorab zu einigen Klarstellungen zum Verhältnis von Bildungssystem und Beschäftigungssystem. Im Unterschied zu einem für die GEW in Nordrhein-Westfalen von den Politikwissenschaftlern Lehner und Widmaier erstellten Gutachten wird dieses Verhältnis hier nicht als einseitige Subordination der Bildung unter ökonomische Anforderungen einer "modernen Industriegesellschaft" (vgl. Lehner/Widmaier 1992) gefasst (3). Ich gehe demgegenüber von einem eigenständigen Bildungsauftrag der Schulen aus, der sich auf die Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schülern richtet. Eine Berücksichtigung ökonomisch begründeter Anforderungen ist zwar mit Blick auf individuelle und gesellschaftliche Reproduktionsinteressen erforderlich. Sie müssen allerdings im Bildungssystem selbst unter Berücksichtigung (fach-)wissenschaftlicher, (fach-)didaktischer und politischer Kriterien und Diskussionen selektiert und gewichtet werden. Sie sind nicht unreflektiert und unmittelbar aus Forderungen "der" Wirtschaft abzuleiten - zumal dort auch sehr unterschiedliche Positionen vertreten werden. Gleichzeitig und gleichgewichtig müssen in bildungspolitischen Reformkonzeptionen zudem ökologische, psychologische, kulturelle und politische Modernisierungsrisiken in den Blick genommen werden (vgl. Jacke/Simoleit/Lemmermöhle-Thüsing/Feldhoff 1993). Reformkonzeptionen, die diese Anforderungen aufnehmen, werden sich nicht darin erschöpfen, wesentliche Prinzipien einer modernisierten Produktion auf die Schule zu übertragen (vgl. Lehner/Widmaier 1992: 151 ff.) oder - wie in der Diskussion über Krise und Autonomie der Schulen gelegentlich anzutreffen - einer neuartigen Angleichung der Schule an neoliberale Leitbilder das Wort zu reden.
Die Beschäftigung mit dem Wandel der Qualifikationsanforderungen und den möglichen Konsequenzen für Bildung und Bildungspolitik scheint einem Dilemma unterworfen, das sich in besonderer Weise an der Diskussion um das Gutachten von Lehner/Widmaier zeigt. Obwohl seit einigen Jahren gerade auch aus den Reihen der IndustriesoziologInnen Vorstöße zu einer Neubewertung im Verhältnis von Arbeit und Bildung unternommen wurden, kam eine größere Debatte erst in Gang, als besagtes Gutachten in der Öffentlichkeit bekannt wurde. Die veränderten Qualifikationsanforderungen werden allem Anschein nach erst dann in breiteren bildungspolitischen Diskussionen wirksam, wenn sie mit der Behauptung eines scharfen Entwicklungsbruches, einer eindeutigen ökonomischen Logik und der Androhung einer weitgehenden Reorganisation im Bildungssystem verknüpft werden. Weniger apodiktische und deterministische Sichtweisen werden demgegenüber eher selten aufgegriffen, obwohl sie in der Regel weit höhere Gestaltungsmöglichkeiten für die Akteure im Bildungssystem selbst beinhalten und das Risiko einer Funktionalisierung von Bildung hier entsprechend geringer anzusetzen ist. Obwohl zu erwarten ist, dass die folgenden Ausführungen entgegen der Intention PädagogInnen und BildungspolitikerInnen von Handlungsdruck entlasten, werde ich die fehlende Eindeutigkeit zukünftiger Qualifikationsanforderungen herausstellen. Die Konsequenz besteht aber weder in einer Schule nach dem Prinzip "anything goes" noch in einer Fortführung der bisherigen Praxis. Es geht vielmehr darum, gerade diese Unsicherheiten für eine Bildungsreform zu nutzen, die sich nicht darauf beschränkt, das Beschäftigungssystem mit einem anforderungsgerechten Qualifikationspotenzial zu versorgen, sondern u. a. darauf zielt, die positiven Ansätze zu einer ganzheitlicheren Arbeitsorganisation mit höheren Autonomiespielräumen für alle Beschäftigten aktiv zu fördern.
Schon der Blick auf die industriesoziologische Forschung der letzten zehn Jahre reicht aus, um der Vorstellung eindeutiger und unmittelbar operationalisierbarer Anforderungen des Beschäftigungssystems an die Qualifikationen der zukünftig Beschäftigten infrage zu stellen. Zwar identifizierten Kern/Schumann 1984 in "Das Ende der Arbeitsteilung?" ein neues Rationalisierungsparadigma, das eine Abkehr von restriktiver Arbeitsgestaltung zugunsten ganzheitlicherer Aufgabenzuschnitte signalisierte, empirisch nachweisbar waren "Neue Produktionskonzepte" jedoch nur in einigen industriellen Kernsektoren (Automobilindustrie, Werkzeugmaschinenbau und Chemische Industrie) und zeigten sich auch dort keineswegs an allen Arbeitsplätzen. Dem stehen Industrien gegenüber, in denen sich zumindest kein umfassender Paradigmenwechsel, sondern bestenfalls Mischformen zwischen überkommenen und neuen Produktionskonzepten abzeichneten. In die Betrachtung einbezogen wurde zudem das wachsende Heer der Arbeitslosen, deren (Re)-Integration in das Beschäftigungssystem sich gerade bei ganzheitlichen Aufgabenzuschnitten immer schwieriger gestalten werde. Entsprechend der differenzierten Sicht unterschieden Kern/Schumann zwischen Rationalisierungsgewinnern, -duldern und -verlierern. Lässt schon diese Unterscheidung erahnen, dass sich daraus kaum eindeutige Konsequenzen für das Bildungssystem ableiten lassen, so wird diese Schwierigkeit mit Blick auf die inhaltlichen Bestimmungen neuer Produktionskonzepte noch deutlicher. Zwar ist relativ klar zu beschreiben, dass eine Arbeitsorganisation mit überwiegend restriktiver Arbeitsorganisation unter den veränderten Bedingungen von Markt, Technik und Organisation in wesentlichen Bereichen des Beschäftigungssystems nicht mehr trägt, die Konkretisierung neuer Produktionskonzepte und der damit einhergehenden Qualifikationsanforderungen ist schon bei Kern/Schumann weniger präzise. Die diesbezüglichen Unsicherheiten sind in den nachfolgenden Kontroversen und in anderen Untersuchungen eher noch größer geworden. Auch Schumann u. a. relativieren nach gut zehn Jahren ihren vorsichtigen Optimismus noch einmal: "Was sich vor zehn Jahren in den ersten Spurenelementen andeutete und in eine klare Richtung zu drängen schien, erweist sich als eine in vielen Bereichen höchst zähflüssige, weit verästelte, auch gegenläufige Entwicklung, die nur in einigen Strängen halbwegs verlässlich, in anderen allenfalls höchst vorläufig zu antizipieren ist" (Schumann u. a. 1994: 11).
Gegen diese nüchterne und differenzierte Betrachtung, die sich in fast allen industriesoziologischen Untersuchungen der letzten Jahre zeigt, steht der ungebrochene Fortschrittsoptimismus von Lehner/Widmaier. Auch sie gehen zunächst von verschiedenen Entwicklungsalternativen aus. Einer zentralistischen, automatisierten Massenproduktion mit geringen Qualifikationsanforderungen und restriktiven Arbeitsbedingungen werden "anthropozentrische Produktionssysteme" gegenübergestellt, die durch hohe Autonomiespielräume, flache Hierarchien, die "Delegation von Planungs-, Steuerungs- und Kontrollfunktionen", "stark reduzierte Arbeitsteilung" und eine kontinuierliche Weiterbildung der Beschäftigten gekennzeichnet sind (Lehner/Widmaier 1992: 57 f.). Die Gutachter lassen keine Zweifel daran, dass der "anthropozentrische Pfad" ökonomisch und sozial gleichermaßen wünschenswert und rational ist. Trotz dieser Eindeutigkeit müssen sie jedoch einräumen, dass entsprechende Produktionssysteme - sie sprechen hier von einem "Diffusions-Paradox" - bislang noch minoritär sind (vgl. ebd.: 53 u. 63 f.). Das "Diffusions-Paradox" wird allerdings nicht aufgelöst, d. h. auf seine Ursachen und Dauerhaftigkeit überprüft. Die Gutachter scheinen sich darauf zu verlassen, dass sich auch in den Unternehmen die "rationale" Variante durchsetzt. Zum zentralen Hebel der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung wird das Bildungssystem. In der bildungsökonomischen Optik des Gutachtens besteht das Grundproblem darin, den "Output" des Bildungssystems so zu organisieren, dass dem "raschen und weitreichenden wirtschaftlichen und sozialen Wandel" (Lehner/Widmaier 1992, S. 2) "Humanressourcen" zur Verfügung gestellt werden. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, ihre ökologische Erneuerung und die Zukunftssicherung individueller beruflicher Chancen sind danach zentral an die Qualifikationen und die schulische Bildung der zukünftig Beschäftigten gekoppelt. Dabei unterbleiben - neben einer komplexeren gesellschaftlichen Funktionsbestimmung von Bildung - die Berücksichtigung möglicher negativer Begleiterscheinungen "anthropozentrischer Produktionssysteme" und Überlegungen zu den Aufgaben des Bildungssystems unter den Bedingungen des "Diffusions-Paradoxes".
In der industriesoziologischen Diskussion wird demgegenüber seit langem auf die (möglichen) negativen Effekte neuer Arbeitseinsatzkonzepte hingewiesen. Dazu gehören
Es liegt auf der Hand, dass Individuen, die in ihrer Arbeitssituation mit solchen Effekten konfrontiert werden, über Qualifikationen und Kompetenzen verfügen müssen, die sich nicht in Begriffen wie "Lernfähigkeit", "Flexibilität" und "Mobilität" erschöpfen. Auch die Konkretisierung der von den Gutachtern geforderten Kompetenzen wie "Problemlösungsfähigkeit, Teamwork, Lernfähigkeit" erfährt ganz andere Akzente. Sie fügen sich unter diesen Bedingungen nicht nahtlos in einen modernisierten Produktionsprozess, sondern wenden sich ggf. kritisch dagegen.
Die Notwendigkeit kritischer, (arbeits)-politischer Aktivitäten im Betrieb, die bei Lehner/Widmaier ebenso unberücksichtigt bleibt, wie in vielen öffentlichen Bekundungen zur Bedeutung von Schlüsselqualifikationen, wird unabdingbar, wenn das konstatierte "Diffusions-Paradox" bestehen bleibt. Ein Fortbestehen überkommener und restriktiver Arbeitseinsatzkonzepte gegen die ökonomische und soziale Rationalität erfordert kein beliebig abrufbares Verhaltensrepertoire oder einseitige Anpassungsleistungen an den Strukturwandel. Gefordert ist eine Handlungskompetenz, die ausgehend von einem Bewusstsein der (durchaus begrenzten) Veränderbarkeit betrieblicher Strukturen und einer gehörigen Frustrationstoleranz in den Fähigkeiten zum Erkennen und Nutzen von Gestaltungsoptionen, Regelungs- und Kontrolllücken sowie zum Erkennen, Artikulieren, Verhandeln und Durchsetzen individueller und kollektiver Interessen besteht. In dieser Perspektive hängt die zukünftige Arbeitsteilungsstruktur in den Betrieben und dadurch vermittelt auch der ökonomische Strukturwandel u. a. von der Fähigkeit der Beschäftigten ab, initiativ zu werden und einen Beitrag zur Veränderung traditioneller betrieblicher Strukturen zu leisten.
Besonders zu beachten sind in diesem Zusammenhang die strukturellen Barrieren, die bislang dafür verantwortlich sind, dass sich neue Arbeitsteilungsstrukturen trotz vielfach (plausibel) behaupteter Vorteile für die Effizienz von Unternehmen und eine gleichzeitig humanere Arbeit nur zögerlich durchsetzen. Es existiert offenbar keine eindeutige Logik, die zu einer umfassenderen Nutzung von Qualifikationen der Beschäftigten, flacheren betrieblichen Hierarchien und teilautonomer Gruppenarbeit führen muss oder - unter der Voraussetzung rationaler Managemententscheidungen und gleichermaßen rationaler bildungspolitischer Weichenstellungen - führen müsste. Der Betrieb kann nicht als Organisation aufgefasst werden, in der sich "Systemzwänge" oder "Rationalitäten" - seien sie technologischer oder ökonomischer Art - ungebrochen durchsetzen, sondern als ein Handlungsfeld, das bestimmt oder beeinflusst ist durch Interessen, Handlungen und Handlungspotenziale betrieblicher Akteure, durch die vorhandene Arbeitsorganisation und Qualifikationsstruktur, durch arbeitsrechtliche und tarifvertragliche Regelungen, durch die bereits vorhandenen Technologien, durch "paradigmatische Nutzungslinien" (Rolf 1989: 140) neuer Technologien sowie durch die ökonomischen Voraussetzungen, in die auch wirtschafts-, sozial- und technologiepolitische Entscheidungen eingehen.
Auswirkungen von Bildung auf den Strukturwandel der Arbeit
Mit der Berücksichtigung komplexerer Wechselwirkungen relativiert sich zunächst die Bedeutung von Bildungsprozessen für den Strukturwandel der Arbeit. Vor dem Hintergrund der vielfältigen Faktoren, die auf die betrieblichen Umstrukturierungsprozesse einwirken, ist festzustellen, dass der Einfluss bildungspolitischer Weichenstellungen auf die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung und auf die Arbeitsorganisation in den Betrieben nur sehr vermittelt sein kann. Die Durchsetzung von Arbeitseinsatzkonzepten, die zugleich eine höhere Effizienz und eine humanere Arbeit ermöglichen, hängt nicht ausschließlich von den Qualifikationen und Kompetenzen der Beschäftigten und den Vorleistungen der Schulen ab. Aus einer Perspektive, die Bildungspolitik auch als Gesellschaftspolitik begreift, stellt sich dennoch die Frage, welches Bildungskonzept einen aktiven Beitrag dazu leisten kann, "die sich heute - und zwar vermutlich nur für eine begrenzte Zeit - eröffnenden Chancen zu nutzen, neue, gleichzeitig effiziente und mit den grundlegenden Werten unserer Gesellschaft in Einklang stehende Formen von Arbeit und Zusammenarbeit zu entwickeln" (Lutz 1988: 64).
Theoretische Ansätze, die unter Rückgriff auf Ableitungs- oder Abbildungsmodelle Reformvorschläge für das Bildungssystem aus Strukturen und Prozessen des Beschäftigungssystems herleiten, verfehlen hier nicht nur komplexere gesellschaftliche Anforderungen an Bildung. Sie greifen auch - zumal wenn sie die Ergebnisse von Bildungsprozessen noch weiter auf beliebig abrufbare Qualifikationen verkürzen - ökonomisch zu kurz. Beispielhaft für einen derartigen Zugriff ist eine perspektivische Verengung auf Mobilitäts- und Flexibilitätsanforderungen an die Beschäftigten. Bildung wird damit auf eine Zulieferfunktion für gesetzte Anforderungen der Arbeitswelt und damit auf eine reaktive Funktion reduziert. Aktiv gestalterische Elemente bleiben dabei unberücksichtigt (4).
Die ökonomische Überhöhung von Bildung bei gleichzeitiger Verkürzung auf die Zulieferfunktionen hat nicht nur - bei Forderungen nach mehr, weniger oder effizienterer Bildung - unmittelbare Folgen für das Bildungssystem, sondern wirkt indirekt auf das Beschäftigungssystem zurück. Obwohl Bildung und Bildungspolitik nur vermittelt auf betriebliche Prozesse und Strukturen wirken, sind vielschichtige Interdependenzbeziehungen zwischen dem Bildungs- und dem Beschäftigungssystem wirksam (5). Ich werde im folgenden zwei Aspekte herausgreifen, an denen deutlich wird, dass sich Prozesse im Bildungssystem auf das Beschäftigungssystem auswirken und in denen dem Bildungssystem zugleich eine aktive Rolle zukommt. Es geht zum einen um die Nachfrage und Nutzung von Qualifikationen im Beschäftigungssystem in Reaktion auf das Qualifikationsangebot am Ausbildungsstellenmarkt und zum anderen um betriebliche Konsequenzen aus veränderten arbeitsbezogenen Wertvorstellungen in der jungen Generation, die u. a. als Folge schulischer Sozialisation anzusehen sind. Die Frage, ob höhere Qualifikationsanforderungen exklusiv an eine ArbeiterInnen- und Angestelltenelite oder auf breiter Ebene gestellt werden, lässt sich vor diesem Hintergrund auch als eine bildungspolitische Frage begreifen. Der zukünftige Qualifikationsbedarf im Beschäftigungssystem ist nicht von der Struktur des Bildungssystems und den darin praktizierten Organisationsformen, Inhalten, Methoden und Sozialformen des Lernens abzukoppeln. Dies gilt vor allem im Hinblick auf die hierarchische Struktur der Qualifikationsanforderungen und der Arbeitsorganisation.
Hinweise darauf, dass das Qualifikationsangebot des Bildungssystems durchaus Einfluss auf die Arbeitsorganisation und d. h. auch auf die weitere Qualifikationsnachfrage durch das Beschäftigungssystem hat, enthalten seit den 70er Jahren die Arbeiten von Burkhart Lutz. Im deutsch - französischen Vergleich stellte er einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Arbeitsorganisation in den Betrieben und der Struktur des Bildungssystems fest. Ein Fazit der empirischen Untersuchungen und der daraus abgeleiteten Interdependenzthese ist, dass "jegliche Form vertikaler - bildungshierarchischer - Differenzierung von Bildungsgängen über kurz oder lang in Form vertiefter vertikaler Arbeitsteilung und infolgedessen Vergrößerung von Ungleichheit der Berufs- und Lebenschancen ins Beschäftigungssystem durchschlägt" (Lutz 1976: 150). Entgegen üblichen Argumentationsmustern wird hier die empirisch und theoretisch untermauerte Auffassung vertreten, dass das Beschäftigungssystem auf die Angebotsstruktur des Bildungssystems reagiert und sie in der Folgezeit durch eine entsprechende Qualifikationsnachfrage stützt (6). Diese lange Zeit umstrittene Sicht wurde in den folgenden Jahren durch einige industriesoziologische Studien empirisch gestützt. So stellten Baethge u. a. schon 1980 fest, dass die Betriebe zunehmend dazu übergingen, "die Abiturienten in die 'normale' Lehre mit hineinzunehmen, aber ihr spezifisches Leistungsvermögen zur Differenzierung und Hierarchisierung von praktischen Ausbildungsgängen zu nutzen" (Baethge u. a. 1980: 341). Der Einsatz von Abiturienten wurde dabei nicht mit gestiegenen Qualifikationsanforderungen besonders begründet (vgl. ebd.: 342). Es handelte sich hier offenbar um einen Mitnahmeeffekt, der jedoch eine "zunehmende Differenzierung der Hierarchie-Ebenen" (ebd.: 343) möglich erscheinen lässt und der in der Folgezeit auch entsprechend zu einer "Differenzierung der Ausbildungsgänge" nach Maßgabe des Qualifikationsangebotes am Ausbildungsstellenmarkt genutzt wurde (Baethge/Oberbeck 1986: 334). Das Qualifikationsangebot und darauf reagierende betriebliche Rekrutierungsstrategien generieren so einerseits eine dauerhafte Nachfrage nach höheren Schulabschlüssen in bestimmten, besonders angesehenen Berufen (insbes. bei Bank-, Versicherungs- und Industriekaufleuten) und führen andererseits zu einer vertieften hierarchischen Differenzierung von Ausbildungsberufen.
Die Einflüsse des Qualifikationsangebotes auf das Beschäftigungssystem beschränken sich jedoch nicht auf personalpolitische Rekrutierungsstrategien und eine darüber vermittelte Nachfrage nach höheren Abschlüssen. Folgt man einem Erklärungsmuster, dass insbesondere in einigen Arbeiten aus dem Soziologischen Forschungsinstitut in Göttingen (SOFI) vertreten wird, entfalten die durch das Bildungssystem mitgeprägten Kompetenzen und Orientierungen der Beschäftigten im Rahmen innerbetrieblicher Reorganisationsprozesse ein arbeitspolitisches Gewicht. Danach bringen Jugendliche beim Eintritt in die Arbeitswelt "stärker entfaltete und gefestigte Ansprüche mit, die sie auch in der Arbeit geltend machen" (Voskamp/Wittke 1992: 31). Die höheren Ansprüche resultieren - so Baethge - in erheblichem Maße aus der Bildungsexpansion. Das längere Verweilen im Bildungssystem "fördert individualistische Identitätsbildungsmuster und führt auch zur emotionalen Stabilisierung des 'Eigensinns' der Subjekte" (Baethge 1991: 12). Baethge und Voskamp/Wittke gehen davon aus, dass die steigenden Ansprüche an die Qualität der Arbeit ein Maß erreicht haben, das die Betriebe zur Reaktion drängt (7). Hintergrund ist die in vielen Arbeitsbereichen zunehmende Notwendigkeit einer Identifikation mit der Tätigkeit und einer Intentionalität der Aufgabenerfüllung. Die zunehmende Bedeutung subjektgebundener Tätigkeiten im Kontext neuer Rationalisierungsstrategien verbietet die rigide Missachtung von arbeitsbezogenen Ansprüchen der Beschäftigten und erfordert stattdessen zu einem gewissen Grade ihre Berücksichtigung durch "Zugeständnisse an Eigenverantwortlichkeit, Kompetenz und Status" durch die Unternehmen (Baethge 1991: 13).
Neben solchen Anpassungsreaktionen der Betriebe muss zusätzlich eine weitere und direktere Wirkung der Arbeitsorientierungen von Beschäftigten auf die Arbeitsorganisation in Rechnung gestellt werden. Mit der Verabschiedung vermeintlicher Logiken und Determinismen in der Industriesoziologie sind in den letzten Jahren die Handlungsspielräume betrieblicher Akteure immer wieder in den Mittelpunkt gerückt worden. Die Arbeitsorganisation wird im allgemeinen nicht mehr, wie früher üblich, aus Notwendigkeiten der Technologie oder der Ökonomie einlinear abgeleitet. Technologien und Märkte setzen der Gestaltbarkeit der Arbeitsorganisation sicherlich Grenzen, erzeugen einen erheblichen Druck zu höherer Effizienz und wirken so leistungsverdichtend. Sie werden aber gleichzeitig auch als Faktoren angesehen, die Gestaltungsoptionen innerhalb bestimmter Entscheidungskorridore eröffnen. Flexible Märkte und flexible einsetzbare Technologien fördern - je nach Branche und Marktsegment in unterschiedlichem Maße - eine flexible Unternehmensorganisation mit einer dezentralen Entscheidungskompetenz. Welche Organisationsstrukturen sich jedoch letztlich durchsetzen, ist keine Frage von technischen oder ökonomischen Logiken und Modellen, sondern auch Ergebnis von Gestaltungs- und Aushandlungsprozessen im Betrieb, in die allerdings vielfältige außerbetriebliche Einflüsse hineinwirken. In diesem Zusammenhang ist immer wieder von einer "Politisierung" der betrieblichen Sozialbeziehungen die Rede (z. B.: Heidenreich/Schmidt 1990; Hirsch-Kreinsen u. a. 1990; Ortmann u. a. 1990). Trotz nachhaltig ungleicher Möglichkeiten der Durchsetzung von Interessen kann davon ausgegangen werden, dass Einflussmöglichkeiten auf allen Ebenen der betrieblichen Hierarchie bestehen. Dieses gilt sowohl für zielgerichtete, offene und formelle Strategien zur Veränderung betrieblicher Arbeitsteilungsstrukturen unter Nutzung etablierter Interessenvertretungsmuster, als auch und vermutlich in größerem Umfang für naturwüchsige, "heimliche" und informelle Aktivitäten (8). Von besonderer Bedeutung für den zweiten Aktivitätstyp ist hier die Möglichkeit für die FacharbeiterInnen und Fachangestellten, Regelungs- und Kontrolllücken im Arbeitsprozess zu nutzen und eine "aktive Beeinflussung der Arbeitsorganisation 'von unten'" (Voskamp/Wittke 1992: 31) zu bewirken. Trotz vielfältiger Verhaltens- und Verfahrensvorschriften sowie geregelter Verantwortlichkeiten verbleiben z. T. erhebliche Grauzonen, die von den Beschäftigten prinzipiell zur Erweiterung individueller und gruppenkollektiver Zuständigkeiten genutzt werden können. Zwar sind solche Möglichkeiten allgemein zu unterstellen, sie treten jedoch in Umbruchphasen - eine solche liegt zurzeit unstrittig vor - besonders hervor.
Die allenthalben diagnostizierten arbeitspolitischen Handlungsmöglichkeiten werden allerdings überwiegend nicht oder mit einer Tendenz genutzt, die im Hinblick auf die Überwindung überkommener Strukturen ambivalent einzuschätzen ist. So stellen z. B. Pries u. a. fest, dass "zwar die technischen Voraussetzungen immer freier genutzt werden können, die betrieblichen Akteure aber die übrigen, vor allem die sozialen Bedingungen der Arbeitsgestaltung nur unzureichend zu erkennen bzw. zu nutzen vermögen" (Pries u. a. 1989: 21). Der Blick auf vorhandene Chancen gestaltender Einflussnahme wird u. a. verstellt durch
Der eher skeptische Blick auf die Nutzung vorhandener Handlungs- und Gestaltungsspielräume durch betriebliche Akteure bedeutet nicht, dass sie gänzlich unterbleibt. Insbesondere jungen Fachkräften in Produktion und Verwaltung wird - von betrieblichen Akteuren, die im Rahmen des Projektes "Berufsorientierung" befragt wurden und in der einschlägigen Forschungsliteratur - bescheinigt, dass sie ihre Zuständigkeiten aktiv zu erweitern suchen. Solche Aktivitäten sind jedoch oft ausgesprochen ambivalent. Sie wirken einerseits beschleunigend auf Tendenzen zur Erweiterung von Arbeitsautonomie und Verantwortungsübernahme durch FacharbeiterInnen und Fachangestellte. Andererseits handelt es sich oft um individualistische Strategien, die sich zwar gegen vorhandene Arbeitsstrukturen und Hierarchien wenden, sie aber gleichzeitig durch Aufstiegsorientierungen auch stabilisieren. So kommen Voskamp/Wittke zwar zu dem Ergebnis, dass "die Arbeitsstrukturen sich durch die aktive Mitwirkung der 'Facharbeiter neuen Typs' bereits sehr viel weiterreichend gewandelt haben, als offizielle Konzepte vermuten lassen" (Voskamp/ Wittke 1992: 32). Die mit dem selbstbewussten Auftreten einhergehenden sozialen Spannungen werfen jedoch Probleme auf. Es kommt "typischerweise" zu Konfliktlinien "zwischen Jung und Alt" (ebd.). Aus der Produktion wird von Konflikten zwischen jungen Facharbeiter(Inne)n und älteren Einrichtern berichtet, "die um ihren sozialen Besitzstand fürchten müssen" (ebd.). Im Rahmen der Forschungsarbeiten im Projekt "Berufsorientierung" sind wir mehrfach und besonders ausgeprägt im Bereich der Unternehmensverwaltung auf solche Konflikte gestoßen. Die methodischen und analytischen Fähigkeiten junger Fachkräfte, ihre Tendenz vorgegebene Arbeitsstrukturen zu hinterfragen und ihre oft höheren Qualifikationen im Umgang mit IuK-Technologien stellen die tradierten Verfahren und Leistungsanforderungen und damit den Status der älteren Kolleginnen infrage, die darauf mit Abwehrhaltungen reagieren. Die mit der Restrukturierung der Arbeit einhergehende Tendenz der Leistungsverdichtung (und die Überforderung vieler älterer ArbeitnehmerInnen) kann den Auszubildenden und AusbildungsabsolventInnen eine positive Erfahrung und Selbstbestätigung vermitteln, da sie von vornherein für die neuen technischen Mittel und umfassendere Aufgabenzuschnitte ausgebildet werden. Hier gibt es deutliche Parallelen zu Untersuchungen von Littek/Heisig (1986). Danach sind viele junge, hoch qualifizierte Angestellte die (vorläufigen und relativen) Gewinner von Rationalisierungsmaßnahmen und treiben dabei Spaltungstendenzen innerhalb der Gruppe der Angestellten voran: "Das Management braucht nur die Rahmendaten vorzugeben, damit jüngere und qualifiziertere Angestellte aktiv werden und ihre älteren und geringer qualifizierten Kollegen unter Verhaltens und Anpassungszwänge setzen" (ebd.:246).
Hier zeigt sich exemplarisch die Kehrseite individueller arbeitsbezogener Ansprüche. Kritik an unbefriedigenden Arbeitsverhältnissen äußert sich überwiegend in "individuellen Aktivitäten zur Korrektur" (Baethge 1991: 16), d. h. in Konkurrenzverhalten und einer Aufstiegsorientierung, die immer ausgeprägter zu akademischer Bildung tendiert - oder auch nur in der "inneren Kündigung". Diese Strategien führen jedoch im Grundsatz zu einer Stabilisierung überkommener Hierarchien und Statusansprüche im Beschäftigungssystem, die auch aus ökonomischer Perspektive zunehmend fragwürdig werden.
Es wäre sicherlich verfehlt, die Dominanz individualistischer Strategien primär oder einseitig als Folge der schulischen Sozialisation zu begreifen. Hier greifen (zumindest) der Funktionswandel der Familie, die Ausdehnung vorberuflicher Sozialisation und Individualisierungsprozesse in der Erwerbsarbeit ineinander. Unabhängig von Ursachen- oder gar Schuldzuschreibungen ist jedoch die These einer Ambivalenz schulischer Sozialisation kaum von der Hand zu weisen. Sie trägt - als emanzipatorisches Moment - dazu bei, dass sich der "Eigensinn" der Subjekte gegen Formen der Fremdbestimmung im Arbeitsleben richtet (vgl. ebd.). Sie fördert jedoch gleichzeitig eine Dominanz der persönlichen gegenüber der sozialen Identität, die durchaus repressive Funktionen der betrieblichen Organisation stützen kann. Subjektive Ansprüche Dritter oder ökologische, soziale und ethische Prinzipien einer humanen Gesellschaft sind nicht unbedingt in den individualistischen Handlungshorizont eingelassen.
Im Projekt "Berufsorientierung für eine neue Ausbildung im Betrieb" wurden vor dem Hintergrund veränderter Anforderungen in Ausbildung und Beruf Untersuchungen in 8 Ausbildungsabteilungen von insgesamt fünf Unternehmen durchgeführt. Die ausgewählten Unternehmen repräsentieren nicht den Durchschnitt der ausbildenden Unternehmen. Sie wurden ausgewählt, weil sie ihre Ausbildung inhaltlich, methodisch und organisatorisch an neuen Arbeitseinsatzkonzepten orientiert haben. Mit dieser Ausrichtung der Forschungsarbeiten sollte die Gefahr umgangen werden, eine rückständige Praxis in Beruf und Berufsausbildung zum Maßstab bildungspolitischer Überlegungen zu nehmen. Die Untersuchungen richteten sich u. a. auf zwei Fragestellungen:
Die unter dem Begriff "Schlüsselqualifikationen" subsumierten Befähigungen, Zielsetzungen und Funktionsbestimmungen können zunächst als offen für unterschiedliche Funktionen und Interpretationen aufgefasst werden. Bestimmte interessenpolitische Deutungen sind damit nicht zwingend verbunden. Daraus resultiert einerseits die Gefahr einer ökonomisch funktionalistischen Verkürzung und Instrumentalisierung. Andererseits enthalten die Qualifikationsziele und die damit verbundenen Ausbildungsreformen ein emanzipatorisches Potenzial. Im Vergleich zur bisherigen Berufsausbildung liegen ihnen ein komplexerer Begriff beruflichen Handelns und Elemente einer Persönlichkeitsbildung zugrunde. Sie sind insofern "ganzheitlicher" konzipiert.
Gegen eine Verengung auf funktionale Erfordernisse im Beruf wurde im Projekt "Berufsorientierung" in Aufnahme und Weiterführung vorhandener Ansätze (Schumann u. a. 1982, Fricke/Schuchardt 1985, Negt 1990) ein multiperspektivisches und interessenbezogenes Konzept von Schlüsselqualifikationen entwickelt. Analytisch unterschieden werden die Arbeitskraftperspektive, die Subjektperspektive und die gesellschaftliche Perspektive. Die Arbeitskraftperspektive zielt auf die Möglichkeiten des Verkaufs, der Erhaltung, der Optimierung und der Wertsteigerung der Arbeitskraft, als Existenzressource der Beschäftigten für sich selbst und für das Unternehmen. Die Subjektperspektive betrifft die Gesamtperson und die Beschäftigten als kollektive Akteure, ihre Identität und Würde und ihre "eigensinnigen" Entfaltungs- und Handlungsmöglichkeiten. Die gesellschaftliche Perspektive überschreitet die Begrenzung einer selbstreferentiellen Fixierung auf das eigene Unternehmen oder eines durch die Funktion bzw. die fachlich-berufliche Rolle eingeschränkten Relevanzbereiches und Realitätsausschnittes und umfasst die darüber hinausgehenden politischen Konsequenzen und Möglichkeiten beruflichen Handelns (vgl. dazu ausführlich: Simoleit/Feldhoff/Jacke 1991 und Simoleit/Jacke/Feldhoff 1994).
Eine wichtige Frage im Hinblick auf die bildungspolitische Bewertung der Ausbildungsreform und auf daraus abzuleitende Konsequenzen für die allgemein bildenden Schulen richtet sich auf die Berücksichtigung und Akzentuierung dieser Perspektiven in der reformorientierten betrieblichen Berufsausbildung. Von zentralem Interesse war hier, ob die Beschränkung der traditionellen Ausbildung auf eine Arbeitskraftperspektive, die sich zudem ausschließlich auf spezifische betriebliche Interessen richtete, überwunden wird und Subjektinteressen der Auszubildenden sowie Ansprüche aus der gesellschaftlichen Perspektive Berücksichtigung finden. Dabei war nicht nur zu untersuchen, ob die Ausbildung Freiräume für subjektive Ansprüche und z. B. für die Diskussion politischer Fragen gewährt, sondern ob die Ausbildung auch darauf gerichtet ist, Qualifikationen und Kompetenzen zu vermitteln, die diesen Perspektiven zuzuordnen sind. Im Hinblick auf die Subjektperspektive geht es dabei z. B. um die Förderung von Kompetenzen zur Wahrnehmung, Artikulation, Aushandlung und Durchsetzung von Interessen in betrieblichen Entscheidungsprozessen. Die gesellschaftliche Perspektive wurde in den Untersuchungen schwerpunktmäßig auf die Vermittlung und Förderung ökologischer Kompetenzen bezogen.
Die Ergebnisse (10) sind im Hinblick auf die Berücksichtigung der genannten Perspektiven ambivalent. Unproblematisch erscheint die Berücksichtigung der Arbeitskraftperspektive der Auszubildenden. Anzeichen für eine Ausbildung, die sich nur auf einen kurzfristigen betriebsspezifischen Qualifikationsbedarf richtet und die Interessen der Auszubildenden am Erwerb umfassender und betriebsunabhängiger Qualifikationen unberücksichtigt lässt, haben wir nicht vorgefunden. Die Notwendigkeit einer Förderung von Schlüsselqualifikationen ist im Kern in allen Betrieben unbestritten, auch wenn die Unschärfe des Begriffs aus verschiedenen Perspektiven kritisiert wurde. In der Ausbildungspraxis werden z. B. selbstständiges Vorgehen in der Arbeit, Kooperationsfähigkeit, methodisches Vorgehen und selbstständige Informationsbeschaffung mit Sozialformen und Methoden wie Gruppenarbeit, Leittext, Projekt, Junioren und Übungsfirmen, Plan und Rollenspiele oder systematische Erkundungen gefördert. Wenngleich traditionelle Ausbildungselemente (Ausbilderzentrierung, Vormachen-Nachmachen, Frontalunterricht) in einigen Untersuchungsbetrieben - entgegen der jeweiligen Konzeption - immer noch einen erheblichen Anteil ausmachen, kann festgehalten werden, dass reformorientierte Methoden in einigen Ausbildungsabteilungen bereits deutlich dominant sind. Auch in den übrigen Fällen wird ein weiterer Ausbau angestrebt. Die Reformbestrebungen in der betrieblichen Berufsausbildung und die veränderten Qualifikationsbestimmungen sind - bezogen auf die Arbeitskraftperspektive - relevante empirische Tatbestände und nicht nur legitimatorische Rhetorik.
Weniger eindeutig sind die Ergebnisse zur Berücksichtigung der Subjektperspektive in der reformorientierten Ausbildungspraxis. Die Handlungsspielräume im Arbeits- und Lernprozess werden von den Auszubildenden selbst, je nach Betrieb unterschiedlich, aber überwiegend positiv eingeschätzt. Einer Entwicklung, Verfolgung und Aushandlung individueller und gruppenkollektiver Interessen durch die Auszubildenden stehen die Ausbildungsverantwortlichen in den meisten Fällen aufgeschlossen gegenüber. Dies gilt vor allem für die Entwicklung von Projektideen und eigenständigen Problemlösungen. In dieser Hinsicht ist die Ausbildungsreform nicht nur ökonomisch bestimmt, sondern gleichzeitig auch Ergebnis professioneller, berufspädagogisch begründeter Reforminitiativen. Der Rekurs auf den betrieblichen Bedarf wird besonders von den Ausbildungsleitungen durch eine Orientierung an ganzheitlichen Formen der Arbeitskraftnutzung oder an der Mitgestaltung der Arbeitssituation durch die Beschäftigten vielfach ergänzt. Hier wird oft mit einer Tauschlogik argumentiert, die sich wie folgt zusammenfassen lässt (11):
Wenn das Unternehmen von den Beschäftigten erwartet, dass sie nicht nur festgelegte Operationen vollziehen, sondern mitdenken, für die Qualität des Produktes einstehen und Verantwortung übernehmen, müssen entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden. Unerlässlich sind Freiräume und Beteiligungsmöglichkeiten für die Beschäftigten zur Sicherung individuell befriedigender Arbeitsbedingungen. Die Identifikation mit der Arbeitsaufgabe kann nicht über materielle Anreize oder aufgesetzte Konzepte einer "Corporate-Identity" gesichert werden.
Die überwiegend praktizierte Offenheit gegenüber Gestaltungsinitiativen ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer aktiven Förderung gestaltungsbezogener Kompetenzen. Eine gezielte Förderung und Entwicklung von Kompetenzen und Qualifikationen, die auf die Sicherung und Erweiterung von Autonomiespielräumen und individuelle oder kollektive Einflussnahmen zielt, konnte nur in zwei der acht Ausbildungsabteilungen festgestellt werden. Hier setzt insbesondere ein montan mitbestimmtes Unternehmen Maßstäbe für eine zukünftige Ausbildung. Vorgefundene Beispiele für Gestaltungsaktivitäten von Auszubildenden, die durch Ausbildungsleitungen und AusbilderInnen in zwei Unternehmen aktiv gefördert und bisweilen geradezu provoziert wurden, sind:
Eindeutig defizitär stellt sich dagegen die Berücksichtigung der gesellschaftlichen Perspektive dar. Zwar wird zumeist eine Offenheit gegenüber Reflexionen gesellschaftlicher Bezüge von Arbeit und Beruf postuliert. Das ist insofern als Fortschritt zu bewerten, als z. B. die Berücksichtigung von Umweltproblemen bis vor einigen Jahren in vielen Unternehmen und auch gelegentlich bei Betriebsräten und Gewerkschaften auf z. T. aggressive Ablehnung stieß. Die positive Einstellung der Ausbildungsverantwortlichen wird aber in der Ausbildungspraxis überwiegend (noch) nicht oder nur verkürzt eingelöst. Von den Akteuren selbst werden für die Thematisierung gesellschaftlich relevanter Themen und Problemlagen nur wenige Beispiele benannt. Von AusbilderInnen und insbesondere den AusbildungsleiterInnen wird zwar im Zusammenhang mit ökologischen Themen auf relativ hohe Standards bei der Verwendung (oder Vermeidung) problematischer Stoffe in den Ausbildungsabteilungen selbst verwiesen. Der Lern- und Handlungsmodus der Auszubildenden ist jedoch auf das unreflektierte Befolgen einer Norm der Vermeidung bestimmter "geächteter" Stoffe und Produkte gerichtet. Die Problematik wird in einigen Fällen - insbesondere im Rahmen der Ausbildung am Arbeitsplatz - noch einmal auf eine Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften reduziert. Eine systematische Reflexion ökologischer Risiken, die mit der jeweils spezifischen beruflichen Arbeit im Betrieb verbunden sind, findet demgegenüber in der Ausbildung einiger Unternehmen nicht, in anderen nur in Ansätzen statt - z. B. im Verlauf sozialpädagogischer Wochen. Perspektiven auf einen aktiven Beitrag von Berufstätigen zur Vermeidung von Umweltrisiken reichen zumeist nur bis zu einer - sicherlich notwendigen - Umgehung von Plastikbechern oder Tipp-Ex. Die Behandlung von Umweltrisiken klammert, von wenigen und zudem ungeplanten Ausnahmen abgesehen, die im Unternehmen hergestellten Produkte durchgängig aus. Beispiele für eine Integration ökologischer und fachlicher Kompetenzen haben wir - außer im unmittelbaren Zusammenhang mit Arbeitsschutzvorschriften - in keinem Fall vorgefunden. In einigen Fällen wird das Thema "Ökologie" darüber hinaus mit einem deutlichen Bezug auf die Privatsphäre behandelt. Umweltkriterien bleiben für die Auszubildenden auf diese Weise aufgesetzt und werden nicht in die Vorstellung von einer eigenen künftigen Berufspraxis integriert.
Zum Verhältnis von Schlüsselqualifikationen, Ausbildungsreform und Allgemeinbildendem Schulsystem zeigen sich vor dem Hintergrund der Untersuchungen zwei zentrale Problemlagen. Erstens kritisieren viele InterviewpartnerInnen - darunter die meisten Auszubildenden - Defizite in der schulischen Förderung von Schlüsselqualifikationen. Zweitens konnten insbesondere bei AusbildungsanfängerInnen keinerlei Anzeichen dafür gefunden werden, dass in den Schulen Vorstellungen über Strukturmerkmale und die Gestaltbarkeit der betrieblichen Arbeitssituation entwickelt wurden.
Die betrieblichen Ausbildungsfachleute kritisieren in diesem Zusammenhang die aus ihrer Sicht traditionalistische didaktische, methodische und unterrichtsorganisatorische Praxis der Schulen. Das derzeitige Übergewicht frontaler Unterrichtsmethoden und auf Reproduktion zielender Wissensvermittlung in allgemein bildenden Schulen erweisen sich in ihrer Sicht als Barriere für die Förderung von Schlüsselqualifikationen im Betrieb. Betriebliche Ausbildungskonzeptionen sehen sich in vielen Fällen AusbildungsanfängerInnen gegenüber, deren Orientierungen in der Tendenz auf eine Aufgabenerfüllung nach Anweisung gerichtet sind. Geradezu exemplarisch für die Kritik an den Orientierungen der AusbildungsanfängerInnen sind die nachfolgend wiedergegebenen Ausführungen eines Ausbildungsleiters in einem Zulieferbetrieb der Elektroindustrie (2000 Beschäftigte). Er vertritt eine Ausbildungskonzeption, in der selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen gefördert werden soll, die aber im Hinblick auf die Mitgestaltung von Arbeit und Technik eher indifferent angelegt ist.
Die AusbildungsanfängerInnen "wissen also nichts mit dieser Freiheit anzufangen, sich selbst zu organisieren, und sie wollen es z. T. auch nicht. Sie wollen einfach ihre Arbeit vorgegeben kriegen. Das ist auch wieder die Mentalität, die sie in der Schule gelernt haben. Diese Arbeit wird gemacht und dann ist Pause und dann ist eine andere Arbeit und dafür wird gelernt - aber nicht dafür, dass man sich auf lange Sicht selbst organisiert. Und das ist etwas, was uns Schwierigkeiten macht... Sie erwarten fertige Informationen". Wenn sie selbst planen und sich Informationen und Arbeitsmittel selbst beschaffen sollen, verläuft das nach der Devise, "'wieso, wieso soll ich das machen, es sind doch Ausbilder da? Sie sagen es zwar nicht, aber so ist die Denkweise'".
Diese Kritik an der rezeptiven Lernhaltung von AusbildungsanfängerInnen wurde in vielen Interviews (und von allen AusbildungsleiterInnen) geübt und zumeist explizit mit dem Hinweis verbunden, dass man sich nicht über die Leistungsbereitschaft von Auszubildenden beschweren wolle. Wenn sie eine Vorgabe bekommen - so der zitierte Ausbildungsleiter - arbeiten sie, "dass es nur so kracht". Die hier kritisierte Lern- und Arbeitshaltung kollidiert selbst mit den keineswegs avantgardistischen Definitionen von beruflicher Handlungskompetenz in den neu geordneten Ausbildungsberufen, die selbstständig planende, durchführende und kontrollierende FacharbeiterInnen und Fachangestellte fordern. Die Ergebnisse vorberuflicher Sozialisation sind damit zu Beginn der Ausbildung schon in der Arbeitskraftperspektive mit den beruflichen Anforderungen kaum zu vereinbaren.
Eine Zuspitzung erfährt die Kritik in den Ausbildungsabteilungen, in denen versucht wird, Gestaltungskompetenz in der Ausbildung aktiv zu fördern und zwar unabhängig davon, ob das eher aus einer gewerkschaftsnahen Position erfolgt, die an den Ansprüchen der Beschäftigten ansetzt, oder ob hier eher das betriebliche Interesse an der optimalen Nutzung der produktiven Kompetenzen der Beschäftigten gesehen wird. Kritisiert werden in besonderem Maße die LehrerInnenzentrierung des Unterrichts, die bürokratische Organisation von Schulen und das Lernen im 45 Minuten Takt im schulischen Fächerkanon. Der kaufmännische Ausbildungsleiter eines Stahlwerkes (5000 Beschäftigte) äußert sich in diesem Zusammenhang wie folgt:
"Die Lehrer (...) gehen nur als Einzelkämpfer durch die Gegend... Durch die Konstruktion, dass sie allein vor einer Klasse mit Unterrichtseinheiten von 45 Minuten stehen, die ganz bestimmten Fächern zugeordnet sind, dass sie einen ganz bestimmten Stoffplan bearbeiten müssen, können die Lehrer eigentlich nicht das vorführen und die Schüler das erfahren lassen, was nachher in dem betrieblichen Alltag im Berufsleben stattfindet. Im betrieblichen Alltag sieht es genau so nicht mehr aus." Methoden und Organisationsformen der Schule passten "zu den alten, klassischen Betriebsstrukturen", zum Taylorismus, aber "in dem Maße, in dem sich die Situation im Berufsleben zunehmend verändert, passen die schulischen Vorerfahrungen nicht mehr dazu". Die Auszubildenden "kommen offensichtlich immer mit dem Hintergedanken, sie sind das absolut schwächste Glied, haben nichts zu sagen, müssen alles schlucken, müssen alles hinnehmen, was sich in solch einem Betrieb innerhalb der Ausbildung aber auch später als Mitarbeiter abspielt".
AusbilderInnen und Ausbildungssituation werden - fälschlicherweise - gleichgesetzt "mit der Funktion und mit der Situation, die sie zwischen sich und den Lehrern kennen gelernt haben, bei der ... eine ganz eindeutige Machtposition aufseiten des Lehrers" bestand. Trotz aller Bemühungen "dauert es eine ganze Weile bis sie merken und sich wirklich sicher sind, dass es anders funktioniert, als sie es bisher gewohnt waren".
Im Mittelpunkt einer solchen Kritik steht zumeist die Autoritätsfixierung der Auszubildenden und eine Haltung, die betriebliche Strukturen als unveränderbar ansieht (12). Diese Auffassung bestätigt sich in Interviews mit Auszubildenden. Sofern die Ausbildung selbst nicht ein Denken in Alternativen fördert, neigen sie dazu, die betrieblichen Strukturen, in denen sie sich gerade befinden, als von ihnen generell nicht beeinflussbar anzusehen (13). Diese Haltung trägt dazu bei, dass vorhandene Spielräume zur subjektiv befriedigenden Gestaltung der Arbeitssituation ungenutzt bleiben.
Dieser ernüchternden Sicht der Resultate vorberuflicher und damit sehr wesentlich schulischer Sozialisation in der Arbeitskraft- und der Subjektperspektive steht eine insgesamt positive Einschätzung in der gesellschaftlichen Perspektive gegenüber. Den AusbildungsanfängerInnen wird überwiegend eine hohe Sensibilität gegenüber ökologischen Risiken oder Problemen von Rüstungsproduktion und -export bescheinigt, die jedoch - wie in Einklang mit der einschlägigen Forschung bisweilen kritisch vermerkt wird - nicht unbedingt handlungsrelevant wird. Offen bleibt, ob sich in dieser Diskrepanz u. a. eine von manchen Auszubildenden kritisierte "Übersättigung" und eine anscheinend auch in den Schulen mitunter - z. B. durch die Reduktion von Umweltproblemen auf individuelle (Konsum-)Handlungen - praktizierte Individualisierung gesellschaftlicher Probleme zeigt.
Die Äußerungen der Auszubildenden zu ihren Lernerfahrungen in Schule und Betrieb sind fast ausschließlich von einer überaus positiven und bisweilen überschwänglichen Haltung gegenüber der betrieblichen Ausbildung und einer negativen und in einigen Fällen vernichtenden Kritik an den allgemein bildenden Schulen gekennzeichnet. Selbst Auszubildende, die hier zurückhaltender argumentieren und sich in Gruppeninterviews gegen zu scharfe Schulkritiken wenden, stellen den negativen Eindruck ihrer KollegInnen nicht in Abrede, sondern verweisen auf die Rahmenbedingungen schulischen Lernens, die einen produktiven und subjektiv befriedigenden Lernprozess oft nicht zulassen. Zur Erklärung werden die in der Ausbildung wesentlich besseren Betreuungsrelationen und äußere Zänge angeführt, denen die Schule unterworfen ist (Lehrpläne, Selektionszwang). Positiv bewertete Schulerfahrungen werden nur selten beschrieben und mit dem Hinweis auf einzelne, besonders engagierte LehrerInnen oder auf eine reformpädagogische Praxis der entsprechenden Schule (Waldorfschule, einige Gesamtschulen) wiederum relativiert. Das Urteil der Auszubildenden weicht auch in denjenigen Unternehmen kaum von der allgemeinen Tendenz ab, in denen traditionelle Orientierungen die Ausbildungspraxis (noch) in erheblichem Maße prägen. Die Kritik der Auszubildenden - sie wird oft eingeleitet durch die spontane Aussage im Betrieb sei "alles viel lockerer" - richtet sich gegen einen Schule, die in ihrer Sicht gekennzeichnet ist durch
Unter den genannten Kritikpunkten werden besonders häufig diejenigen benannt, in denen Klagen über unbefriedigende sozial kommunikative Beziehungen zu LehrerInnen zum Ausdruck kommen. Während die Schule rückblickend zumeist in Begriffen eines entfremdeten Lernprozesses beschrieben wird, heben die Auszubildenden an ihrer Ausbildung die Motivationseffekte neuer Ausbildungsmethoden, höhere Handlungsspielräume und die Einschätzung hervor, dass sie sich in der Ausbildung als ganze Person ernstgenommen und akzeptiert fühlen. Als exemplarisch für Vergleiche von traditioneller Schule und reformorientierter Ausbildung kann die folgende Aussage einer Auszubildenden gelten: "Die Ausbildung hier ist so, wie man sich die Schule wünschen würde" (14).
Ausgehend von den vorangegangenen Überlegungen lassen sich im Hinblick auf das allgemein bildende Schulsystem die nachfolgend thesenhaft aufgeführten Forderungen formulieren. Sie können allerdings nicht unmittelbar aus Entwicklungen im Beschäftigungssystem oder aus Übergangsproblemen an der ersten Schwelle abgeleitet werden und sind mithin weder in einem logischen Sinn zwingend, noch wird damit ein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Da es sich jedoch im Wesentlichen um alte - aber nach wie vor aktuelle - bildungspolitische Forderungen handelt, erscheint es mir nicht notwendig auf (vorgebliche) Logiken und Sachnotwendigkeiten zu rekurrieren.
Die nur angedeuteten bildungspolitischen Forderungen sind - obwohl sie von PraktikerInnen möglicherweise dennoch als Zumutung empfunden werden - sicherlich weniger spektakulär und originell als der Ruf nach einem deregulierten Schulsystem, das wesentliche Prinzipien einer modernisierten Produktion übernimmt. Sie sind nicht einmal neu. Es gibt nur neue Gründe sie durchzusetzen.
Dieser Aufsatz basiert auf Vorarbeiten, die der Verfasser gemeinsam mit Jürgen Simoleit und Jürgen Feldhoff (Projektleiter) im Forschungsprojekt "Berufsorientierung für eine neue Ausbildung im Betrieb" am Forschungsschwerpunkt "Zukunft der Arbeit", Fakultät für Soziologie, Universität Bielefeld, durchgeführt hat. Das gilt insbesondere für die unten angeführten empirischen Befunde. Das Projekt wurde von der Hans-Böckler-Stiftung und dem Ministerium für Wissenschaft und Forschung NRW gefördert.
1) Mit den genannten Ansätzen gehen sehr unterschiedliche Vorstellungen von der arbeitspolitischen Stellung der Beschäftigten in modernisierten Arbeitsprozessen einher. Die Pole bilden hier die "Neuen Produktionskonzepte" (Kern/Schumann 1984) und die "Lean-Production". Erstere schließen - jedenfalls in der von Kern/Schumann favorisierten Variante - an die Debatten um die Humanisierung der Arbeit an, während letztere - trotz der Forderung nach flacheren Hierarchien und Gruppenarbeit - die Arbeitskraft eher als Größe behandelt, die auf neue Weise fungibel ist.
2) Nach einer Erhebung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) aus dem Jahr 1991 werden in ca. 60% der Ausbildungsbetriebe überwiegend traditionelle Ausbildungsmethoden angewandt (Vormachen - Nachmachen, Frontalunterricht; vgl. Berufsbildungsbericht 1993). Eindeutig dem reformerischen Spektrum der Ausbildung neigen nur ca. 7,5% der Betriebe zu (Projektmethode, Gruppenarbeit, Leittext), während die mit ca. 33% stark vertretene Methode "auftragsbezogenes Lernen" nach Erfahrungen aus dem Projekt "Berufsorientierung" nicht eindeutig zuzuordnen ist. Zumindest ein Korrelat hat die Vorstellung von einer beruflichen Bildung in größeren Unternehmen allerdings bereits. Hier gibt es inzwischen - so der Eindruck aus den Projektarbeiten - kaum noch Ausbildungsabteilungen oder -werkstätten, sondern nur noch "Betriebliche Bildungswesen".
3) Zu einer ausführlichen Kritik an Lehner/Widmaier vgl. Jacke/Simoleit/Lemmermöhle-Thüsing/Feldhoff (1993).
4) Dies gilt nicht nur für Positionen, die mit ökonomischen Argumenten eine Bildungsreform vorantreiben wollen, sondern in gleichem Maße für die populärere, aber einem ähnlichen Grundmuster verpflichtete Sichtweise, die Bildung vornehmlich unter Kostengesichtspunkten behandelt.
5) Zu den analytischen Dimensionen von Abstimmungsprozessen zwischen Bildungssystem und Beschäftigungssystem vgl. Timmermann 1988.
6) Einen ähnlichen Zusammenhang haben offenbar auch Lehner/Widmaier mit ihrer durchaus unterstützenswerten Forderung nach einer Enthierarchisierung des Bildungssystems vor Augen (vgl. Lehner/Widmaier 1992: 100).
7) Auch einige der im Rahmen des Projektes "Berufsorientierung" befragten AusbildungsleiterInnen sehen die Reformtendenzen in der Berufsausbildung nicht nur als Reaktion auf veränderte Qualifikationsanforderungen der Betriebe, sondern auch als Ergebnis eines Wandels arbeitsbezogener Wertvorstellungen, dem mit erhöhter Kooperation und erweiterten Autonomiespielräumen Rechnung getragen werde.
8) Selbst tayloristische Formen der Arbeitsorganisation könnten nicht funktionieren, "wenn die Individuen darin nicht ein illegales Ausmaß an Eigeninitiative" an den Tag legten (Volpert 1987: 147; s. a. Schuchardt 1985: 31).
9) Dieses zeigte sich z. B. in Beteiligungsprojekten: "Wird die Gestaltung vorrangig von der Anschauung der bisherigen Arbeitsabläufe der BenutzerInnen bestimmt, so werden die herkömmlichen Formen der Informationsverwaltung, z. B. Formblätter, unverändert in automatisierte Strukturen übersetzt" (Mehl u. a. 1989: 127).
10) Eine umfassende Darstellung des Untersuchungsansatzes und der Ergebnisse wird im Sommer 1994 vorliegen; zur theoretischen Konzeption vgl. Simoleit/Jacke/Feldhoff 1994.
11) Ein Teil der lang gedienten AusbilderInnen zeigt sich hier allerdings reserviert. Bei ihnen dominieren Ängste vor dem Störpotenzial subjektiver Orientierungen für einen geregelten Ablauf von Arbeits- und Ausbildungsprozessen.
12) Die hier behauptete Fixierung auf Autoritäten und vorgefundene Strukturen mag als Widerspruch zu Untersuchungsergebnissen erscheinen, wonach jugendliche ArbeitnehmerInnen hohe kommunikative und arbeitsinhaltliche Ansprüche an die Arbeit stellen (vgl. Baethge u. a. 1988) und ihre Ansprüche durch die expansive Nutzung von Regelungs- und Kontrolllücken teilweise realisieren (s. o.). Die Ergebnisse des Projektes "Berufsorientierung" widersprechen dem jedoch nicht. Die Jugendlichen formulieren in der Tat hohe Ansprüche an die Arbeit, verfolgen sie jedoch ganz überwiegend nach gesellschaftlich vorgezeichneten, individualisierten Mustern. Sie streben vor allem eine formale Weiterbildung oder ein Studium an.
13) Diese Haltung zeigt sich nicht nur gegenüber betrieblichen Strukturen, sondern paradoxerweise auch bei Fragen zu Veränderungsmöglichkeiten der Unterrichtspraxis in allgemein bildenden Schulen. Obwohl die Schulkritik überraschend einmütig ist (s. u.), ist ein Teil der Auszubildenden nicht in der Lage, auch nur minimale Veränderungsvorstellungen zu formulieren.
14) In diesem Zusammenhang ist nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass die positive Einschätzung der Ausbildung nicht in gleicher Weise für die anschließende Berufspraxis gilt. Die Ausbildung befindet sich zumeist in einer Vorreiterfunktion für betriebliche Umstrukturierungen. Daraus resultierende Übergangsprobleme von der Ausbildung in ein Beschäftigungsverhältnis werden von den Ausbildungsverantwortlichen nicht nur in Kauf genommen, sondern sind bis zu einem gewissen Grade erwünscht, weil sie den Veränderungsdruck auf tradierte betriebliche Stuckaturen erhöhen. Hier wird in gewisser Weise mit Ausbildungskonzeptionen Arbeitspolitik im Betrieb gemacht, ohne dass deren Richtung von den Unternehmensleitungen eindeutig festgelegt ist. Die Ausbildungsabteilungen sind in der Auswahl von Inhalten, Methoden und Organisationsformen der Ausbildung relativ autonom.
Achtenhagen, F. (1990): Vorwort. In: Senatskommisson für Berufsbildungsforschung der Deutschen Forschungsgemeinschaft: Berufsbildungsforschung an den Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland. Situation - Hauptaufgaben - Förderungsbedarf. Denkschrift. Weinheim 1990, S. VIIf.
Arnold, R. (1993): Das duale System der Berufsausbildung hat eine Zukunft. In: Leviathan 1/1993, S. 87 - 102.
Baethge, M. (1988): Bildung in der Arbeitsgesellschaft - zum Spannungsverhältnis von Arbeit und Bildung heute. In: Universität Bremen; Bildung in der Arbeitsgesellschaft. Zum Spannungsverhältnis von Arbeit und Bildung heute. Dokumentation des 10. Bremer Wissenschaftsforums vom 11. bis 13. Oktober 1988, S. 1 - 19.
Baethge, M. (1990): Technischer Wandel und Herausforderungen an die Bildung. Was sollen Schüler heute lernen? In: Kolbe, F.-U./ Lenhart, V. (Hg.); Bildung und Aufklärung heute. Bielefeld, S. 49 - 64.
Baethge, M. (1991): Arbeit, Vergesellschaftung, Identität - Zur zunehmenden normativen Subjektivierung der Arbeit. In: Soziale Welt 1/1991, S. 6 - 19.
Baethge, M./ Gerstenberger, F./ Oberbeck, H./ Schlösser, M./ Seltz, R. (1980): Bildungsexpansion und Beschäftigungslage von Angestellten. Entwicklungstendenzen von Ausbildungs- und Beschäftigungsstrukturen im kaufmännisch verwaltenden Angestelltenbereich unter den Bedingungen eines erhöhten Angebots an Absolventen weiterführender Bildungseinrichtungen und fortschreitender Rationalisierung. Zwischenbericht. Göttingen.
Baethge, M./ Hantsche, B./ Pelull, W./ Voskamp, U. (1988): Jugend: Arbeit und Identität. Lebensperspektiven und Interessenorientierungen von Jugendlichen. Opladen.
Baethge, M./ Oberbeck, H. (1986): Die Zukunft der Angestellten. Frankfurt a. M./ New York.
Berufsbildungsbericht (1993): Berufsbildungsbericht 1993. Herausgegeben vom Bundesminister für Bildung und Wissenschaft. Bonn.
Brater, M. (1987): Allgemeinbildung und berufliche Qualifikation. In: Müller-Rolli (Hg.), S. 119 - 137.
Fricke, W./ Schuchardt, W. (Hg.) (1985): Innovatorische Qualifikationen eine Chance gewerkschaftlicher Arbeitspolitik. Bonn.
Hage, K./ Bischoff, H./ Dichanz, H./ Eubel, K. D./ Oehlschläger, H. J./ Schwittmann, D. (1985): Das Methodenrepertoire von Lehrern. Eine Untersuchung zum Schulalltag der Sekundarstufe I, Opladen.
Heidenreich, M./ Schmidt, G. (1990): Neue Technologien und die Bedingungen und Möglichkeiten ihrer betrieblichen Gestaltung. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 1/1990, S. 41 - 59.
Hirsch-Kreinsen, H./ Schultz-Wild, R./ Köhler, Ch./ v. Behr, M. (1990): Einstieg in die rechnerintegrierte Produktion. Alternative Entwicklungspfade der Industriearbeit im Maschinenbau. Frankfurt a.M.
Hoff, E./ Lappe, L./ Lempert, W. (1982): Sozialisationstheoretische Überlegungen zur Analyse von Arbeit, Betrieb und Beruf. In: Soziale Welt 3/4 1982, S. 508 - 536.
Jacke, N./ Simoleit, J./ Lemmermöhle-Thüsing, D./ Feldhoff, J. (1993): Bildung für die modernere Industriegesellschaft? In: pädextra 6/1993.
Jansen, K. D./ Schwitalla, U./ Wicke, W. (Hg.) (1989): Beteiligungsorientierte Systementwicklung. Beiträge zu Methoden der Partizipation bei der Entwicklung computergestützer Arbeitssysteme. Opladen.
Kern, H./ Schumann, M. (1984): Das Ende der Arbeitsteilung? München.
Lehner, F./ Widmaier, U. (1992): Eine Schule für eine moderne Industriegesellschaft. Essen.
Littek, W./ Heisig, U. (1986): Rationalisierung von Arbeit als Aushandlungsprozeß. Beteiligung bei Rationalisierungsverläufen im Angestelltenbereich. In: Soziale Welt 2/3, 1986, S. 237 - 262.
Lutz, B. (1976): Bildungssystem und Beschäftigungsstruktur in Deutschland und Frankreich. Zum Einfluß des Bildungssystems auf die Gestaltung betrieblicher Arbeitskräftestrukturen. In: Mendius, H.-G./ Sengenberger, W./ Lutz, B./ Altmann, N./ Böhle, F./ Asendorf-Krings, I./ Drexel, I./ Nuber, C., Betrieb - Arbeitsmarkt - Qualifikation I. Franfurt a.M., S. 83 - 151.
Lutz, B. (1988): Welche Qualifikationen brauchen wir? Welche Qualifikationen können wir erzeugen? In: Hesse u. a. (Hg.), S. 55 - 66.
Mehl, W. M./ Reisin, F. M. (1989): Skandinavische Ansätze zur kooperativen Gestaltung computergestützer Systeme. In: Jansen u. a. (Hg.), S. 120 - 132.
Müller-Rolli, S. (Hg.) (1987): Das Bildungswesen der Zukunft. Stuttgart.
Negt, O. (1990): Überlegungen zur Kategorie "Zusammenhang" als einer gesellschaftlichen Schlüsselqualifikation. In: Nuissl, E./Siebert, H./Weinberg, S./Tietgens, H. (Hg.); Literatur und Forschungsreport Weiterbildung Nr. 26 (Dez. 1990) Schwerpunkt Alternative Schlüsselqualifikationen.
Ortmann, G./ Windeler, A./ Becker, A./ Schulz, H.-J. (1990): Computer und Macht in Organisationen. Mikropolitische Analysen. Opladen.
Pries, L./ Schmidt, R. /Trinczek, R. (1989): Trends betrieblicher Produktionsmodernisierung: Chancen und Risiken für Produktionsmodernisierung. Opladen.
Rolf, A. (1989): Vom "Zwang des Systems" und vom "Handeln der Akteure" bei der Büroautomation und kommunikation. In: Hochschule für Wissenschaft und Politik; Auswirkungen neuer Technologien auf Betrieb, Wirtschaft und Gesellschaft. Opladen.
Schumann, M./ Baethge-Kinsky, B./ Kuhlmann, M./ Kurz, C./ Neumann, U. (1994): Der Wandel der Produktionsarbeit im Zugriff neuer Produktionskonzepte. In: Beckenbach/Treeck (Hg.), S. 11 - 43.
Schumann, M./ Einemann, E./ Siebel Rebell, Chr./ Wittemann, K.P. (1982): Rationalisierung, Krise und Arbeiter. Bremen.
Schuchardt, W. (1985): Technisch organisatorischer Wandel, Beteiligung der Arbeitnehmer und Gewerkschaftliche Arbeitspolitik; Notwendigkeit, Möglichkeit und Perspektiven für die Entwicklung und Anwendung innovatorischer Qualifikationen. In: Fricke, W./ Schuchardt, W. (Hg.), S. 22 - 41.
Simoleit, J./ Feldhoff, J./ Jacke, N. (1991): Schlüsselqualifikationen und neue Produktionskonzepte, in: Braczyk, H.-J. (Hg.): Qualifikation und Qualifizierung - Notwendigkeit, Chance oder Selbstzweck, Berlin.
Simoleit, J./ Jacke, N./ Feldhoff, J. (1994): Schlüsselqualifikationen. Zur Theorie und Orientierungsleistung eines neuen Qualifikationskonzeptes der betrieblichen Ausbildung. Fakultät für Soziologie, Universität Bielefeld, Forschungsschwerpunkt Zukunft der Arbeit. Arbeitsberichte und Forschungsmaterialien, Nr. 87.
Sydow, J. (1989): Zur Wahrnehmung organisatorischer Gestaltungsspielräume beim Einsatz neuer Bürotechnologien. In: Jansen, K.D. u. a., S. 37 - 55.
Thomas, V. (1989): Perspektiven kaufmännisch verwaltender Berufsbildung, Bonn.
Timmermann, D. (1988): Die Abstimmung von Bildungs- und Beschäftigungssystem: ein Systematisierungsversuch. In: Bodenhöfer, H.-J. (Hg.), Bildung, Beruf, Arbeitsmarkt, Berlin, S. 25 - 81.
Volpert, W. (1987): Kontrastive Analyse des Verhältnisses von Mensch und Rechner als Grundlage des System Designs. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft 3/1987, S. 147 - 151.
Voskamp, U./ Wittke, V. (1992): Junge Facharbeiter in der Produktion - eine Herausforderung für betriebliche Arbeitspolitik. In: SOFI - Mitteilungen 1992: 28 - 34.
Witthaus, U. (1994): Produktionsmodernisierung und betriebliche Bildung. Eine Analyse der Qualifikationsanforderungen und Bildungschancen moderner Produktionskonzepte. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades an der Fakultät für Pädagogik der Universität Bielefeld. Bielefeld.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung [16] fördert in Zusammenarbeit mit den Ländern und den Sozialpartnern und mit Unterstützung durch den Europäischen Sozialfonds [17] neue Wege zur Verbesserung der Berufsorientierung und Arbeitsfähigkeit von Jugendlichen. Durch ein besseres Zusammenspiel von Schulen, weiterführenden Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Gewerkschaften und Kommunen soll der Übergang von der Schule in das Berufsleben verbessert werden. Gefördert werden insbesondere Projekte, die für das jeweils federführende Land innovativ sind. Es gibt daher eine große Vielfalt an Kooperationspartnern und -formen, Zielgruppen und thematischen Schwerpunkten in den Projekten. Derzeit werden 34 Projekte gefördert (Stand: Januar 2003). Einige Projekte arbeiten in länderübergreifenden Verbünden zusammen.
Zu dem Programm ist im Frühjahr 2000 auf der Grundlage einer EU-weiten Ausschreibung eine wissenschaftliche Begleitung eingerichtet worden, die Aufgaben der Beratung und Evaluation, der Organisation von Fachtagungen und der Vernetzung der Projekte via Internet übernommen hat.
Obwohl die wissenschaftliche Begleitung ihre Sachkompetenzen zum Thema Übergang Schule - Beruf einbringt, liegt ihre vordringliche Aufgabe nicht in der direkten Praxisunterstützung der Projekte. Hier wäre sie schon von ihrer Arbeitskapazität her überfordert, zudem sind die Praxisexperten in den Projekten selbst anzutreffen. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt vielmehr in der Beratung bei der Sicherung überprüfbarer Projektergebnisse und deren Evaluation im Hinblick auf die Programmziele.
Es sei hier ausdrücklich vermerkt, dass gleichwohl auch die wissenschaftliche Begleitung ein grundlegendes Interesse an einem verstärkten öffentlichen Diskurs über Probleme und neue Wege der Jugendlichen beim Übergang in Arbeit und Beruf hat. Sie hängt insofern nicht der Illusion wertneutraler Wissenschaftlichkeit an, sondern sieht sich zumal bei der Programmevaluation in einer besonderen Verantwortung, die der Evaluationsforscher Lösel wie folgt beschreibt: "Wenn Programmevaluation ein Prozess ist, durch den eine Gesellschaft über sich selbst lernt, dann ist ihr Ausbau eng mit dem Gedanken einer offenen selbstkritischen und experimentierenden Gesellschaft verknüpft" (Lösel 1991, S. 91).
Im weiteren werden drei zentrale Herausforderungen zu Ausbildung, Arbeit und Beruf näher bestimmt, vor deren Hintergrund sich das Programm bewegt. Sodann wird der für das Programm zentrale Begriff der "Berufsorientierung" näher erläutert. Anschließend werden die Konturen eines neuen Verständnisses von Berufsorientierung verdeutlicht, wie es sich im Programm "Schule-Wirtschaft/ Arbeitsleben" [10] abzeichnet (vgl. näher hierzu die demnächst erscheinenden "Zwischenergebnisse" des Programms; im Internet abrufbar unter swa-programm.de/dokumentation).
Zunächst einmal ist das Programm ein Beleg dafür, dass zur Bewältigung des gegenwärtig stattfindenden strukturellen Wandels in Arbeit und Beruf bildungspolitische Initiativen allein im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung nicht ausreichen. Vielmehr scheint es notwendig, neben den wiederholten Anstrengungen zur Überwindung der Ausbildungsstellenknappheit an der "ersten Schwelle" zusätzliche und neue Maßnahmen zu ergreifen, um angesichts wachsender technologischer, ökonomischer und ökologischer Herausforderungen dreierlei stärker zu fördern: erstens die Ausbildungsfähigkeit der Jugendlichen, zweitens die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe und schließlich drittens die Lehrkompetenzen an den Schulen im Bereich der Berufsvorbildung.
Die Berufsorientierung ist bei aller Unterschiedlichkeit in der Wahrnehmung dieser Aufgabe Bestandteil der Lehrpläne in den allgemein bildenden Schulen. Weiterhin ist die Berufsorientierung ein Teil des Dienstleistungsangebots und gesetzlicher Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit. Das heißt, der Schule obliegt die allgemeine Berufswahlvorbereitung, der Berufsberatung obliegt die Vorbereitung der individuellen Berufs- und Ausbildungsentscheidungen (vgl. Bundesanstalt für Arbeit 1999).
Das spezifische Engagement des Bundes im Rahmen des vorliegenden Programms erklärt sich aus der aktuellen Sorge um die Sicherung der Zukunftschancen der Jugend in Ausbildung und Beruf. Hintergrund sind die Herausforderungen und Probleme, denen sich die Jugendlichen beim Übergang von der Schule in Ausbildung, Studium und Beruf in wachsendem Maße gegenübersehen. Diese Probleme machen die Berufsorientierung zu einer erweiterten, anspruchsvollen Aufgabe. Sie erfordern neue und koordinierte Anstrengungen im Bereich der Schulen und Betriebe, aber auch der weiteren mitverantwortlichen Akteure wie Eltern, Arbeitsverwaltung, Wissenschaft und Politik.
Drei zentrale Herausforderungen beeinflussen maßgeblich den Erfolg pädagogischen und politischen Handelns wie auch des Programms "Schule-Wirtschaft/ Arbeitsleben" beim Übergang der Jugendlichen von der Schule in Ausbildung und Beruf.
Wie im Berufsbildungsbericht 2002 festgestellt wird, haben sich die Ausbildungschancen der Jugendlichen im Jahre 2001 gegenüber dem Vorjahr um 1,3% bzw. 7841 weniger abgeschlossenen Ausbildungsverträgen verschlechtert. Gleichzeitig kam der öffentlich finanzierten Ausbildung durch außerbetriebliche Ausbildung sowie im Rahmen von Sonderprogrammen und durch das "Sofortprogramm zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit" auch im Jahr 2001 eine große Bedeutung zu. Ihr Anteil an der Gesamtzahl aller neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge lag in den neuen Ländern und Berlin bei 28,3% (2000: 26,9%), in den alten Ländern bei 4,0% (2000: 4,1%) (vgl. BMBF 2002, S. 5 ff).
Rechnet man zu der Zahl der unversorgt gebliebenen Jugendlichen noch diejenigen Jugendlichen hinzu, die gern eine Ausbildung absolvieren würden, aber aufgrund schulischer Leistungen keine Lehrstelle erhalten oder sich gar nicht erst beworben haben, so bleibt eine erhebliche Zahl von Jugendlichen in so genannten Warteschleifen im Berufsvorbildungs- oder Berufsgrundbildungsjahr oder hat die Hoffnung auf eine Lehrstelle ganz aufgegeben (vgl. Enggruber 1997, S. 203).
Die Gewerkschaften nennen in ihrem Sondervotum zum Berufsbildungsbericht 2000 eine Zahl von circa 200.000 Jugendlichen, die nach den Erfahrungen der Vorjahre trotz ihres Wunsches nach Ausbildung im kommenden Jahre keinen Ausbildungsplatz finden werden (vgl. GewBipol 3/4-2000).
Aus Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung [18] wissen wir, dass rund 1,6 Millionen junge Erwachsene in der Altersgruppe zwischen 20 und 29 Jahren Un- oder Angelernte sind (vgl. Kloas 1996, S. 23). Zugleich wissen wir aufgrund von Erhebungen des Emnid-Instituts [19], dass 42 Prozent dieser jungen Erwachsenen ohne Berufsabschluss an einer Nachqualifizierung interessiert sind (vgl. Emnid 1991, S. 12). Vielleicht ahnen sie etwas davon, dass der Bedarf an Beschäftigten ohne Ausbildungsabschluss sich weiter verringern wird, und zwar bis zum Jahre 2010 von heute etwa 20 auf 10 Prozent (vgl. Enggruber 1997, S. 204).
Wie immer man diese Zahlen im Einzelnen hin- und herwenden mag, sie sind zumindest ein nachdrücklicher Hinweis darauf, dass das quantitative Lehrstellenproblem auch für die nächsten Jahre noch nicht als gelöst anzusehen ist. Selbst das derzeit quantitativ annähernd ausgeglichene Verhältnis von angebotenen zu nachgefragten Ausbildungsplätzen verfehlt noch deutlich die Marke von 12,5 % Überangebot, das erst die anerkannten Auswahlmöglichkeiten bieten würde (vgl. in diesem Sinne auch Pütz 2003). Das Defizit an betrieblichen Ausbildungsplätzen ist um so gravierender, als (1) die betriebliche Ausbildung im dualen System entscheidende Vorteile gegenüber schulischen oder anderen öffentlich finanzierten Ausbildungsmaßnahmen aufweist, und (2) grundsätzlich jeder junge Mensch, wenn er nicht im medizinischen Sinne geistig behindert ist, die Möglichkeit zu einer vollqualifizierenden Berufsausbildung haben soll, wozu ihm gegebenenfalls adäquate sozialpädagogische Unterstützung und eine verlängerte Ausbildungsdauer einzuräumen ist (vgl. von Bothmer 1996, S. 72; Strikker 1991, S. VIIf).
Fazit: Die Sicherung eines auswahlfähigen Ausbildungsplatzangebots ist aus sozial-, bildungs- und arbeitspolitischen Gründen geboten. Das Programm "Schule-Wirtschaft/ Arbeitsleben", das innovative Maßnahmen an der "ersten Schwelle" zum Arbeitsmarkt fördert, kann betriebliche wie staatliche Maßnahmen zur Verbesserung der quantitativen Lehrstellensituation nicht ersetzen. Letztere bleiben auf absehbare Zeit notwendig, um auch eher qualitativ orientierte Programme wie "Schule-Wirtschaft/ Arbeitsleben [10]" schließlich erfolgreich werden zu lassen.
Seit den siebziger Jahren gibt es in der Bundesrepublik einen Trend von einem standardisierten System lebenslanger Ganztagsarbeit im Betrieb hin zu einem System pluralisierter, flexibler, dezentraler Beschäftigung (vgl. Beck 1986). Bereits heute sind nur noch weniger als die Hälfte aller Erwerbspersonen in einem so genannten Normalarbeitsverhältnis beschäftigt (vgl. Oschmiansky/ Schmid 2000, S. 4), bei dem eine fachlich qualifizierte Arbeit mit voller Stundenzahl ausgeübt und mit vollem tariflichen Entgelt bezahlt wird, in dem gesetzlicher Kündigungsschutz besteht und volle Urlaubs- und Rentenansprüche gesichert sind. Auf die anderen Erwerbspersonen trifft hingegen die Realität zeitweiser oder anhaltender Erwerbsarbeitslosigkeit sowie flexibler Beschäftigungsverhältnisse zu. Auch wenn man durchaus noch nicht vom Verschwinden der Normalarbeit sprechen kann und aufgrund der neuen Arbeitsformen und -verhältnissen wie dem "Arbeitskraftunternehmer" (vgl. Voß/ Pongratz 1998) oder dem "Scheinselbstständigen" (vgl. Reindl 2000) die Verallgemeinerung und Zukunftsfähigkeit mit guten Gründen bestritten werden kann, dürften wir erst am Beginn der Suche nach einem ausgewogenen Verhältnis ökonomisch bestimmter Flexibilität und sozialpolitisch notwendiger Sicherheit nach "Flexicurity" stehen (vgl. Keller/ Seifert 2000).
Immerhin hat die Erosion des "Normalarbeitsverhältnisses" auch dazu geführt, dass zunehmend Formen von Eigenarbeit (etwa im Privathaushalt) und öffentlicher Arbeit (etwa als Engagement in der Kommunalpolitik) als Alternativen zur Erwerbsarbeit diskutiert werden. Doch alle Anzeichen deuten darauf hin, dass diese Formen von Arbeit auf längere Sicht weniger als Alternativen, sondern eher in einem engen wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis zur Erwerbsarbeit zu sehen sind (vgl. Wagner/ Gensior 1999, S. 57ff).
Weil die Erwerbsarbeit zumeist unbezahlte Hausarbeit zur Voraussetzung hat, bleibt die Aufgabe der Umverteilung der gesellschaftlichen Gesamtarbeit, das heißt vor allem der Erwerbs- und Hausarbeit, zwischen den Geschlechtern auf der Tagesordnung. Doch ein "Ende der Erwerbs-Arbeitsgesellschaft" ist deshalb nicht in Sicht. Dieses Ende würde auch durch mehr "Geschlechterdemokratie" und einen "Geschlechtervertrag" zur Neuverteilung der gesellschaftlichen Gesamtarbeit (Hausarbeit und Erwerbsarbeit) noch nicht herbeigeführt, auch wenn sich darin eine stärkere gesellschaftliche Anerkennung von Erziehungs- und Pflegearbeit ausdrückt und der Benachteiligung von Mädchen und jungen Frauen bei der bislang stark geschlechtsspezifisch geprägten Berufswahl die wesentliche Grundlage entzogen würde (vgl. näher hierzu Lemmermöhle 2001).
Festzustellen ist heute die weitere Verlagerung von Erwerbstätigkeiten: vom industriellen Bereich in den Dienstleistungsbereich, von der Normalarbeit zu den anderen Erwerbsformen wie geringfügige Beschäftigung, Werkvertrags- und Leiharbeit bis hin zur so genannten neuen Selbstständigkeit etwa in der Form der "Ich-AG". Oschmiansky/ Schmid vom Wissenschaftszentrum Berlin plädieren für eine "institutionelle Absicherung von Übergängen zwischen den verschiedenen Erwerbsformen, um soziale Ausschließung zu vermeiden und zu einer Neuverteilung der Arbeit bei gleichzeitiger Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit beizutragen" (Oschmiansky/ Schmid 2000, S. 5; als Beispiel für die erfolgreiche Neuregelung von "Übergängen" dient die dänische Qualifikations-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik; vgl. hierzu Braun 2003).
Trotz des Rückgangs der Erwerbsquote im Normalarbeitsverhältnis und der Zunahme anderer Erwerbsarbeitsformen mit höheren sozialen Risiken bis hin zur sozialen Ausschließung bleibt die Erwerbsarbeit auch im Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungs- oder Wissensgesellschaft die anerkannteste Form der Arbeit. Insofern bewegen wir uns weiterhin in der historischen Form "Wirtschaftsgesellschaft" (vgl. Polanyi 1979), in der die vor allem ökonomisch determinierte Erwerbsarbeit das "organisierende Zentrum" der Lebensführung bildet. Durch sie werden für Individuum und Gesellschaft zugleich Wohlstand möglich, aber auch Problemlagen erzeugt, die zum Teil durch "Familienarbeit" bzw. Sozialpolitik wiederum kompensiert werden müssen (vgl. Famulla 1990).
Fazit: Bei der Berufsorientierung in der Schule sollte ein erweiterter Arbeitsbegriff zugrunde gelegt werden, der neben der Erwerbsarbeit die Hausarbeit und Bürgerarbeit umfasst. In der Wirtschaftsgesellschaft bildet die Erwerbsarbeit das organisierende Zentrum der Lebensführung, eine Auseinandersetzung mit ihren ökonomischen und sozialen Bedingungen ist unabdingbar (Aneignung arbeits- und berufsbezogener Wirtschaftskenntnisse).
Diese Herausforderung enthält nur scheinbar ein Paradox. Nicht von der berufsförmigen Arbeit gilt es Abschied zu nehmen, sondern von der Annahme, den Ausbildungsberuf ein ganzes Leben lang, womöglich noch in einem einzigen Betrieb ausüben zu können. Die veränderten und sich rascher wandelnden Qualifikationsanforderungen des Beschäftigungssystems müssen mit den Bildungs-, Arbeits- und Lebensansprüchen der Menschen, insbesondere der Jugendlichen, in Einklang gebracht werden. Immer häufiger wird heute die Frage gestellt, ob dieser Abstimmungs- und Anpassungsprozess im Rahmen der beruflich organisierten und qualifizierten Arbeit noch zu schaffen ist oder ob der Beruf "out" ist und mit dem Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft, vom Facharbeiter zum Wissensarbeiter ("Symbolanalytiker") seine Brücken- und Integrationsfunktion verliert, wie etwa der Berufssoziologe Martin Baethge meint (vgl. Baethge 1996)?
Zur Rolle des Berufs bei der Abstimmung zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem liegen unterschiedliche Einschätzungen vor. Auch gibt es verschiedene Reformkonzepte (vom Bundesinstitut für Berufliche Bildung, vom Deutschen Industrie- und Handelstag wie auch von den Handwerkskammern), um eine bessere Anpassung zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem zu ermöglichen. Danach geht die Tendenz langfristig dahin, Berufsausbildung stärker auf die Vermittlung theoretisch anspruchsvoller und extrafunktionaler Kompetenzen zu konzentrieren. Es soll eine berufliche Grundqualifikation vermittelt werden, auf der ein stärker am Arbeitsmarkt bzw. an betrieblichen Anforderungen orientiertes und gestaltbares System der beruflichen Weiterbildung aufsetzt (vgl. in diesem Sinne auch Rebmann u. a. 1998, S. 64).
Neben der Bündelung von Arbeitsanforderungen zu marktfähigen Qualifikationen mittels Ausbildungsordnungen ist die wichtige psychosoziale Funktion des Berufs hervorzuheben, wenn man danach fragt, welchen Beitrag Berufsvor- und ausbildung für die Integration der Jugendlichen in die Gesellschaft leisten. Über den Beruf werden ja nicht nur marktfähige Qualifikationen gebündelt, Wertorientierungen und Haltungen vermittelt, gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung erreicht, über den Beruf und die Berufswahl werden "Lebenspläne" entwickelt. Es scheint, als ob die meisten hiermit auch gut fahren: Nach einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft würden immerhin 73 Prozent aller Ausgebildeten im Westen und 80 Prozent aller Ausgebildeten im Osten die gleiche Ausbildung noch einmal wählen (vgl. iwd 46/1999, S. 6).
Fazit: Für den "Übergang von der Schule in das Wirtschaftsleben" behält der Beruf seine Leitfunktion. In einer dynamischen Arbeitswelt, die von einer zunehmenden Dynamisierung und Auflösungstendenzen im Status der Erwerbstätigen geprägt ist, kommt dem "Beruf als Identifikationsanker" eine steigende Bedeutung zu (vgl. in diesem Sinne Dostal 2002). Dem steht nicht entgegen, dass die Kategorie des Berufs in der beruflichen Bildung zunehmend in der Zielformel "berufliche Handlungsfähigkeit" und hierzu gehöriger Einzelkompetenzen konkretisiert wird. Allenfalls wird hierdurch ein erheblicher Reformbedarf signalisiert, was die Gewichte und die Formen der Aneignung der als notwendig erkannten Sach-, Sozial-, Methoden- und Selbstkompetenz angeht.
Welche Folgerungen ergeben sich nun aus diesen drei zentralen Herausforderungen an Arbeit und Beruf für den Übergang an der "ersten Schwelle"? Die strukturellen Veränderungen innerhalb der Erwerbsarbeit - Stichworte: Mikroelektronik, Dienstleistungen, Internationalisierung, Flexibilisierung - haben zwar eine erneute Diskussion um die Zukunft und Reform des dualen Systems der Berufsbildung angestoßen. Für die Phase der Berufsvorbildung haben sie jedoch noch keine vergleichbaren Veränderungsimpulse ausgelöst. Deutlich wird dies daran, dass mit den "alten" Begriffen wie "Berufswahlfähigkeit", "Ausbildungsfähigkeit" und "Arbeitsmarktfähigkeit" allein das Verhältnis von geänderten subjektiven Interessenlagen der Jugendlichen bei der Berufswahl einerseits und den neuen Herausforderungen der Arbeitswelt andererseits nicht mehr angemessen bezeichnet werden kann. "Berufswahlfähigkeit" verengt die wichtige Kategorie des Berufs als Schnittpunkt objektiver Arbeitsmarkterfordernisse und subjektiver Entwicklungsbedürfnisse in und mit der Arbeit. "Ausbildungsfähigkeit" verengt die Wahrnehmung und Stärkung der Kompetenzen von Jugendlichen zu sehr auf die Erfordernisse des Beschäftigungssystems. Der Begriff "Berufsorientierung" scheint noch am wenigsten vorbelastet, wenn auch bislang eher ein "dünnes Abstraktum".
Nimmt man den Begriff "Berufsorientierung" gleichwohl als eine Art Suchbegriff, um die neue Situation am Übergang Schule-Arbeitsleben und vor allem die neu zu entwickelnden oder zu stärkenden Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern näher bestimmen zu können, so muss hier auch mehr als das traditionelle Verständnis von "Berufswahlfähigkeit" gemeint sein (zu einem erweiterten Begriff von Berufsorientierung, bei dem die Berufswahlvorbereitung nur eine von vier Dimensionen bezeichnet vgl. auch Schudy 2002). Unter "Berufswahlfähigkeit" konnte man bis weit in die siebziger Jahre hinein noch die Fähigkeit verstehen, sich unter genauer Kenntnis seiner Wünsche und Fertigkeiten wie auch des zumeist regionalen betrieblichen Ausbildungsplatzangebots für einen "Lebensberuf" entscheiden zu können.
Aus der Jugendforschung wie auch aus Untersuchungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Schober/ Gaworek 1996; Fobe/ Minx 1996) wissen wir von der hohen Bedeutung, die Ausbildung und Beruf nach wie vor für die Jugendlichen haben. Zugleich ist zu konstatieren, dass die Gestaltung der Berufsbiografie weniger nach vorgegebenen Mustern verläuft, sondern zunehmend in die Entscheidung und Verantwortung des Einzelnen gelegt ist und die Berufswahl, als ein anhaltender, stufenweiser Prozess von Qualifikations- und Arbeitsplatzentscheidungen zu verstehen ist. Berufsorientierung wandelt sich von der gesteuerten Orientierung auf den Lebensberuf zu einer eigenverantwortlichen Berufswahl als Prozess, wobei man versucht, auf jeder Stufe Optionen für mehrere berufliche Alternativen zu erlangen.
Diese neue Art der Berufsorientierung, zu der das Entwerfen eines eigenen Zukunftskonzepts ebenso wie das Wissen um die betrieblichen Flexibilitätserfordernisse gehört, macht eine stärkere Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft erforderlich. Hierzu sind bei Wahrung und Akzeptanz aller Unterschiede in den Zielsetzungen beider Bereiche innovative Impulse gefragt, wie sie vom Programm "Schule-Wirtschaft/ Arbeitsleben" gewünscht und gefördert werden (vgl. hierzu Programm "Schule-Wirtschaft/ Arbeitsleben": Zwischenbericht, Flensburg/ Bielefeld 2001).
Die Abstimmung zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem ist kein eigengesetzlicher Prozess, sondern Resultat von Gestaltungsprozessen der beteiligten Akteure. Hieraus erwächst für die Jugendlichen zugleich eine wachsende Eigenverantwortung auch für die Gestaltung der eigenen Arbeits- und Berufsbiografie. Gefordert sind hierauf bezogene neue Curricula sowie Lehr- und Lernmethoden, die besonders auf die Förderung von Selbstständigkeit, Team- und Kommunikationsfähigkeit orientieren.
Förderprogramme, Initiativen und unterstützende Maßnahmen seitens der arbeits- und bildungspolitisch Verantwortlichen können helfen, die Suche nach neuen Wegen zur Gestaltung von Berufs- und Erwerbsarbeit bereits in der Phase der Berufsvorbildung mit nachhaltiger Wirkung beginnen zu können.
Für die Jugendlichen ergeben sich hieraus je nach Qualifikationsvoraussetzungen unterschiedliche Probleme, aber auch Chancen. Nach den Prognosen der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung wird insbesondere für gering Qualifizierte das Arbeitsplatzangebot weiter schrumpfen. Aber auch höher Qualifizierte in abhängiger Beschäftigung werden nicht mehr die Sicherheit des Arbeitsplatzes vorfinden, die für sie bis in die siebziger Jahre anzutreffen war (vgl. Jansen 2000). Daraus folgt für die pädagogisch und politisch Verantwortlichen im Bereich der Berufsorientierung an allgemein bildenden Schulen, sich einerseits stärker als bisher auf die so genannten besonderen Gruppen ("Benachteiligte") zu konzentrieren und andererseits der Befähigung zum selbstständigen, eigen- und sozial verantwortlichen Handeln bis hin zur Option auf unternehmerische Selbstständigkeit ein größeres Gewicht einzuräumen.
Vor dem Hintergrund der vorstehenden Anmerkungen zum Wandel in der Berufs- und Arbeitswelt ist die Konkretion und Anwendung der Ziele und Förderkriterien zu verstehen, die sich aus dem Rahmenkonzept des Förderprogramms "Schule-Wirtschaft/ Arbeitsleben" ergeben und die für die Beratung und Begutachtung der einzelnen Projekte bedeutsam sind. Bei diesen Kriterien wird dem Aspekt "Berufsorientierung" angesichts des Wandels der Arbeits- und Berufswelt ein besonderes Gewicht zugemessen. Zugleich wurde und wird im Einzelnen gefragt, ob und welchen spezifischen Beitrag die Projekte etwa zur Stärkung der Ausbildungsfähigkeit von Mädchen leisten, ob und wie die Vermittlung ökonomischer Grundkenntnisse angestrebt wird, welchen innovativen Beitrag das einzelne Projekt vor dem Hintergrund bereits laufender Maßnahmen im jeweiligen Bundesland leistet und wie die überregionale Kooperation, der Transfer von Projektergebnissen und die Vernetzung dieses Projektes mit anderen Projekten des Programms und darüber hinaus realisiert wird.
Selbstverständlich musste mit dem Programm "Schule-Wirtschaft/ Arbeitsleben" bei der "bildungswirksamen Hinführung zur modernen Arbeitswelt" nicht noch einmal da angefangen werden, wo im Jahre 1964 der Deutsche Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen schon die Arbeitslehre als "Eingangsstufe des beruflichen Bildungsweges" konzipierte. Seither gab es zu diesem Thema nicht nur eine Textflut von circa 8.000 Titeln, über 50 Schulversuche und zahlreiche Kongresse. Es sind in allen Bundesländern auf den Ebenen Lehrplan, Lehrerausbildung sowie Unterrichtspraxis institutionelle und curriculare Maßnahmen ergriffen worden, um diesen wichtigen Bereich im allgemein bildenden Schulbereich zu regeln (zur Darstellung und Kritik vgl. Ziefuss 1993).
Gleichwohl werden der Stellenwert der Arbeitslehre bzw. der Berufsvorbildung in der Schule, die Lehrerausbildung wie auch die Stundentafel hierzu weithin und schon seit längerem als defizitär beklagt. Hinzu kommt, dass auf den oben angeführten Strukturwandel der Arbeit mit seinen zentralen Herausforderungen auch neue inhaltliche Antworten im Rahmen der Berufsvorbildung gefunden werden müssen.
Das Programm "Schule-Wirtschaft/ Arbeitsleben" kann als eine solche systematische und anspruchsvolle, in vielen Teilen auch verallgemeinerbare, Antwortsuche verstanden werden, wenn man sich das Rahmenkonzept sowie die Gegenstände der bewilligten Projekte vergegenwärtigt. Nach dem Rahmenkonzept des SWA-Programms steht die Förderung innovativer Projekte zur Verbesserung des Übergangs von der Schule in das Berufsleben im Zentrum.
Gegenstand der Innovation können recht unterschiedliche Inhalte sein. Im Bereich der Berufsorientierung beziehen sich die wichtigsten Innovationsinhalte auf methodische (z. B. Lehr-/ Lernarrangements), personale (z. B. Kompetenzentwicklung) oder organisatorische Aspekte (z. B. Stundentafel). In der Praxis sind diese Aspekte kaum zu trennen, da beispielsweise für die Entwicklung neuer Lernarrangements auch organisatorische und personelle Veränderungen notwendig sein können. Eine Innovation muss dabei nicht etwas im globalen Maßstab grundsätzlich Neues sein, sondern kann auch eine Neuerung oder Veränderung in einer bestimmten Region oder für bestimmte Nutzergruppen bedeuten, die in anderen Kontexten bereits seit längerem eingeführt ist. So besteht eine innovative Aufgabe für SWA-Projekte darin, Maßnahmen so umzubauen und so zu kombinieren, dass sie zweckdienlich und effektiv eingesetzt werden können (Beispiel: Betriebspraktikum) und so zu organisieren, dass sie alltagstauglich werden (Beispiel: Qualitätsmanagement an Schulen).
Das Gros der Projekte verfolgt als Hauptziel zu etwa gleichen Teilen entweder Veränderungen auf der personalen Ebene bei den Jugendlichen und den Lehrkräften oder der methodischen Ebene, also der Form der Vermittlung von Erkenntnissen. Innovationen auf organisatorischer Ebene stehen bisher nur bei wenigen Projekten im Vordergrund.
Die Projekte sind bei aller Gemeinsamkeit in der Verfolgung des Oberziels (Entwicklung innovativer und nachhaltig wirksamer Maßnahmen zur Stärkung der Kompetenzen von Jugendlichen beim Übergang von der Schule in das Berufsleben) im Hinblick auf Ausgangsbedingungen, spezifische Projektziele, Gegenstände und Maßnahmen kaum vergleichbar. Zum breiten Spektrum der Projektgegenstände gehören:
Zieht man nach etwa drei Jahren Laufzeit ein erstes Zwischenfazit zur Arbeit im Programm "Schule-Wirtschaft/ Arbeitsleben", zeichnen sich die Umrisse oder zumindest Akzente eines neuen Verständnisses von Berufsorientierung ab.
Aus fachlicher Sicht und vor einer Erörterung von Schlussfolgerungen aus der bisherigen Programmarbeit können die möglichen Konturen eines veränderten Verständnisses von Berufsorientierung bezeichnet werden:
Aufgrund bisheriger Erfahrungen und Erkenntnisse konnten bereits neue Akzente bei der Programmgestaltung gesetzt und die Durchführung der neuen Projekte verbessert werden. In der zweiten Projektrunde sind vor allem Themen wie planmäßige Gründung und Organisation von Netzwerken, der Transfer von Projektideen und -ergebnissen, das systematische Vorantreiben von Schulentwicklungsprozessen und die Beschäftigung mit besonderen Gruppen stärker in den Vordergrund gerückt.
Aus fachlicher Sicht und vor einer Erörterung von Schlussfolgerungen aus der bisherigen Programmarbeit können die möglichen Konturen eines veränderten Verständnisses von Berufsorientierung bezeichnet werden:
Aufgrund bisheriger Erfahrungen und Erkenntnisse konnten bereits neue Akzente bei der Programmgestaltung gesetzt und die Durchführung der neuen Projekte verbessert werden. In der zweiten Projektrunde sind vor allem Themen wie planmäßige Gründung und Organisation von Netzwerken, der Transfer von Projektideen und -ergebnissen, das systematische Vorantreiben von Schulentwicklungsprozessen und die Beschäftigung mit besonderen Gruppen stärker in den Vordergrund gerückt.
Baethge, Martin (1996): Berufsprinzip und duale Ausbildung: Vom Erfolgsgaranten zum Bremsklotz der Entwicklung? In: Wittwer, Wolfgang (Hrsg.): Von der Meisterschaft zur Bildungswanderschaft. Bielefeld, 109-124.
Beck, Ulrich (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt.
Bothmer, Henrik von (1996): Benachteiligte Jugendliche - chancenlos? In: Modernisierungsbedarf und Innovationsfähigkeit der beruflichen Bildung. Gesprächskreis Arbeit und Soziales Nr. 65. Hrsg. von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn.
Braun, Thorsten (2003): Ein neues Modell für Flexicurity - der dänische Arbeitsmarkt. In: WSI-Mitteilungen, Heft 2, 92-99.
Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.)(1999): Dienstblatt 37/99 vom 15. September 1999.
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)(Hrsg.)(2002): Berufsbildungsbericht 2002, Bonn.
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Rahmenkonzept zum Programm "Schule-Wirtschaft/ Arbeitsleben" (unveröffentlicht). Verfügbar über Internet: http://www.swa-programm.de [20].
Dedering, Heinz (1994): Einführung in das Lernfeld Arbeitslehre. München-Wien.
Dostal, Werner (2002): Der Berufsbegriff in der Berufsforschung des IAB. In: Kleinhenz, Gerhard (Hrsg.): IAB-Kompendium Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. BeitrAB 250, 463-474.
Enggruber, Ruth (1997): Benachteiligte des dualen Systems - chancenlos? In: Euler, Dieter; Sloane, Peter F. E. (Hrsg.): Duales System im Umbruch. Eine Bestandsaufnahme der Modernisierungsdebatte. Pfaffenweiler, 201-221.
Emnid-Institut (Hrsg.) (1991): Forschungsprojekt: Sammlung von Daten und Fakten über Jugendliche ohne abgeschlossene Berufsausbildung - Abschlussbericht. Bielefeld.
Famulla, Gerd-E. (1990): Zum Wandel von Arbeit und Ökonomie. In: Cremer, Will; Klein, Ansgar (Hrsg.): Umbrüche in der Industriegesellschaft. Herausforderungen für die politische Bildung. Opladen, 51-72.
Feldhoff, Jürgen; Jacke, Norbert; Simoleit, Jürgen (1995): Schlüsselqualifikationen für neue Anforderungen in Betrieb und Gesellschaft. Reformen im Spannungsfeld von allgemeinbildender Schule und beruflicher Praxis. Düsseldorf.
Fobe, Karin; Minx, Bärbel (1996): Berufswahlprozesse im persönlichen Lebenszusammenhang. Jugendliche in Ost und West an der Schwelle von der schulischen in die berufliche Ausbildung. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 196, Nürnberg.
Gewerkschaftliche Bildungspolitik (GewBiPol) (2000): Heft 3-4.
Informationsdienst der deutschen Wirtschaft (iwd) (1999): Nr. 46.
Jansen, Rolf (2000): Auswirkungen des Strukturwandels auf die Arbeitsplätze - Ergebnisse aus der BIBB/IAB-Erhebung 1998/99 zum Erwerb und Verwertung beruflicher Qualifikation. In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP), Heft 2, 5-10.
Keller, Berndt; Seifert, Hartmut (2000): Flexicurity - Das Konzept für mehr soziale Sicherheit flexibler Beschäftigung. In: WSI-Mitteilungen, Heft 5, 291-300.
Kloas, Peter W. (1996): Benachteiligtenförderung - ein tragfähiger Förderansatz auch fürs nächste Jahrzehnt? In: Qualifizierung baut auf! 15 Jahre Benachteiligtenprogramm. Dokumentation der Fachkonferenz am 15. und 16. November in Erfurt. Hrsg. vom heidelberger institut für beruf und arbeit.
Lemmermöhle, Doris (2001): Der Blick aufs Ganze fehlt: Geschlecht und Geschlechterverhältnisse in der Arbeitslehre und der berufsorientierenden Bildung. In: Hoppe, Heidrun; Kampshoff, Marita; Nyssen, Elke (Hrsg.): Geschlechterperspektiven in der Fachdidaktik. Weinheim/ Basel, S. 173-196.
Lösel, Friedrich (1991): Evaluationsforschung in Deutschland. Probleme und Perspektiven. (Beitrag ohne nähere Quellenangaben), S. 91.
Nordverbund im Programm "Schule-Wirtschaft/ Arbeitsleben" (Hrsg.) (2002): Leitfaden zum Berufswahlpass. Ein Instrument zur Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler. Berlin.
Oschmiansky, Heidi; Schmid, Günter (2000): Wandel der Erwerbsformen - Berlin und die Bundesrepublik im Vergleich. In: WZB - Mitteilungen, Heft 88, S. 3-5.
Polanyi, Karl (1979): Ökonomie und Gesellschaft. Frankfurt a.M.
Programm "Schule-Wirtschaft/ Arbeitsleben" (2001): Zwischenbericht. Flensburg/Bielefeld.
Pütz, Helmut (2003): Wer engagiert sich für betriebliche Ausbildungsplätze? In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis. Heft 1, 3f.
Reindl, Josef (2000): Scheinselbstständigkeit. In: Leviathan. Zeitschrift für Sozialwissenschaft. Heft 4, 413-433.
Rebmann, Karin; Tenfelde, Walter; Uhe, Ernst (1998): Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Eine Einführung in Strukturbegriffe. Wiesbaden.
Schober, Karen; Gaworek, Maria (Hrsg.) (1996): Berufswahl: Sozialisations- und Selektionsprozesse an der ersten Schwelle. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 202, Nürnberg.
Schober, Karen; Tessaring, Manfred (1993): Eine unendliche Geschichte - Vom Wandel im Bildungs- und Berufswahlverhalten Jugendlicher. In: IAB (Hrsg.): Materialien aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Nürnberg. Heft 3.
Schudy, Jörg (2002): Berufsorientierung als schulstufen- und fächerübergreifende Aufgabe. In: ders. (Hrsg.): Berufsorientierung in der Schule. Bad Heilbrunn/ Obb., 9-16.
Strikker, Frank (1991): Benachteiligte im Berufsbildungssystem - Strukturen, Ursachen, künftige Entwicklung und Maßnahmen - ; Gutachten für die Enquete-Kommission "Zukünftige Bildungspolitik - Bildung 2000" des Deutschen Bundestages. Bonn.
Voß, G. Günther; Pongratz Hans G. (1998): Der Arbeitskraftunternehmer. Eine neue Grundform der "Ware Arbeitskraft"? In: KZfSS, 50 (1), 131-158.
Wagner, Alexandra; Gensior, Sabine (1999): Zukunft der Arbeit. In: Expertisen für ein Berliner Memorandum zur Modernisierung der beruflichen Bildung. Berlin, 51-82.
Ziefuss, Horst (1993): Versuch einer Standortbestimmung der Arbeitslehre unter dem Gesichtspunkt von Lehrplanentwicklung und Lehrerbildung. In: Meier, Bernd (Hrsg.): Lehrerbildung im Lernfeld Arbeitslehre. Hamburg, 47-63.
[/S. 207:] Jugendliche, die heute in Deutschland die Hauptschule ohne Abschluss verlassen oder eine Förderschule beenden, haben erhebliche Nachteile bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Vor allem in den neuen Bundesländern gilt dies, aber auch für viele erfolgreiche Hauptschul- oder gar RealschulabgängerInnen. Wer, aus welchen Gründen auch immer, nicht unmittelbar nach dem Schulabschluss einen Ausbildungsplatz sucht und findet, gilt als benachteiligt. Berufliche Orientierung bedeutet in dieser biografischen Situation die Wahl zwischen einer Verlängerung der Schulzeit und der Teilnahme an einer der zahlreichen Maßnahmen, die von der Bundesanstalt für Arbeit (BfA) [1] gefördert und von einem breiten Feld außerschulischer Träger der Benachteiligtenförderung angeboten werden. Er (1) kann z. B. ein Berufsvorbereitungsjahr an einer Berufsschule besuchen (68.600 Teilnehmer im Schuljahr 1999/ 2000), um dort im günstigen Fall nachträglich den Hauptschulabschluss zu erwerben; oder er kann an einem außerschulischen Programm (65.428 Teilnehmer) teilnehmen und dort neben einer gezielten Förderung der schulischen Leistung vor allem praktische Erfahrungen in verschiedenen Berufsfeldern sammeln.
Für Jugendliche mit schlechten Startchancen gibt es neben diesen Maßnahmen der Berufsvorbereitung auch die Möglichkeit einer regulären Ausbildung in außerbetrieblichen Werkstätten mit gezielter sozialpädagogischer Unterstützung (67.019 Teilnehmer). Jugendliche, die eine Ausbildung nicht aus eigener Kraft erfolgreich abschließen, können ausbildungsbegleitende Hilfen in Anspruch nehmen (67.468 Teilnehmer, alle Zahlen für das Jahr 2000, Berufsbildungsbericht 2001) und für diejenigen, die Probleme an der zweiten Schwelle haben und nach erfolgreicher GesellInnenprüfung nicht sofort Arbeit finden, wird Hilfe bei der anschließenden [/S. 208:] Suche nach einem Arbeitsplatz angeboten. All diese Angebote werden unter dem Begriff Benachteiligtenförderung subsumiert und bezeichnen ein Subsystem der beruflichen Bildung, das sich in den vergangenen 25 Jahren in Deutschland parallel zum dualen System herkömmlicher Prägung etabliert hat.
Das Ziel der von der BfA geförderten Maßnahmen ist es, Jugendliche auf eine Ausbildung im dualen System vorzubereiten. Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist dabei der Hauptindikator für die so genannte Berufsreife der Hauptschulabschluss, wenngleich die Förderung auch auf die Entwicklung von Sozial- und Selbstkompetenzen abzielt und praktische Erfahrungen in verschiedenen Berufsfeldern ermöglicht, die den Jugendlichen eine Berufswahl ermöglichen sollen, wo die Realität wenig Wahlfreiheit lässt. Neben der sozialen Integration und einer gezielten pädagogischen Vorbereitung auf eine Ausbildung haben diese Maßnahmen also auch die Funktion, regionale Knappheit auf dem Ausbildungsstellenmarkt zu korrigieren. Da zudem der Zugang zu den spezifischen Förderprogrammen an die Identifikation individueller Formen von Benachteiligung gekoppelt ist, ist dieser Bildungsbereich gekennzeichnet durch ein spezifisches Dilemma, das versucht, soziale, bildungspolitische und ökonomische Versäumnisse auf individueller Ebene zu kurieren.
Knapp zehn Prozent aller Ausbildungsverträge wurden im Jahr 2000 in einer außerbetrieblichen Einrichtung abgeschlossen. Insgesamt mündeten fast ein Fünftel aller Schulentlassenen in eine geförderte Maßnahme der Berufsvorbereitung oder der Benachteiligtenförderung. Fast ein Viertel der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge wurden wieder gelöst; von denjenigen, die die Abschlussprüfung erfolgreich ablegen konnten, waren ebenfalls fast ein Viertel (24,3 %) anschließend arbeitslos (ebd., S. 85, 197). Die jüngsten positiven Trends auf dem Ausbildungsstellenmarkt kommen in erster Linie Abiturienten zugute. Nur in den Berufen des Banken-, Versicherungs-, und Reiseverkehrsgewerbes stieg die Zahl der Ausbildungsplätze, in den übrigen Berufen, für die nicht das Abitur als inoffizielle Eingangsvoraussetzung gilt, sank die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze (vgl. BIBB - Forum, 6/2001). Die Zahl der außerbetrieblichen Ausbildungen steigt hingegen seit Jahren konstant an. Allerdings gibt es hier erhebliche regionale Unterschiede, insbesondere zwischen den alten und neuen Bundesländern. In der Praxis hat sich der Einstieg ins Erwerbsleben auch für diejenigen Jugendlichen verzögert, die sich nicht für eine höhere Schulbildung entschieden haben. Während 1970 Auszubildende im Durchschnitt 16,6 Jahre alt waren, sind sie heute 19 Jahre alt.
Diese Zahlen sind Indizien dafür, dass der normative Diskurs der Normalbiografie brüchig geworden ist. Die Vorstellung, dass auf den erfolgreichen Abschluss einer allgemein bildenden Schule eine Ausbildung folgte, die auf [/S. 209:] geradem Weg zur Ergreifung eines Lebensberufes führte, hat ihre Gültigkeit verloren. Dies gilt vor allem für jene Jugendliche, die die Selektionsmechanismen des deutschen (Aus-)Bildungssystems nicht erfolgreich durchlaufen. Für sie gibt es in der Regel keinen direkten Weg in die Berufstätigkeit, statt dessen müssen sie sich über Umwege und Warteschleifen in Maßnahmen mit Drehtüreffekten auf eine ungewisse berufliche Zukunft vorbereiten, in der sich Phasen von Arbeitslosigkeit mit prekären und instabilen Arbeitsverhältnissen abwechseln werden. Das Konzept eines Lebensberufes, das angesichts der technologischen Entwicklung und des Wandels auf dem Arbeitsmarkt ohnehin fragwürdig geworden ist, kann für Jugendliche mit ungünstigen Startchancen heute kein Maßstab mehr sein. Angesichts der in unserer Gesellschaft weiterhin vorherrschenden normativen Kraft des Ausbildungsgedankens gerät dies nicht nur zu einem bildungspolitischen, sondern auch zu einem sozialpolitischen Problem.
Die Idealvorstellung, nach der sich die berufliche Orientierung von Jugendlichen als ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess im Sinne einer fortschreitenden Vorwärtsbewegung vollzöge, ist einer kritischen Revision zu unterziehen. Auf diesem Weg vom Schulabschluss bis zur erfolgreichen Einmündung in den Beruf stehen Jugendlichen längst nicht alle Türen offen, sie treffen auf Stolpersteine, die sie aus dem Takt bringen und sie müssen an vorgegebenen Stellen Hürden in Gestalt von Prüfungen überwinden, die oft endgültig über die weitere Richtung entscheiden. Diese Hindernisse auf dem Weg ins Erwachsenen- und Berufsleben lassen sich durch die Analyse eines modellhaften Prozessverlaufs als kritische Punkte identifizieren, die sich nachteilig auf die Berufschancen von Jugendlichen auswirken. Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern wird dabei deutlich, inwieweit diese Hürden durch das Bildungssystem selbst gesetzt und soziokulturell geprägt sind.
Unter dem Paradigma der subjektorientierten individuellen Kompetenzentwicklung wird der Begriff Benachteiligung, der implizit auf die Grenzen der entsprechenden Förderkonzepte verweist, gern vermieden. Statt dessen spricht man lieber von Jugendlichen mit schlechten Startchancen. Doch worin bestehen diese Startchancen, was macht ihre Qualität aus? Um im Bild zu bleiben: welche Gestalt haben die Stolpersteine, wie hoch sind die Hürden und wer verfügt über die Schlüssel für die verschlossenen Türen?
Schon lange bevor ein Jugendlicher eine Entscheidung für (oder gegen) einen Ausbildungsplatz treffen kann, hat er bereits institutionelle, ideologische und soziale Selektions- und Normierungsprozesse durchlebt, die seine [/S. 210:] Chancen auf dem Ausbildungsmarkt wesentlich prägen. Zentrale Bedeutung für den erfolgreichen Verlauf ebenso wie für die Störungen der Bildungsbiografien von Jugendlichen kommt dabei der Rolle und Funktion von Schule zu.
Bereits wenn ein Kind zehn Jahre alt ist, entscheiden in den meisten Bundesländern LehrerInnen und Eltern über den weiteren Schulweg und damit auch über die Orientierung in Richtung auf eine höhere, akademische Bildung oder in Richtung auf einen Ausbildungsberuf. Eine positive Veränderung dieser Entscheidung ist später kaum noch möglich, ohne gleichzeitig eine deutliche Verlängerung der (Aus-)Bildungszeit in Kauf zu nehmen.
In einer Gesellschaft, in der Bildung als Kapital und Chance gewertet wird, gerät die zentrale Vermittlungsinstanz Schule zum Risikofaktor, dessen Selektionsmechanismen über zukünftige Chancenverteilung entscheiden. Leistungsdruck und Lernkultur in der Regelschule sind oft schon für Kinder aus intakten sozialen Verhältnissen schwer zu bewältigen, unter verschärften Bedingungen stehen sie positiven Lernerfahrungen und Erfolgserlebnissen erst recht entgegen. Soziale Probleme wirken sich negativ auf das schulische Lernen aus. Jugendlichen, die gestörte Beziehungserfahrungen bewältigen müssen, die erhebliche Geldsorgen haben oder denen Gewalt angetan wurde, gelingt es oft nicht, den schulischen Anforderungen gerecht zu werden; dies gilt auch für Jugendliche, die mit Suchtproblemen kämpfen oder mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Aber auch diejenigen Jugendlichen, in deren kultureller Orientierung eine duale Ausbildung einen weniger zentralen Stellenwert einnimmt oder die Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben, sind oft nicht einfach für einen deutschen Hauptschulabschluss zu motivieren.
Allerdings haben die schulischen Bewertungsmechanismen eine so zentrale soziale Orientierungsfunktion, dass sie in hohem Maße entscheidend für eine gelungene Integration in Arbeit geworden sind - bzw. für den sozialen Ausschluss. Auf den ersten Schritten ins Arbeitsleben haben Jugendliche neun oder zehn Jahre Schulerfahrung im Gepäck und insbesondere das letzte Zeugnis kann sich als Ballast erweisen. Für Ausbilder und Arbeitgeber ist es in der Regel das Hauptkriterium für eine erste Einstellungsentscheidung. Hinzu kommt, dass in vielen Berufen die Einstellungsvoraussetzungen in den vergangenen Jahren stetig gestiegen sind, so dass ein mittlerer Bildungsabschluss heute als "Leitwährung" (Storz 1999) gilt, mit der ein Ausbildungsplatz erworben werden kann.
Schule erweist sich in dreierlei Hinsicht als Risikofaktor für Benachteiligungen: Erstens ist das für eine gelungene Integration in Ausbildung und [/S. 211:] Beruf gerade unter erschwerten Bedingungen notwendige Handlungs- und Orientierungswissen nicht Bestandteil der aktuellen Curricula (Warzecha 2001, S. 7). Die Inhalte und Methoden schulischen Lernens sind wenig am Arbeitsleben orientiert (vgl. auch Rademacker 2002) und nicht ausreichend auf die Sozialwelt der Jugendlichen bezogen. Was in der Schule gelehrt wird, erscheint für den Alltag sozial benachteiligter Jugendlicher oft wenig handlungsrelevant. Zweitens befähigen schulspezifische Lernformen und Vermittlungskulturen nicht zu einer selbstständigen, selbstbewussten, kreativen beruflichen Orientierung. Schulische Lernerfahrungen erweisen sich daher oft als schwere Hypothek in der Phase der beruflichen Orientierung. Die Art und Weise, wie Lernprozesse in der Schule als Wissensvermittlung organisiert sind, hat für die Mehrzahl der so genannten benachteiligten Jugendlichen dazu geführt, dass sie sich diesem Bewertungssystem entzogen haben, sei es durch Leistungsverweigerung oder durch gänzliche Schulabstinenz. Drittens schließlich wirken schulspezifische Bewertungssysteme als zentrale soziale Selektionsmechanismen.
Männliche Jugendliche haben durchschnittlich schlechtere Bildungsabschlüsse als ihre weiblichen Altersgenossinnen. Sie finden schwerer einen Ausbildungsplatz, obwohl dies eher von ihnen erwartet wird, denn nach wie vor wirkt das Modell des männlichen Familienernähers implizit in vielen Instanzen der geschlechtsspezifischen Sozialisation fort. Oft versuchen sie dieses Dilemma zwischen Verhaltensanforderung und real begrenzten Handlungsmöglichkeiten durch betont männliche Verhaltensmuster für sich zu lösen. Es sind daher in der Mehrzahl männliche Jugendliche, die zur Zielgruppe spezifischer Fördermaßnahmen werden.
Für weibliche Jugendliche stellt sich die Situation am Übergang von Schule in Ausbildung anders dar. Mit den Erziehungs- und Pflegeberufen z. B. stehen ihnen mehr schulische Ausbildungswege offen, die im Einklang mit geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen stehen. Allerdings wirkt sich ihr Geschlecht verstärkt benachteiligend aus, wenn sie unter erschwerten Bedingungen auf den Ausbildungsstellenmarkt treten. "Mädchen zu sein ist am Arbeitsmarkt schlimmer, als keinen Schulabschluss zu haben" (BMBF 1997, S. 21). [/S. 212:] Dies erfahren vor allem junge Migrantinnen oder junge allein erziehende Mütter, für die, zunächst als Modell, gezielte Förderprogramme entwickelt wurden.
Das Modell der dualen Berufsausbildung ist in unserer Gesellschaft überaus dominant. Die berufliche Orientierung Jugendlicher erfolgt in Deutschland stets im Blick auf einen Ausbildungsabschluss. Das wohl strukturierte Berufsbildungssystem erweist sich aber auch als Falle für diejenigen, die den Qualifikationsanforderungen nicht gerecht werden können, denn es erschwert weniger formale Übergänge in Ausbildung und Arbeit. Zudem stellt es junge Menschen zu einem relativ frühen Zeitpunkt vor Zukunftsentscheidungen mit großer Tragweite. In Skandinavien oder Großbritannien erscheint es normaler, dass Jugendliche sich noch nicht auf einen bestimmten Beruf festlegen, sondern sich zuvor in verschiedenen Tätigkeiten erproben möchten, dass sie zunächst eine Phase der Orientierung einfordern, die ihnen eine möglichst vielfältige Einsicht in das Arbeitsleben vermitteln sollte. So ist es für englische Jugendliche normal, nach der Schulzeit eine Zeit lang zu jobben, bevor sie sich auf einen bestimmten Beruf festlegen. In Ländern, deren Ökonomie von kleinen und mittleren Betrieben geprägt ist wie z. B. Griechenland, wird die soziale Integration von Jugendlichen oft durch die Mithilfe in Familienbetrieben gesichert. Andernorts finden - vor allem männliche - Jugendliche eine Beschäftigung auf dem grauen Arbeitsmarkt, mit der sie ihren Lebensunterhalt zumindest kurzfristig sichern können. Entsprechende Modellprogramme in Portugal wenden sich direkt an diese Zielgruppe und versuchen sie für eine Ausbildung zu motivieren.
Die klar geregelten Bahnen des Übergangs von Schule in Ausbildung werden in Deutschland von der Berufsberatung der Arbeitsämter [1] entscheidend mitgestaltet. Die Beratung orientiert sich in aller Regel stärker an den Gegebenheiten des Arbeitsmarktes als an den individuellen Orientierungen. Mit ihrer Definitionsmacht über Benachteiligung sichert sie schulische und soziale Selektionsprozesse ab. Hinzu kommt, dass die erwachsenen Fachkräfte (Berufsberater, Lehrer, Sozialpädagogen), die den Berufswahlprozess von Jugendlichen begleiten sollen, Normen und Werte transportieren, die ihre eigenen Kenntnisse und Einstellungen über mögliche Ausbildungsberufe widerspiegeln und dadurch dem Entscheidungshorizont benachteiligter Jugendlicher nicht immer angemessen gerecht werden können. Sie orientieren sich implizit noch oft an der Idee des Normalarbeitsverhältnisses einer lebenslangen sozialversicherungspflichtigen Vollzeittätigkeit und nehmen nur selten Alternativen dazu in den Blick. "Bei der Festlegung des Ausbildungsangebotes geben dann letztlich die vermeintlich [/S. 213:] unzureichenden Voraussetzungen der Jugendlichen und traditionelle handwerkliche idealisierende Berufsvorstellungen den Ausschlag. (...) Die Folge ist eine Ausbildung in wenig zukunftsträchtigen Berufen. (...) Trotz der dargestellten starken Personenorientierung in der Sichtweise wird die Ausbildung im Alltag sehr stark von den Anforderungen spezialisierter und veralteter Berufe bestimmt." (Biermann/ Rützel 1996, S. 6)
Wenn Jugendliche aufgrund ihrer biografischen Situation am Ende ihrer Schulzeit eine Berufswahlentscheidung (noch) nicht treffen können (was sich insbesondere am fehlenden Hauptschulabschluss festmacht), gelten sie als nicht ausbildungsreif. Sie können dann an einer einjährigen Maßnahme zur Berufsvorbereitung teilnehmen. In der Praxis ist dabei zu unterscheiden zwischen dem Besuch eines Ausbildungs- oder Berufsvorbereitungsjahres (AVJ/ BVJ) an einer Berufsschule und der Teilnahme an einer BfA-geförderten Maßnahmen eines freien Trägers. Die Entscheidung darüber, welcher der beiden Wege eingeschlagen wird, ist im Wesentlichen durch die Berufsberatung bestimmt.
Das schulische Berufsvorbereitungsjahr wird dabei durch die ausschließliche Fixierung auf das Nachholen des Hauptschulabschlusses und aufgrund der mangelnden Möglichkeiten einer weitergehenden Qualifizierung oder des Erwerbs von Arbeitserfahrung meist als unproduktive Warteschleife erlebt. "Der Sackgassencharakter des BVJ wird durch eine Doing-Gender-Struktur verstärkt: Die überwiegend geschlechter-homogene Aufteilung der Schülerinnen auf die Berufsschultypen verhindert, eigene Interessen und Fähigkeiten in einem breiteren Spektrum auszuprobieren. Insofern stellt es eine rein kompensatorische Maßnahme mit überdies geringen Vermittlungsquoten dar." (Schneider 2001, S. 3)
Im Kontrast dazu bieten die Maßnahmen außerschulischer Träger der Benachteiligtenförderung von ihrer Intention her eine sinnvollere Möglichkeit, das Berufsleben kennen zu lernen, die eigenen Chancen realistisch auszuloten und die Wahlmöglichkeiten zu vergrößern. Die Teilnahme an diesen Maßnahmen hat jedoch für die Jugendlichen ihren sozialen Preis. Sie ist nur möglich durch die Festschreibung eines "Devianz-Status". Die Bereitstellung von Sonderwegen lässt sich nur legitimieren durch die Identifikation eines Sonderstatus. Die Stigmatisierung als Benachteiligte ist somit zwingende Bedingung für staatliche Intervention und Hilfe (Ulrich 1998, S. 370). Dennoch wächst seit Ende der 70er Jahre die Zahl der Jugendlichen, denen ein Einstieg ins Erwerbsleben nur mit Hilfe zusätzlicher Förderung gelingt, [/S. 214:] kontinuierlich an. Die bunte Landschaft von staatlichen und arbeitsamtgeförderten Maßnahmen fungiert als Brücke zwischen Schule und Beruf mit dem Anspruch, soziale Desintegration zu verhindern und die Jugendlichen individuell auf eine Ausbildung vorzubereiten. Mit hohem finanziellen und pädagogischem Aufwand werden hier die Auswirkungen dominanter Selektionsprinzipien abgefedert und es wird versucht, strukturelle Mängel des Ausbildungssystems auszugleichen. In diesem Kontext von Berufswahl zu sprechen, suggeriert das Vorhandensein eines breiten Angebotes von Wahlmöglichkeiten. Bei genauerem Hinsehen erweist sich diese Vorstellung jedoch als Mythos. Insbesondere für benachteiligte Jugendliche stellt sich der Prozess der Auswahl eher im negativen Sinne als soziale Selektion dar.
Berufswahlentscheidungen von Jugendlichen sind in erster Linie durch ihr soziales Umfeld, die Familie und den Freundeskreis geprägt. Die hier vorherrschenden religiösen und kulturellen Orientierungen, die Vorstellungen über das Rollenverhalten von Männern und Frauen und die konkreten Berufserfahrungen wirken maßgeblich prägend auf die Vorstellung von Jugendlichen über ihre berufliche Zukunft. Gleichwohl besteht bei vielen zunächst eine Diskrepanz zwischen dem "Traumberuf" und den realistisch zu erwartenden Beschäftigungsperspektiven. Oft schätzen Jugendliche das Verhältnis von Arbeitstätigkeit, Entlohnung und Konsum falsch ein. Sie träumen von einem Beruf, bei dem sie viel Geld verdienen, wenig arbeiten und sich nicht dreckig machen. Wie wichtig es ist, in dieser biografischen Phase und unter diesen sozialen Bedingungen Raum und Zeit für eine berufliche Orientierung zu erhalten, zeigt die Tatsache, dass die Mehrheit der TeilnehmerInnen an einjährigen Berufsvorbereitungsmaßnahmen während dieser Zeit den Berufswunsch mindestens einmal ändert. (1) Diese Änderung kommt in der Regel einer realistischen Anpassung an die Gegebenheiten des lokalen Arbeitsmarktes und an die eigenen Potenziale gleich. Betriebspraktika sind dabei von zentraler Bedeutung.
Eine Wahl kann nur treffen, wer eine Auswahl hat. Für die Jugendlichen bedeutete dies, verschiedene Berufsfelder zu kennen und möglichst eigene Erfahrungen darin gemacht zu haben, bevor sie eine Entscheidung treffen. Das in den Fördereinrichtungen bereitgestellte Entscheidungsspektrum ist jedoch nur partiell durch die Gegebenheiten eines aktuellen Ausbildungsstellenmarktes geprägt. Die hauseigenen Angebote für eine praktische berufliche Erprobung sind begrenzt und bieten auch aus geschlechtsspezifischer Perspektive ein erschreckend konventionelles Bild. Eine Befragung des Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) [18] von Trägereinrichtungen für Maßnahmen der überbetrieblichen Berufsausbildung ergab im Jahr 2000, dass überwiegend in herkömmlichen, produktionsorientierten oder kaufmännischen Berufsfeldern ausgebildet wird. Maßnahmen, die Jugendliche an die [/S. 215:] neueren IT- oder Dienstleistungsberufe heranführen, sind vergleichsweise selten (vgl. Linder 2000) (2). Auch die Maßnahmen zur Berufsvorbereitung konzentrieren sich vor allem auf die Berufsfelder Holztechnik, Hauswirtschaft, Wirtschaft und Verwaltung, Metalltechnik, Farbtechnik und Raumgestaltung. (vgl. BIBB-forum 11/2001)
Entsprechend zeigt eine Analyse der Berufe, die von Jugendlichen in überbetrieblichen Ausbildungsverhältnissen gewählt wurden, ein eher traditionelles Bild, das stark von Geschlechterstereotypien geprägt ist. Mädchen wurden vor allem zur Modenäherin, Damenschneiderin, Friseurin und in hauswirtschaftlichen Berufen ausgebildet, Jungen wurden hauptsächlich in metalltechnischen Berufen und in Berufen des Baugewerbes ausgebildet (BIBB 2000). Begrenzte Auswahl und traditionelles Wahlverhalten verstärken wechselseitig bereits existierende Einschränkungen der Ausbildungsmöglichkeiten der Jugendlichen.
Für die Maßnahmen der beruflichen Orientierung ebenso wie für die außerbetriebliche Ausbildung trifft es zu, dass die außerschulischen Träger der Benachteiligtenförderung aufgrund ihrer strukturellen, organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen ein pädagogisches Angebot bereithalten können, das sich grundsätzlich von dem der Schule unterscheidet. Zwar bildet auch hier der Berufsschulunterricht einen wichtigen Baustein, der insbesondere im Hinblick auf den in der Regel von den Jugendlichen nachzuholenden Hauptschulabschluss von großer Bedeutung ist, den zeitlich größeren Anteil haben jedoch praktische Lernerfahrungen. Diese werden nach der Leitidee des handlungsorientierten Lernens (1) konzipiert, sozialpädagogische Aspekte sind systematisch integriert. Sie werden durch Betriebspraktika ergänzt. In enger Kooperation von AusbilderInnen, SozialpädagogInnen und BerufschullehrerInnen kann so eine passgenau auf den einzelnen Jugendlichen ausgerichtete, individuelle Förderung auf dem Weg in Ausbildung und Beruf erreicht werden. Die Bundesanstalt für Arbeit [1] hat in entsprechenden Erlassen (42/96 und 5/99) die finanzielle Förderung der Maßnahmeträger an explizite Qualitätskriterien gekoppelt, zu denen u. a. auch die Ausrichtung der pädagogischen Grundhaltung an den Prinzipien des handlungsorientierten Lernens und eine Kompetenzen fördernde, an der Lebensrealität der [/S. 216:] Jugendlichen orientierte Befähigung zur selbstständigen Lebensführung gehören. Da gleichzeitig die finanzielle Förderung immer nur für die Dauer eines Lehrgangs gesichert ist und die Träger sich regelmäßig in einem Ausschreibungsverfahren der Konkurrenz stellen müssen, wird eine kontinuierliche Qualitätskontrolle und Selbstevaluation sichergestellt, die eine stetige Aktualisierung der Inhalte und Methoden begünstigt - freilich zum Preis von unsicheren und kurzfristigen Arbeitsperspektiven für die pädagogischen MitarbeiterInnen selbst.
Diese Rahmenbedingungen sind ein Grund dafür, dass diese Einrichtungen eine größere Integrativkraft entfalten können als Schule und andere (Berufs-)Bildungsinstitutionen. Weit wirkungsvoller ist jedoch, dass sie Jugendliche gezielter ansprechen und ihnen in praktischen Kontexten unmittelbar positive Lernerlebnisse vermitteln können. Die pädagogische Programmatik ist gekennzeichnet durch:
Handlungsorientierung als Leitprinzip für die Gestaltung von Lernprozessen zielt darauf ab, dass die Jugendlichen in einer Lernumgebung, die sie als sinnvoll erfahren, befähigt werden, selbstständig die sechs Schritte einer vollständigen beruflichen Handlung (Informieren, Planen, Entscheiden, Ausführen, Kontrollieren und abschließendes Bewerten) zu vollziehen. Planvolles Handeln und die Aneignung problemlösender Fähigkeiten werden in den Mittelpunkt des Lernprozesses gestellt. Bei der Beantwortung der entsprechenden Fragen, was getan werden soll, wie vorzugehen ist, welche Hilfsmittel eventuell benötigt werden, ebenso wie bei der praktischen Ausführung eines Arbeitsauftrages und der anschließenden Bewertung des Ergebnisses und der Reflexion der eigenen Arbeit im Hinblick darauf, was ggf. beim nächsten Mal besser zu machen sei, sind andere Jugendliche von großer Hilfe. Selbstständigkeit und Sozialverhalten werden in Lerngruppen gefördert, man lernt von- und miteinander. Ein solcher Ansatz baut auf ein verändertes Selbstverständnis der pädagogischen MitarbeiterInnen und weist ihnen neue Rollen innerhalb des Lernarrangements zu. Statt zu belehren und vorzumachen stellen sie nun konstruktive Fragen, beraten die Jugendlichen bei der [/S. 217:] Lösungssuche oder moderieren Gruppenprozesse, um die selbstständigen Lernaktivitäten der Jugendlichen zu fördern. Eine weitere Herausforderung besteht darin, Lernsituationen zu gestalten, die es den Jugendlichen ermöglichen, auf bereits entwickelte Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten zurückzugreifen. "Die Erfahrung, etwas zu wissen und zu können, ist der Ausgangspunkt für die (Weiter-)Entwicklung von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl und damit auch die Basis für einen neuen, anderen Zugang zum Lernen." (INBAS 1998, S. 44). Zur Förderung der Berufsreife gehört auch die Entwicklung sozialer und personaler Kompetenzen, die zu einer selbstständigen, aktiven und gestaltenden sozialen Teilhabe befähigen. Bei der Wahl der Methoden sind die PädagogInnen dabei sehr frei und können auf Konzepte aus dem ökologischen, künstlerisch-kreativen, freizeitpädagogischen, sportlichen und interkulturellen Bereich zurückgreifen. Lernprozesse lassen sich leichter initiieren, wenn sie einen Bezug zur Lebenswelt der Jugendlichen haben, d. h. wenn Aufgaben oder Themenstellungen gewählt werden, mit denen die Jugendlichen eigene Erfahrungen verknüpfen können oder wenn ihre Lebenswelt zum Ziel von Erkundungen wird, aber auch wenn Eltern oder andere Bezugspersonen und -gruppen in die begleitende Arbeit des Maßnahmekonzeptes mit einbezogen werden (ebd., S. 48).
Obwohl auch in dem weiten Feld der Benachteiligtenförderung in der Praxis pädagogischer Anspruch und Wirklichkeit nicht immer deckungsgleich sind, kann hier doch gezielter darauf hingewirkt werden, Lernblockaden abzubauen, zur Qualifizierung zu motivieren und Lernerfolge zu vermitteln. Nicht zuletzt die Koppelung der Förderung an pädagogische Qualitätskriterien verhindert, dass sich pädagogische Trägheiten und strukturelle Verkrustungen herausbilden. Selbst angesichts tendenziell sinkender Jugendarbeitslosigkeitszahlen wird Benachteiligtenförderung mittlerweile als "Daueraufgabe und integraler Bestandteil der Berufsausbildung" betrachtet (Berufsbildungsbericht 2001, S. 12). Benachteiligtenförderung kann zwar schulischen Defiziten mit adäquateren Mitteln begegnen, gleichwohl sind den pädagogischen Ansprüchen in der Praxis oft Grenzen gesetzt - vor allem durch die Gegebenheit des Arbeitsmarktes. Berufliche Orientierung bedeutet daher auch, darauf hinzuwirken, dass die Jugendlichen ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt realistisch einschätzen und an dieser Einsicht nicht scheitern. Die alltägliche Herausforderung der PädagogInnen besteht darin, diesen widersprüchlichen Prozess auszuhalten und auszugleichen. [/S. 218:]
Im deutschen Bildungssystem fällt die Berufswahlentscheidung (nicht nur) für benachteiligte Jugendliche in eine sozio-biografische Phase, die auf Orientierung, Erprobung und Horizonterweiterung angelegt ist. Langfristige, scheinbar endgültige Festlegungen können als Verhaltenszumutung interpretiert werden. Die psycho-sozialen Prozesse dieser Altersphase sind auf die Entwicklung und Stabilisierung von Identität, Intimität und Unabhängigkeit (Evans 1998, S. 7) gerichtet. Eine Berufswahl, zumal unter stark eingeschränkten Bedingungen, wirkt dem entgegen.
Schule verstärkt mit ihren Lernpraktiken und Bewertungsmechanismen soziale Formen von Benachteiligungen und bringt selbst Formen von Benachteiligung hervor. Sie wirkt damit für einen erfolgreichen Übergang in Ausbildung und Beruf kontraproduktiv. Eine Öffnung der Lerninhalte in Richtung auf das Arbeitsleben, eine praktische Aufbereitung von Lerninhalten oder Lernumgebungen, die Eigenständigkeit und selbstständige Entscheidungen fördern, werden bislang lediglich in Modellversuchen in geringer Zahl erprobt (vgl. auch Rademacker 2002).
Möglichkeiten einer gezielten und vertieften Berufsorientierung für benachteiligte Jugendliche sind systematisch ausgegliedert aus allen schulischen Angeboten. Dies gilt sowohl für die allgemein bildenden Schulen als auch für die Berufsschulen.
Die starke Strukturierung des deutschen Ausbildungssystems lässt kaum Umwege und Abweichungen zu. Der Hauptschulabschluss als Mindestzugangsvoraussetzung, das geregelte duale Ausbildungssystem mit Zwischen- und Abschlussprüfung stellt zwar einerseits hohe Qualifizierungsstandards sicher, trägt jedoch andererseits dazu bei, dass gerade Jugendlichen mit schlechten Startchancen Türen verschlossen bleiben oder vor der Nase zugeschlagen werden. Das faktisch weiterhin existierende Beratungsmonopol des Arbeitsamtes [1] modifiziert die entsprechenden Selektionsprozesse, ohne sie rückgängig zu machen.
Angebote zur Berufsvorbereitung sind ein grundlegender Bestandteil der außerschulischen Maßnahmen zur Benachteiligtenförderung im Allgemeinen. Durch ihre kulturelle Orientierung am dualen System und an traditionellen Berufskonzepten werden sie zwar in ihren Zielen eingeengt - praktische Erfahrungen können die Jugendlichen hier nur in begrenzten Berufsfeldern sammeln - durch ihre spezifische pädagogische Ausrichtung und durch eine Vernetzung im regionalen Arbeitsmarkt bieten sie jedoch eine ungleich bessere Möglichkeit für Jugendliche, berufliche und persönliche Perspektiven zu entwickeln und zu erproben als allgemein bildende oder berufliche Schulen. [/S. 219:]
Innerhalb eines mittlerweile 25-jährigen Erfahrungszeitraums ist von den Trägern eine spezifische Professionalität entwickelt worden, die sich durch Praxis- und Handlungsorientierung sowie durch Methodenvielfalt auszeichnet. Die pädagogischen Prinzipien wie Subjektorientierung, individuelle Lernrhythmen, Ganzheitlichkeit und handlungsorientierte Vermittlungsmethoden müssen nicht mehr mit den Defiziten der Jugendlichen begründet werden (Biermann 1996, S. 19), sondern betonen Kompetenzen und Stärken. Bislang arbeitet dieser Bereich jedoch weitgehend autonom parallel zu den etablierten Berufsbildungsinstitutionen, ohne dass die hier akkumulierte Expertise systematisch für andere Bildungsträger fruchtbar gemacht würde. Sowohl das detailgenaue Wissen um die Zielgruppe als auch das hier entwickelte umfangreiche Methodenrepertoire wäre durchaus auch in anderen Kontexten nutzbar. Sinnvoller als mit einer Abfolge von wechselseitigen Schuldzuweisungen und Verbesserungsvorschlägen die Polarisierung von Schule und Jugendberufshilfe aufrechtzuerhalten, wäre es grenzüberschreitende Ansätze, wie sie bereits gelegentlich modellhaft entwickelt wurden, weiter zu verfolgen und auch auf institutioneller Ebene voneinander zu lernen.
1) Ich benutze in diesem Text bewusst die männliche Form, um zum Ausdruck zu bringen, dass es sich überwiegend um männliche Jugendliche handelt, die am Übergang von Schule in Beruf besondere Schwierigkeiten haben.
2) Handlungsorientierung gilt als zentrales Prinzip der beruflichen Bildung in Deutschland, wobei das Interpretationsspektrum des Begriffs und die methodische Umsetzung in die Praxis sehr breit ist. Eine Erläuterung des Begriffs unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Zielgruppe der benachteiligten Jugendlichen findet sich in Niemeyer 2001.
Biermann, Horst; Rützel, Josef (1996): Behinderte und Benachteiligte im Qualifizierungsdilemma, in: Berufsbildung Heft 40/1996, S. 5-8
Biermann, Horst (1996): "Neue Formen der Arbeitsorganisation und ihre Auswirkung auf die Berufsbildung", in: Berufliche Rehabilitation 10 (1996), S. 2-21
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) (2000): Förderung von Benachteiligten in der beruflichen Bildung durch Erweiterung des Berufswahlspektrums, Dokumentation des Expertengesprächs am 28. November 2000
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) (6/2001): Jüngste Entwicklung auf dem Ausbildungsstellenmarkt kommt insbesondere Abiturienten zugute. http://www.bibb.de/redaktion/erste_schwelle/6_2001/meldung6_2001.htm [21]
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) (11/2001): Erstmals differenzierte Informationen verfügbar zur Gesamtzahl aller "betrieblichen" und "außerbetrieblichen" Auszubildenden. http://www.bibb.de/redaktion/erste_schwelle/11_2001/meldung11_2001.htm [22]
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (Hrsg.) (1997): Berufsausbildungsvorbereitung. Schriftenreihe "Ausbildung für Alle". 2. Aufl., Bonn
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (Hrsg.) (2001): Berufsbildungsbericht 2001, Bonn
Evans, Karen (1998): Shaping Futures, Learning for Competence and Citizenship, Aldershot
Harasta, Werner (2000) Impulsreferat: Zur Situation der Erziehungshilfe in Hessen, in: Behindertenpädagogik Heft 1
Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS) (1998): Innovative Konzepte in der Ausbildungsvorbereitung. Eine Modellversuchsreihe berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit. 2. Aufl., Frankfurt
Linder, Ute (2000): Das Berufsspektrum in der Berufsvorbereitung, in: GPC-Expertengespräch "Erweiterung des Berufswahlspektrums", Bibb 2000, S. f
Niemeyer, Beatrix (2001): "Re-Enter - Improving Transition from School to Vocational Education and Training for low Achieving School Leavers" - Final Report, Flensburg/ Brüssel
Niemeyer, Beatrix (2002): "Situated Learning als Herausforderung für die Benachteiligtenförderung in Europa", in: Beck, Klaus; Eckert, Manfred; Reinisch, Holger u. a. (Hrsg.): Didaktik beruflichen Lehrens und Lernens - Entwicklungsdiskurse 2001, Opladen
Rademacker, Herrmann (2002): Schule vor neuen Herausforderungen. Orientierung für Übergänge in eine sich wandelnde Arbeitswelt, in: Schudy, Jörg (Hrsg.): Berufsorientierung in der Schule. Grundlagen und Praxisbeispiele, Bad Heilbrunn , S. 51 - 68.
Schneider, Sabine (2001): Institutionelle Ausgrenzungsrisiken im deutschen Übergangssystem, in: Staber, Barbara; Walther, Andreas: Institutionelle Risiken sozialer Ausgrenzung im deutschen Übergangssystem, Nationaler Bericht (Deutschland/West) für das Thematische Netzwerk "Institutionelle Risiken im Übergang (Misleading Trajectories')" - Evaluation übergangspolitischer Maßnahmen für junge Erwachsene in Europa hinsichtlich nicht-beabsichtigter Effekte sozialer Ausgrenzung http://www.iris-egris.de/projekte/sackgassen/tserkurz.phtml [23]
Storz, Michael (1999): Hauptsache Arbeit?! Integration von marktbenachteiligten jungen Menschen in die Tätigkeitsgesellschaft, in: Die Deutsche Schule, 91. Jg., Heft 1/1999, S. 38-51
Ulrich, Gerd (1998): Benachteiligung - was ist das? Überlegungen zu Stigmatisierung und Marginalisierung im Bereich der Lehrlingsausbildung, in: Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung, Jg. 67, Heft 4/1998, S. 370-380
Warzecha, Birgit (2001): Probleme und Anforderungen an die Kooperation von Schule und Kinder-/ Jugendhilfe, Referat vom 31. 3. 2001 http://www.bawue.gew.de/sondpaed/ [24]
[/S. 55:] Für viele junge Menschen wird der Eintritt in die Arbeitswelt häufig zu einem Fehlstart, wenn sich zeigt, dass die Berufsrealität eine ganz andere ist, als ursprünglich erwartet. Die Zahl der Vertragslösungen liegt, trotz knapper Lehrstellen, nach wie vor auf einem hohen Niveau. Nachdem zwischen 1994 und 1997 eine leicht abnehmende Tendenz erkennbar war, ist 1998 wieder ein leichter Anstieg bei den Vertragslösungen zu beobachten. Vorzeitig gelöst wurden 1998 insgesamt 134.683 Ausbildungsverträge, das sind 22,6 Prozent. Bundesweit wird damit knapp jeder vierte Ausbildungsvertrag wieder gelöst. Knapp die Hälfte der Vertragslösungen findet im ersten Ausbildungsjahr statt; davon wiederum gut die Hälfte bereits in der Probezeit.
Besonders groß ist die Rate der Vertragsauflösungen im Handwerk mit 28 Prozent und bei den Freien Berufen mit 27 Prozent. Eine auffallend hohe Ausbildungszufriedenheit scheint im öffentlichen Dienst vorzuliegen. Hier haben nur 6,5 Prozent der Auszubildenden ihre Lehre vorzeitig beendet.
Die Spannweite der Vertragslösungen zwischen den einzelnen Bundesländern ist ebenfalls erheblich. Sie reicht von hohen Lösungsraten mit knapp 30 % in den Ländern Bremen (28 %) und Berlin (27 %) bis unter 20 % in den Ländern Bayern (18 %), Sachsen und Baden-Württemberg (jeweils 19 %).
|
| Ausbildungsbereiche |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
| Industrie und Hande |
21,3 |
20,2 |
19,4 |
18,1 |
18,7 |
| Handwerk |
29,9 |
29,2 |
26,7 |
26,3 |
27,9 |
| Öffentlicher Dienst |
7,1 |
7,5 |
6,3 |
6,8 |
6,5 |
| Landwirtschaft |
24,5 |
24,2 |
23,1 |
22,3 |
23,0 |
| Freie Berufe |
29,1 |
28,6 |
25,5 |
25,8 |
26,8 |
| Sonstige Hauswirtschaft, Seeschifffahrt |
22,6 |
27,9 |
23,0 |
22,0 |
22,1 |
| Alle Bereiche |
24,7 |
24,2 |
22,6 |
21,8 |
22,6 |
Der, wenn auch nur leichte, Anstieg bei den vorzeitigen Vertragslösungen ist um so bedauerlicher als nach einer Erhebung des Bundesinstituts für Berufsbildung [18] sich die Chancen für Vertragslöser im Vergleich zu früher deutlich verschlechtert haben (Alex u. a. 1997). So ist der Anteil der Ausbildungswechsler, d. h. Auszubildende, die nach der Vertragslösung wieder eine neue Ausbildung aufnehmen, merklich zurückgegangen (von 46 % 1990 auf 39 % 1995/96). Im [/S. 56:] Gegenzug hat sich der Anteil der Abbrecher, die im Anschluss arbeitslos waren bzw. Gelegenheitsjobs ausübten, erheblich ausgeweitet (von 20 % 1990 auf 37 % 1995/96). Damit zeichnet sich ab, dass der Abbruch einer Ausbildung für die Jugendlichen derzeit häufig zu einem endgültigen Herausfallen aus dem beruflichen Bildungssystem führt, mit den meist negativen Folgen einer beruflichen Perspektive als An- und Ungelernter (Puhlmann 1994).
In diesem Zusammenhang ist allerdings auch darauf hinzuweisen, dass eine vorzeitige Vertragslösung nicht immer eine Katastrophe bedeuten muss. In vielen Fällen ist sie eine sinnvolle berufliche Umorientierung, insbesondere wenn der Beruf/ Betrieb nicht den Vorstellungen oder den Ansprüchen an die Qualität der Ausbildung entspricht (Grieger/ Hensge 1992). Vertragslösungen vor diesem Hintergrund sind häufig mit einem Betriebs- und/ oder Berufswechsel bzw. mit einem Übergang in andere Bildungswege verbunden. Dennoch ist auch hier in den meisten Fällen ein Einschnitt in den beruflichen Lebensweg der betroffenen Jugendlichen zu verzeichnen. Ausbildungsabbrüche beruhen selten auf Ad-hoc-Entscheidungen. In der Regel sind sie der Schlusspunkt eines länger andauernden Prozesses, der häufig mit negativen Erfahrungen, Konflikten und Problemen, sowohl für den Jugendlichen aber auch für den Betrieb, verbunden ist (Hensge 1984).
Das Abbruchgeschehen ist aus der Sicht der Auszubildenden im Allgemeinen gekennzeichnet durch ein ganzes Bündel von teilweise mit einander verbundenen Gründen (Fassmann 1998). Nach bislang durchgeführten Studien über die Ursachen von Ausbildungsabbruch lassen sich vor allem Probleme im sozialen Kontext, insbesondere dem Verhältnis zu den Ausbildern und Kollegen, in betriebsstrukturellen Aspekten der Ausbildung sowie in einer falschen Berufswahl festmachen (vgl. Grieger 1981 und Hensge 1987). Ein Teil dieser Gründe könnte durch bessere Vorabinformationen über den Ausbildungsberuf und die anfallenden Tätigkeiten, durch größeres Engagement und Kompromissbereitschaft sowohl aufseiten der Auszubildenden und der Betriebe vermieden werden.
Die vorliegende Analyse setzt nicht erst beim Ausbildungsabbruch an, sondern fragt Auszubildende, ob sie einen Abbruch ihrer derzeitigen Ausbildung in Erwägung ziehen und welche Gründe sie zu dieser Überlegung veranlassen. Da betriebsbedingte Ursachen in erheblichem Maße zu den Vertragslösungen führen, gilt das besondere Augenmerk den aktuellen betrieblichen Ausbildungsgegebenheiten, wie sie von den Jugendlichen eingeschätzt und erfahren werden. Dadurch können weitere Hinweise gewonnen werden, welche Ereignisse und Faktoren in der Ausbildung die Gefahr eines Abbruchs in sich bergen. Grundlage hierfür sind Ergebnisse des Forschungsprojektes "Ausbildung aus der Sicht der Auszubildenden". [/S. 57:]
Zum Zeitpunkt der Befragung dachte jede(r) 10. Auszubildende ernsthaft daran, die Ausbildung abzubrechen. Das ist, gemessen an den oben dargestellten tatsächlichen Lösungsraten, eine deutlich geringere Quote. Diese Abweichungen lassen sich vor allem durch die unterschiedlichen Erfassungsmethoden erklären. Während in der Statistik die Abbrecher kumulativ über den Zeitraum eines Jahres erfasst werden, handelt es sich bei der Befragung der Auszubildenden um eine Querschnittsbefragung mit einem festen Befragungszeitpunkt. Auszubildende, die der Ausbildung bereits den Rücken gekehrt haben, tauchen in der Untersuchungspopulation nicht mehr auf, es sei denn, sie haben eine neue Ausbildung begonnen.
Ähnlich wie in der Vertragslösungsstatistik sinkt auch bei den befragten Auszubildenden im Laufe der Ausbildung die Neigung zum Ausbildungsabbruch: Während im ersten Ausbildungsjahr noch 13 Prozent ernsthaft darüber nachdenken, sind es im dritten und vierten Ausbildungsjahr nur noch sieben Prozent. Hierbei handelt es sich um einen Selektions- bzw. Optimierungsprozess. Jugendliche, die es bis zum dritten bzw. vierten Ausbildungsjahr gebracht haben, dürften ihre Lehre nicht ohne weiteres vorzeitig beenden, selbst wenn die Ausbildung nicht immer ideal ist oder nach ihren Vorstellungen verläuft. Vielmehr versuchen sie das bisher "Geleistete" durch einen Abschluss zu belegen. Es sei denn, die betrieblichen Bedingungen sind nicht mehr tragbar, der Ausbildungserfolg ist sowieso in Frage gestellt oder private Probleme zwingen dazu. Jugendliche im ersten Lehrjahr, insbesondere in der Probezeit, haben dagegen noch nicht so viel investiert. Sie sind eher bereit, wenn ihnen die Ausbildung nicht gefällt, dies zu korrigieren und sich möglichst rasch beruflich neu zu orientieren, insbesondere wenn sich bessere Alternativen ergeben. Denn mit der Ausbildung werden wichtige Weichen für die berufliche Integration und damit für das zukünftige Erwerbsleben gestellt.
Die Spannweite zwischen den befragten Ausbildungsberufen reicht von zwei Prozent bis 16 Prozent. Besonders häufig stellt sich die Frage nach Abbruch der Ausbildung bei den Friseur(inn)en (16 %) und den Einzelhandelskaufleuten (15 %). Beides sind Berufe mit traditionell hohen Lösungsquoten. Einen Gegenpol bilden die Energieelektroniker/ -innen sowie die Industriekaufleute: Mit zwei bzw. vier Prozent steht bei ihnen eine Vertragslösung nur selten zur Diskussion.
Darüber hinaus zeigt sich: Je besser die schulische Vorbildung der Auszubildenden, um so seltener denken sie an eine vorzeitige Lösung ihrer Ausbildung. So erwägen 14 Prozent der Auszubildenden mit Hauptschulniveau einen Abbruch, bei den Abiturienten machen sich lediglich fünf Prozent darüber Gedanken. Der Hintergrund dürfte sein, dass die Entscheidungsspielräume bei der Wahl des Berufes und des Ausbildungsbetriebes für die Hauptschüler stärker eingeschränkt sind, häufig begrenzt auf Ausbildungsplätze mit geringerer systematischer Qualifizierung und restriktiveren Bedingungen (vgl. Grieger/ Hensge 1992). Die besser vorgebildeten Jugendlichen unterliegen geringeren Restriktionen, bekommen meist anspruchsvollere Aufgaben zugewiesen, können ihre Interessen besser artikulieren und erhalten dadurch letztendlich größere Aufmerksamkeit, Bestätigung und Zuwendung (vgl. Zielke 1998). Hierzu beispielhaft die Anmerkung eines Abiturienten auf dem Fragebogen: "Sehr gute Ausbildungsstätte, viel Rückmeldung mit Lob; gutes Arbeitsklima, sehr hohe Anforderungen (finde ich positiv); viel selbstständiges Arbeiten." Diese Faktoren sind es, die sich in besonderem Maße auf die Motivation und Ausbildungszufriedenheit auswirken und einen erheblichen Einfluss darauf haben, ob eine Ausbildung erfolgreich beendet oder vorzeitig gelöst wird (vgl. Jungkunz 1996). Von den Auszubildenden, [/S. 58:] die angeben, dass sie mit ihrer Ausbildung "sehr unzufrieden" sind, denken 60 Prozent ernsthaft an eine vorzeitige Vertragslösung. Im Abbruch der Ausbildung sehen sie sozusagen die letzte Konsequenz, diese unbefriedigende Situation zu beenden. Unter den "sehr zufriedenen" Auszubildenden stellen lediglich sechs Prozent solche Überlegungen an.
Gleichzeitig belegen die Angaben der Befragten, dass die Ausbildung nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird. Viele Auszubildenden bemühen sich, ihre Lehre trotz Schwierigkeiten zu beenden. Drei Viertel der "überwiegend unzufrieden" Auszubildenden denken nicht daran, vorzeitig aufzuhören. Selbst von denjenigen, die erhebliche Probleme haben und die ihre Ausbildung als "ganz unbefriedigend" erleben, geben immerhin noch 40 Prozent an, dass der Abbruch für sie keine Alternative bedeutet: "Dass wir wenigstens eine Ausbildung haben! Deshalb ziehen wir das ja durch. Ich könnte glatt aufhören!" (Gruppendiskussion mit Arzthelferinnen im dritten Lehrjahr). Die Zurückhaltung vieler Auszubildender, trotz unbefriedigender Ausbildungssituation auszuharren und die Ausbildung erfolgreich zu beenden, deutet auf die hohe Wertschätzung eines Berufsabschlusses bei den Jugendlichen hin (vgl. Jugendwerk der deutschen Shell (Hrsg.) 1997). Außerdem kann dies als Indiz dafür gewertet werden, dass die Auszubildenden ihre beruflichen Chancen nach dem Abbruch eher negativ einschätzen bzw. keine bessere Alternative zu ihrer, wenn auch unbefriedigenden, Ausbildung sehen.
Auszubildende, die einen Abbruch der Ausbildung erwägen, machen dafür in erster Linie Schwierigkeiten mit Ausbildern und Vorgesetzten verantwortlich (44 %). Frauen nennen diese Faktoren häufiger. Überdurchschnittlich oft wird diese Begründung von Auszubildenden in mittleren und kleineren Betrieben mit weniger als 50 Beschäftigten genannt.
Von entscheidender Bedeutung zeigt sich dieses Problem bei angehenden Arzthelferinnen, die überwiegend in kleinen Praxen eng mit der Sprechstundenhelferin oder dem Arzt zusammenarbeiten müssen. Für 80 Prozent der potenziellen Abbrecherinnen in diesem Beruf zählt das schlechte Verhältnis zum/ zur Vorgesetzten als Grund für ihre Abbruchüberlegungen (Hecker 1999). Auch rund zwei Drittel der Bürokaufleute in Kleinbetrieben machen das soziale Klima zwischen Auszubildenden und Vorgesetzten für ihre Überlegung verantwortlich, ihr Ausbildungsverhältnis zu kündigen.
Gerade in kleineren Betrieben, wo man sich nicht aus dem Wege gehen kann, kommt es auf eine möglichst reibungslose und konfliktfreie Zusammenarbeit an. So positiv es sein kann, wenn eine Art familiäres Vertrauensverhältnis zwischen Ausbildern/ -innen und Auszubildenden besteht, in dem durchaus Konflikte ausgetragen und bereinigt werden, so schwierig wird es, wenn dieses Vertrauensverhältnis gestört ist. Oftmals bleibt den Auszubildenden dann nur die Kündigung. Anders sieht es in größeren oder Großbetrieben aus: Treten hier Schwierigkeiten mit Vorgesetzten/ Ausbildern auf, können sich die Jugendlichen auch an andere Bezugspersonen wenden, die in den Konflikten vermitteln oder zur Entschärfung beitragen können (Hecker 1989). So betonen in Großbetrieben (500 und mehr Beschäftigte) lediglich 31 Prozent der potenziellen Ausbildungsabbrecher Schwierigkeiten mit den Vorgesetzten, aber 55 Prozent in Kleinbetrieben (unter 10 Beschäftigte). [/S. 59:]
Von älteren Auszubildenden, insbesondere den Abiturienten unter ihnen, werden negative Erfahrungen mit Ausbildern und Vorgesetzten ebenfalls verstärkt im Zusammenhang mit ihren Abbruchüberlegungen gebracht: So haben 50 Prozent der über 21-jährigen damit Probleme aber nur 37 Prozent der unter 18jährigen. Mit zunehmendem Alter und/ oder höherer Qualifikation verändert sich die Motivationsstruktur und Anspruchshaltung der Auszubildenden. Allerdings wird dies in vielen Betrieben noch nicht erkannt und damit auch keine entsprechenden erwachsenengerechte Konzepte und Umgangsformen in der Ausbildung entwickelt. Ein 22-jähriger Auszubildender drückt dies folgendermaßen aus: "Es könnten vor allem die Ausbilder ausgetauscht werden, da sie ungenügende pädagogische Fähigkeiten haben, charakterliche Schwäche vorweisen und ein Desinteresse an den Tag bringen, das an Faulheit grenzt."
Neben den betriebs-klimatischen Faktoren wird die falsche Berufswahl als wichtiger Grund für eine Vertragslösung von den Auszubildenden genannt. 42 Prozent der möglichen Ausbildungsabbrecher betonen, dass der Ausbildungsberuf nicht ihren Vorstellungen entspricht. Häufig ist dies ein Indiz für mangelnde Informationen über den (zum Teil unfreiwillig) gewählten Ausbildungsberuf. Meist stellt sich erst in der täglichen Ausbildungspraxis heraus, ob der Beruf den eigenen Vorstellungen und Neigungen entspricht (Feller 1995). Besonders schwer wiegt dieser Grund bei Industriemechanikern/ -innen (zwei Drittel). Aber auch Bank- und Industriekaufleute, die einen Abbruch erwägen, haben mit ihrer Ausbildung oftmals andere Vorstellungen verbunden. Entsprechend häufig nennen diese Auszubildenden auch andere Berufswünsche. Der Abbruch wird als Chance für eine berufliche Neuorientierung gesehen, zum Teil in Form einer fachschulischen bzw. hochschulischen Berufsqualifikation.
Finanzielle Aspekte sind für Abbruchüberlegungen ebenfalls von Bedeutung. Sie werden von einem Drittel der potenziellen Abbrecher genannt - insbesondere von Auszubildenden in Berufen mit niedrigeren Ausbildungsvergütungen wie z. B. Friseur/ -in (51 %) und Elektroinstallateur/ -in (46 %). In diese Überlegungen dürften, neben der Unzufriedenheit mit dem aktuellen Ausbildungsentgelt, möglicherweise auch die späteren Verdienstaussichten als Fachkraft einfließen. Bei einer geschlechtsspezifischen Betrachtung zeigt sich, dass die jungen Männer wesentlich häufiger finanzielle Gründe als Abbruchursache nennen. Finanzielle Motive spielen auch eine größere Rolle bei ausländischen Auszubildenden sowie besonders bei Auszubildenden in außerbetrieblichen Einrichtungen, bei Gruppen also mit einem in der Regel geringeren Ausbildungsentgelt. Ebenso dürften unsichere Berufsperspektiven, d. h. geringere Chancen für die Einmündung in ein späteres (ausbildungsadäquates) Arbeitsverhältnis eine Rolle spielen. Welche Bedeutung finanzielle Aspekte bei den abbruchgefährdeten Jugendlichen haben, lässt sich u. a. daran ablesen, dass in dieser Gruppe wesentlich mehr Jugendliche noch einer Nebentätigkeit nachgehen, um sich den Lebensunterhalt zu finanzieren, als bei Auszubildenden, die nicht an Abbruch denken.
Von ihrer Ausbildung überfordert fühlen sich 16 Prozent der potenziellen Ausbildungsabbrecher/ -innen. Dies ist ein Abbruchgrund, der verstärkt von Auszubildenden im dritten und vierten Ausbildungsjahr angegeben wird. Das Gefühl, den Anforderungen nicht gewachsen zu sein, kann als Indiz dafür gewertet werden, dass die Leistungsanforderungen im Verlauf der Ausbildung gestiegen sind. Zum anderen kann es dem zunehmenden Prüfungsdruck gegen Ende der Ausbildung geschuldet sein. Die Angst vor Misserfolg bei der Prüfung führt dann bei einem Teil der Auszubildenden dazu, dass sie bereits im Vorfeld die Ausbildung abbrechen oder zumindest entsprechende Überlegungen anstellen. Jugendliche mit niedrigerer schulischer Vorbildung tun sich schwerer, den Anforderungen der Berufsausbildung gerecht zu werden (vgl. Zielke 1998), ebenso ausländische Jugendliche. Gründe hierfür dürften vor allem in [/S. 60:] einer geringeren Sprachkompetenz und, damit oftmals einhergehend, in schulischen Defiziten zu suchen sein (vgl. Beer-Kern 1993).
Gesundheitliche Gründe veranlassen 15 Prozent zu Abbruchüberlegungen. Ein Grund, der tendenziell häufiger von Gas- und Wasserinstallateuren, Kraftfahrzeugmechanikern, Malern und Lackierern sowie Elektroinstallateuren angeführt wird. Hierbei handelt es sich vor allem um Berufe im gewerblich-technischen Bereich, bei denen von stärkeren körperlichen Arbeitsanforderungen und allergenen Belastungen ausgegangen werden kann.
Für weitere 15 Prozent sind private Gründe ausschlaggebend. Diese Motive werden öfter von Auszubildenden, die in der Regel mit den berufsinhaltlichen bzw. betrieblichen Rahmenbedingungen zufrieden sind, genannt. Eine enge Korrelation besteht bei dieser Gruppe allerdings auch mit finanziellen Aspekten. Zwischen den Geschlechtern liegen keine signifikanten Unterschiede vor.
Für viele Jugendliche, die ihrer derzeitigen Ausbildung den Rücken kehren wollen, würde dies ihren Angaben zufolge allerdings noch kein endgültiger Verzicht auf eine berufliche Bildung oder auf eine weitere schulische bzw. hochschulische Qualifizierung bedeuten. Vielmehr läuft der erwogene Ausbildungsabbruch auf eine Veränderung der beruflichen Orientierung hinaus: Knapp ein Drittel strebt eine Ausbildung in einem anderen Beruf an und zieht damit die Konsequenzen aus einer falschen Berufswahl. Weitere 12 Prozent planen einen so genannten "Abbruch nach oben" zur weiterführenden Qualifizierung außerhalb des dualen Systems. Sie sehen in einer schulischen bzw. hochschulischen Ausbildung eine Verbesserung ihrer Arbeitsmarktchancen.
Der Wechsel in eine andere Ausbildung korreliert stark mit der Ausbildungsdauer und wird vor allem von Befragten im ersten Lehrjahr genannt (35 %). Aber auch ausländische Jugendliche versprechen sich verstärkt von einem Ausbildungswechsel bessere Berufschancen. Dies gilt für Auszubildende aus Großbetrieben (500 und mehr Beschäftigte) ebenso, wie für solche aus außer- und überbetrieblichen Einrichtungen. Insbesondere bei der letztgenannten Gruppe, bei der gut jede(r) Zweite mit Abbruchüberlegungen darüber nachdenkt, in einem anderen Beruf einen Neuanfang zu starten, dürfte der Wunsch nach Einmündung in eine reguläre betriebliche Ausbildung mit im Vordergrund stehen. Bei den Auszubildenden in Großbetrieben spricht vieles dafür, dass ein geplanter Berufswechsel sogar im gleichen Betrieb vollzogen werden kann.
Der Übergang in eine schulische bzw. hochschulische Ausbildung wird, entsprechend ihren schulischen Voraussetzungen, in erster Linie von Abiturienten (46 %) sowie Auszubildenden mit Fachhochschulreife (27 %) genannt. Diese höheren Bildungsaspirationen stehen vor allem für Bank- und Industriekaufleute sowie für Energieelektroniker - also Berufe mit bereits hohem Bildungsniveau der Auszubildenden - zur Diskussion. Die berufliche Umorientierung dient der weiterführenden Qualifizierung und damit der Optimierung von Arbeitsmarktchancen. Gleichzeitig wird mit dieser Option der Schritt in den beruflichen Alltag, der so genannte "Ernst des Lebens", auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Denn im Vergleich zu schulischen und hochschulischen Bildungsgängen ist die betriebliche Lehre eher als Einmündung in betriebliche Sozialstrukturen mit einem stärker sanktionierten Anpassungsdruck zu verstehen.
Lediglich jede(r) zehnte potenzielle Abbrecher erwägt den völligen Ausstieg aus der beruflichen Qualifizierung und möchte sofort eine (ungelernte) Arbeit aufnehmen. Die Angaben der Jugendlichen belegen hierbei einen engen Zusammenhang mit finanziellen Motiven. Die sofortige Arbeitsaufnahme wird vor allem von männlichen Jugendlichen in größeren [/S. 61:] Ausbildungsbetrieben angegeben und basiert möglicherweise auf der Annahme und Erfahrung, dass der Betrieb, auch ohne abgeschlossene Ausbildung, vielfältige Arbeitsmöglichkeiten bietet. Eine stärkere "drop-out"-Rate zeichnet sich bei Auszubildenden in außerbetrieblichen Einrichtungen ab: Knapp ein Viertel nennt die Arbeitsaufnahme als Grund für einen möglichen Abbruch. Es scheint, als versprächen sich diese Jugendlichen keine positiven Auswirkungen von einem qualifizierten Berufsabschluss auf ihre späteren Berufs- und Arbeitsmarktchancen, vermutlich sehen sie eher geringe Möglichkeiten, im erlernten Beruf etwas zu finden. Sie betrachten die außerbetriebliche Ausbildung eher als vergeudete Zeit bei geringem Einkommen.
Insgesamt zeigt die Vielzahl der genannten Gründe im Zusammenhang mit der Überlegung, die Ausbildung vorzeitig zu beenden, dass in der Regel nicht nur ein Motiv dafür geltend gemacht wird. Vielmehr handelt es sich hier um eine Vielzahl einander bedingender Gründe, die zu den Abbruchüberlegungen bei den Auszubildenden geführt haben (vgl. Hecker 1989). Damit bestätigen die Angaben der Auszubildenden auch Ergebnisse von Untersuchungen über vollzogene Ausbildungsabbrüche.
Nach vorliegenden Untersuchungsergebnissen orientiert sich der Ausbildungsabbruch in erster Linie am aktuell wahrgenommenen Ausbildungsgeschehen. Dabei spielen neben den zwischenmenschlichen, betriebsklimatischen Problemen auch die berufsinhaltliche Seite und die betrieblichen Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle (vgl. Hensge 1984 und 1987). Neben den genannten Gründen für eine mögliche vorzeitige Lösung der Ausbildung sollen deshalb die betrieblichen Ausbildungsbedingungen und -erfahrungen der potenziellen Abbrecher mit denen der anderen Auszubildenden, die nicht an Abbruch denken verglichen werden. Ziel hierbei ist es, herauszuarbeiten, ob es in der Einschätzung des Ausbildungsgeschehens zu unterschiedlichen Bewertungen zwischen den beiden Gruppen kommt.
Das soziale Klima im Betrieb, besonders das Verhältnis zum Vorgesetzten bzw. zum Ausbilder ist ein maßgeblicher Indikator für Ausbildungszufriedenheit und Motivation und hat damit auch Auswirkungen auf die Bereitschaft, eine Ausbildung abzubrechen.
Nach einer Analyse des sozialen Kontextes bei den befragten Auszubildenden zeigt sich, dass von den abbruchgefährdeten Auszubildenden 60 Prozent "häufig oder manchmal" Probleme mit ihren Vorgesetzten/ Ausbildern haben, während dies lediglich von einem Viertel der Vergleichsgruppe angegeben wird. Auch mit Kollegen/ -innen haben sie mehr als doppelt so häufig Schwierigkeiten, als die Vergleichsgruppe. Das soziale Klima der Auszubildenden untereinander wird von den potenziellen Abbrechern ebenfalls doppelt so häufig als belastend empfunden als von der Vergleichsgruppe. [/S. 62:]
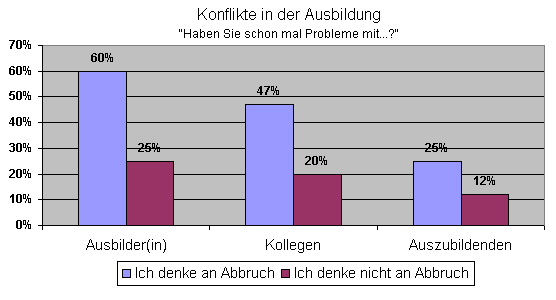
Quelle: BIBB Projekt 1.4001 "Ausbildung aus Sicht von Auszubildenden"
Wenn Schwierigkeiten mit Vorgesetzten/ Ausbildern auftreten, so wird vor allem das autoritäre Verhalten angeführt sowie die Nichteinhaltung von Regeln und Vorschriften, deretwegen es zu Auseinandersetzungen kommt. Hierzu beispielhaft einige Anmerkungen von Auszubildenden: "Das Lernziel interessiert die Ausbilder fast gar nicht. Hauptsache arbeiten! Am besten alles alleine machen ohne zu fragen! Perfekte Azubis! Habe selbst Ehrgeiz, deshalb gute Noten aber ansonsten herrscht Frust und Desinteresse durch ungerechte Behandlung." (Abiturient, 27 Jahre) oder "Ich fühle mich ausgenutzt von meinem Ausbilder. Wenn man mal etwas falsch gemacht hat, darf man gleich putzen." (Realschülerin, 19 Jahre). Für Probleme sowohl im Kollegenkreis als auch mit den anderen Auszubildenden wird überwiegend unsolidarisches Verhalten verantwortlich gemacht.
Auf die pädagogisch-soziale Gestaltung der Ausbildung bezogen schätzen die potenziellen Abbrecher alle erfragten Bereichen deutlich ungünstiger ein als die Vergleichsgruppe (siehe folgende Grafik). Besonders gravierend sind die Unterschiede in den auf den Arbeitsinhalt bezogenen Aussagen wie: "Verrichtung ausbildungsfremder Tätigkeiten" und Vermittlung eines "umfassenden Überblickes über alle beruflichen Anforderungen". Die potenziellen Abbrecher betonen doppelt so häufig wie die Vergleichsgruppe, dass sie manchmal auch Arbeiten verrichten müssen, die nicht zur Ausbildung gehörten, ein Aspekt, der die Jugendlichen besonders stört: "Es sollte eine Kontrolle geben, dass wirklich ausgebildet und nicht ausgebeutet wird. Zum Kaffeekochen, Müllentsorgen, Blumen gießen etc. brauche ich kein Abitur oder drei Jahre Ausbildung!" (Abiturientin, 21 Jahre) oder "Ich finde gut, dass ich die einzige Auszubildende bin, d. h. im Büro. Dadurch bekomme ich alles mit und muss zum größten Teil selbstständig arbeiten. Ich finde nicht gut, dass ich jetzt alle Putzarbeiten (spülen, Fenster putzen, Regale abwaschen, kehren, Ausstellungsraum putzen und Blumen gießen) machen muss, weil mein Chef unsere Putzfrau geschmissen hat und ich ja billiger bin." (Hauptschülerin, 19 Jahre)
Von den Auszubildenden, die nicht an einen Ausbildungsabbruch denken, sind 78 Prozent der Überzeugung, dass sie einen umfassenden Überblick über alle Anforderungen im Betrieb bekommen. Diese Einschätzung teilen aber nur 55 Prozent der potenziellen Abbrecher. "Ich bin seit 7 Monaten 'in Spüle'. Wenn ich etwas anderes mache, ist es Kartoffeln schälen, Salat putzen, Frühstücksvorbereitung oder ab und zu Kaffeegeschäft. So kann ich die Prüfung nie schaffen. Man lernt nichts!" (Realschülerin, 19 Jahre) [/S. 63:]
Auch auf der Ebene der pädagogischen Betreuung fühlt sich diese Gruppe deutlich benachteiligt: Für gute Leistungen werden sie seltener gelobt als die Vergleichsgruppe (41 %, gegenüber 64 %). Außerdem gibt gut jede(r) dritte Auszubildende, die/ der sich mit dem Ausbildungsabbruch beschäftigt, an, dass es niemanden gebe, der sich für seine/ ihre Ausbildung richtig verantwortlich fühle (Vergleichsgruppe: 13 %). "Niemand fühlt sich im Betrieb verantwortlich für mich; jeder gibt mir eher Aufgaben, die überwiegend nicht zu meiner Ausbildung gehören: Die Schuld hierfür liegt beim Chef; der keinen Ausbilder bestimmt hat." (Abiturientin, 20 Jahre)
Wenn sie etwas falsch gemacht haben, erhalten sie seltener eine Rückmeldung durch die Ausbilder und Hinweise, wie man es besser machen könnte, als Auszubildende, die nicht an den Abbruch denken. Dieses Gefühl der unzureichenden Betreuung wird auch noch dadurch unterstrichen, dass die Ausbilder und Betreuer im Schnitt nur 55 Minuten am Tag für sie aufwenden; das sind 25 Minuten weniger als bei der Vergleichsgruppe. Sie haben darüber hinaus seltener die Gelegenheit einzelne Arbeitsschritte und Handgriffe einzuüben bzw. auch mal etwas selbstständig auszuprobieren.
Die abbruchgefährdeten Auszubildenden erhalten seltener eine systematische und planmäßige Ausbildung. Lediglich 32 Prozent betonen, dass sich ihre Ausbildung "voll und ganz" bzw. "weitgehend" am Ausbildungsplan orientiert, gegenüber 55 Prozent bei der Vergleichsgruppe. Sie haben außerdem seltener die Möglichkeit berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten in der Ausbildung zu erwerben, insbesondere auf dem Gebiet moderner Techniken und Organisationsformen. Lediglich beim Kundenumgang und im Bereich Entsorgung und Umweltschutz liegen sie vorne. Nach Einschätzung der potenziellen Abbrecher misst man in ihrem Betrieb den (erfragten) Sozial- und Fachkompetenzen einen geringeren Wert bei als bei der Vergleichsgruppe. Weniger Wert wird bei ihnen vor allem auf Team- und Gruppenarbeit, auf Fremdsprachenkenntnisse, auf Selbstständigkeit und Eigeninitiative sowie auf die Entwicklung eigener Ideen gelegt.
Bei den betrieblichen Unterweisungsformen zeigt sich, dass die unzufriedenen Auszubildenden etwas häufiger noch nach der traditionellen Methode "Zuschauen und Nachmachen" ausgebildet werden, bei über 50 Prozent steht jedoch die selbstständige und eigenverantwortliche Bearbeitung von Arbeitsaufträgen im Vordergrund. Ähnlich wie die Vergleichsgruppe betonen rund 70 Prozent der potenziellen Abbrecher, dass sie in ihrem Ausbildungsalltag auch Tätigkeiten verrichten, die sie "genau so gut und schnell ausführen wie eine Fachkraft". Vor diesem Hintergrund ist u. a. die negative Einschätzung zu werten, wonach 75 Prozent ihre Ausbildungsvergütung, gemessen an ihren Leistungen, als zu niedrig einstufen. Bei der Vergleichsgruppe sind es 62 Prozent. Die größere Unzufriedenheit der potenziellen Abbrecher mit ihrer Vergütung dürfte verstärkt auch darauf zurückzuführen sein, dass sie, wie bereits dargestellt, wesentlich häufiger aus Berufen kommen, in denen niedrigere Ausbildungsvergütungen bezahlt werden. "Es macht Spaß! Nur viel zu wenig Vergütung. Wir arbeiten genauso viel wie Gesellen und haben zusätzlich noch viele Kosten wegen der Ausbildung (z. B. Tickets, Lernmaterial, Schulmaterial)." (Realschülerin, 17 Jahre)
Insgesamt wird deutlich, dass der betriebliche Background bei denjenigen Auszubildenden, die an den Abbruch ihrer Ausbildung denken, sich deutlich ungünstiger darstellt als bei der Vergleichsgruppe. Sowohl was die sozialen und zwischenmenschlichen Aspekte, aber auch betriebliche Rahmenbedingungen und Qualität der Ausbildung selbst anbelangt, fühlt sich diese Gruppe mit erheblich mehr Mängeln und Problemen konfrontiert, die das Ausbildungsverhältnis belasten. [/S. 64:]
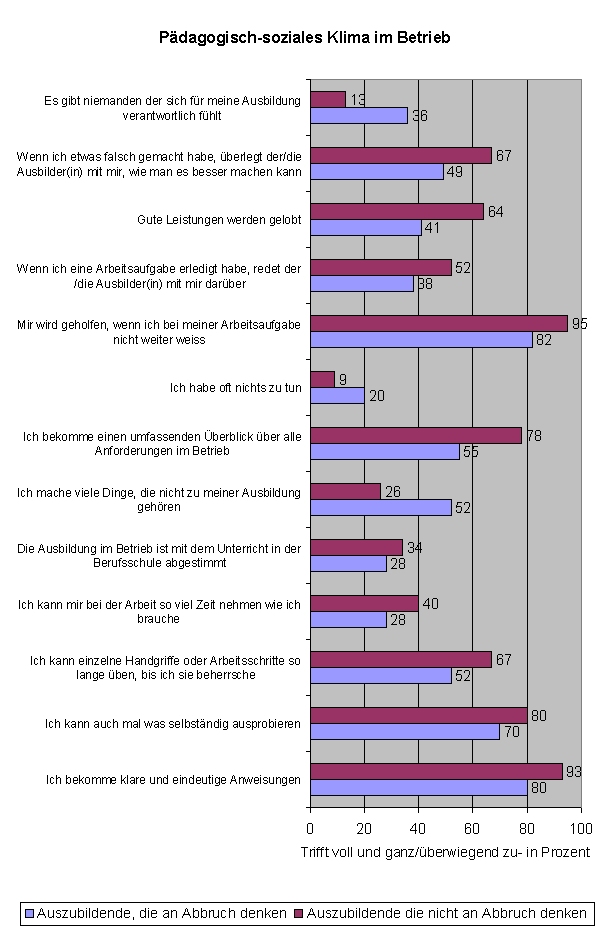
[/S. 65:]
Der Eintritt der jungen Menschen in die Arbeitswelt gerät häufig zum Fehlstart: Trotz angespannter Ausbildungsstellensituation beendet immer noch knapp ein Viertel aller Auszubildenden vorzeitig die Ausbildung. Selbst wenn es sich bei den Vertragslösungen in der Mehrzahl um einen Betriebs- bzw. Berufswechsel oder einen Übergang in andere Bildungswege und damit um eine berufliche Umorientierung handelt, haftet dem Abbruch das Stigma des Scheiterns an. Dem Abbruch geht in der Regel eine längere konfliktreiche, mit Unsicherheiten behaftete Phase voraus, die zu erheblichen Reibungsverlusten führt. Nicht selten wirkt sich dies negativ auf das Selbstbewusstsein der Jugendlichen aus, weil es als Scheitern erlebt wird, als Eingeständnis einer Fehlentscheidung. Insbesondere wenn die Vertragslösung von Seiten des Betriebes erfolgt, wird sie den Jugendlichen häufig als mangelnde Anpassungsleistung bzw. gar als Unfähigkeit angelastet. Besonders problematisch wird der vorzeitige Ausstieg dann, wenn die Ausbildung ersatzlos beendet, d. h. auf eine weitere Ausbildung verzichtet wird. Denn nach wie vor eröffnet der Abschluss einer Ausbildung im dualen System gute Chancen für eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt.
Neben der subjektiven Bedeutung für die Jugendlichen sind aber auch die negativen Auswirkungen für den ausbildenden Betrieb beträchtlich. Insbesondere für kleinere Betriebe bedeutet ein Ausbildungsabbruch: aktuell meist nicht genutzte Ausbildungsressourcen, den Verlust von Arbeitskapazität und verlorenen Qualifizierungsaufwand, erheblicher zusätzlicher Aufwand, um einen neuen Auszubildenden zu suchen sowie evtl. spätere Engpässe beim Fachkräftenachwuchs. Sowohl im Interesse der Betriebe als auch der Auszubildenden muss deshalb verstärkt nach Wegen gesucht werden, um vorzeitige Vertragslösungen deutlich zu mindern.
In der Mehrzahl erfolgt die Zahl der Vertragslösungen auf Veranlassung der Auszubildenden, die in der Regel gleich mehrere Gründe dafür geltend machen. Einer der Hauptgründe, die falsche Berufswahl, ließe sich sicherlich durch bessere Information und Beratung der Jugendlichen über den künftigen Beruf reduzieren. Neben der Berufsberatung der Arbeitsämter zählen hierzu mehr und bessere Berufsinformationen bereits in den allgemein bildenden Schulen, verstärktes Angebot an Praktika, um den Jugendlichen einen ersten Einblick in den Berufsalltag zu vermitteln, intensivere Beratung durch die Betriebe im Rahmen der Bewerbungsverfahren, in dem auch negative Aspekte der Ausbildung angesprochen werden müssen, sowie verstärkt Hinweise auf Eignung und erforderliche Kompetenzen.
Aber auch während der Ausbildung kann in den Betrieben einiges getan werden, um vorzeitige Vertragslösungen zu vermeiden. So werden von den befragten Auszubildenden in erster Linie das schlechte Klima zum Ausbilder/ Vorgesetzten für ihre Überlegungen, die Ausbildung abzubrechen geltend gemacht. Neben diesen gestörten Kommunikationsbeziehungen spricht vieles dafür, dass auch organisatorische und betriebliche Rahmenbedingungen die Abbruchüberlegungen beeinflussen. Dies zeigt auch die vergleichende Analyse zwischen den Auszubildenden, die sich mit dem Gedanken an einen Abbruch der Ausbildung beschäftigen und den anderen Auszubildenden, für die der Abbruch nicht zur Diskussion steht. Bei den potenziellen Abbrechern liegen deutlich ungünstigere Ausbildungsbedingungen vor, sowohl was die pädagogische und soziale Betreuung, aber auch was die berufsinhaltliche Seite anbelangt: Diese Auszubildenden werden häufiger mit ausbildungsfremden Tätigkeiten betraut; es wird Ihnen seltener die Möglichkeit zu selbstständigem Ausprobieren und Einüben von Arbeitsaufgaben geboten, gleichzeitig erhalten sie weniger Unterstützung und Betreuung im betrieblichen Lernprozess. Insgesamt fühlen sie sich ungenügend auf den Beruf vorbereitet. Ein Teil dieser Mängel ließe sich durch bessere pädagogische Vorbereitung und Qualifikation des Ausbildungspersonals beheben. Ein wichtiges Ziel wäre dabei neben der inhaltlichen Verbesserung der Ausbildungsqualität vor allem die Verbesserung des Ausbildungsklimas und die Intensivierung der individuellen Betreuung, um frühzeitig Probleme bei den Auszubildenden zu erkennen und Unterstützung und Hilfen anbieten zu können. Hier liegt es u. a. in der Verantwortung der zuständigen Kammern, im Rahmen ihrer Aufsichts- und Kontrollfunktion den Betrieben verstärkt Hilfestellungen anzubieten.
Alex, L.; Menk, A.; Schiemann, M. (1997): Vorzeitige Lösung von Ausbildungsverträgen. In: BWP 4/1997.
Beer-Kern, D. (1993): Schulbildung junger Migranten. Berichte zur Beruflichen Bildung, Heft 166/1993 Berlin.
Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.)(2000): Berufsbildungsbericht 2000, Bonn.
Faßmann, H. (1998): Das Abbrecherproblem - die Probleme der Abbrecher. In: Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste der Bundesanstalt für Arbeit - (ibv), Heft 34/1998.
Feller, G. (1995): Duale Ausbildung: Image und Realität. Eine Bestandsaufnahme aus Lernersicht. Materialien zur beruflichen Bildung, Bonn.
Grieger, D. (1981): Wer bricht ab? Berufsausbildungsabbrecher im Vergleich zu Jungarbeitern und Auszubildenden. Berichte zur beruflichen Bildung, Heft 38/1981, Berlin.
Grieger, D.; Hensge, K. (1992): Ausbildungsabbrüche - unvermeidbar? In: Berufsbildung, Heft 17/1992.
Hecker, U. (1989): Betriebliche Ausbildung: Berufszufriedenheit und Probleme. Eine bundesweite Repräsentativbefragung von Auszubildenden ab dem zweiten Lehrjahr. Berichte zur beruflichen Bildung, Heft 106/1989, Berlin.
Hecker, U. (1999): Arzthelferinnen in der Ausbildung - Erfahrungen und Einschätzungen. In: BWP 2/1999.
Hensge, K. (1984): Gründe und Folgen des Ausbildungsabbruchs. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Band 80, Heft 1/1984.
Hensge, K. (1987): Ausbildungsabbruch im Berufsverlauf - Eine berufsbiographische Studie. Berichte zur beruflichen Bildung, Heft 87/1987, Berlin.
Jugendwerk der deutschen Shell (Hrsg.) (1997): Jugend' 97 - Zukunftsperspektiven, gesellschaftliches Engagement, politische Orientierungen. 12. Shell Jugendstudie. Opladen.
Jungkunz, D. (1996): Zufriedenheit von Auszubildenden mit ihrer Berufsausbildung. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 92. Band, Heft 4/1996.
Puhlmann, A. (1994): Berufsausbildung - Lebensmuster ohne Wert? Zur Berufslosigkeit junger Erwachsener in den alten und neuen Bundesländern. In: Puhlmann, A.: Junge Erwachsene ohne Berufsausbildung. Lebenslagen, Berufsorientierungen und neue Qualifizierungsansätze. Tagungen und Expertengespräche zur beruflichen Bildung, Heft 20. Hrsg.: Bundesinstitut für Berufsbildung. Bielefeld.
Zielke, D. (1998): Die Ursachen des Ausbildungserfolgs aus Schülersicht. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 94. Band, Heft 3/1998.
Die Konzentration junger Frauen in bestimmten und nur wenigen Berufssparten und ihre immer noch unterdurchschnittliche Partizipation an Ausbildungen, die Chancen eröffnen, führt zu der Frage, wie der Prozess des Übergangs von Schule und Ausbildung bei jungen Frauen verläuft.
Eine geringe Teilhabe junger Frauen in gewerblich-technischen Berufen - das gilt seit Neuerem auch für IT-Ausbildungsberufe - wird in der Diskussion häufig mit ihrer geschlechtsspezifischen Berufswahl in Zusammenhang gebracht. Mangelndes Interesse von Schulabgängerinnen an technischen Berufsfeldern sowie die Hinwendung zu so genannten "frauenspezifischen" Ausbildungsberufen werden immer wieder erörtert.
Zur Erklärung werden unterschiedliche Annahmen herangezogen. Die These, dass eine schwierige Lage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu einer Restabilisierung traditioneller Orientierungen in den Lebensentwürfen junger Frauen führt, ist bisher jedoch nicht durch empirische Untersuchungen belegt. Demgegenüber steht die Annahme, dass die Berufswahl junger Frauen in engem Zusammenhang mit den gegebenen Möglichkeiten im Ausbildungssektor zu sehen ist.
Faktisch ist jedoch über die Prozesse der Berufsorientierung und Berufswahl der heutigen Generation von Schulabgängerinnen wenig bekannt.
Zu fragen ist daher, wie Schulabgängerinnen ihre Handlungschancen wahrnehmen und mit welchen Orientierungen und Strategien sie angesichts der Bedingungen, die sie vorfinden den Übergang zwischen Schule und Ausbildung gestalten.
Aus diesen Überlegungen heraus greift der vorliegende Beitrag folgende zentrale Fragen auf: Welche beruflichen Orientierungen und Strategien entwickeln junge Frauen, um den Übergang in eine Ausbildung zu bewältigen und welche Partizipationschancen finden sie vor?
Der Übergang junger Frauen zwischen Schule und Ausbildung ist mit wachsenden Handlungsspielräumen einerseits und zunehmenden Risiken andererseits verbunden. Mit Blick auf die Heterogenität der heutigen Generation von Schulabgängerinnen behandelt der folgende Beitrag auch die Frage, in welcher Weise sich entsprechende Chancen und Risiken zwischen Schulabgängerinnen aus den neuen und alten Bundesländern sowie ausländischer Herkunft unterschiedlich verteilen.
Im Anschluss an eine einleitende Diskussion über Thesen zum Berufswahlprozess junger Frauen (1) werden die Übergangsprozesse und die damit verbundenen Orientierungen und Strategien an der ersten Schwelle exemplarisch analysiert (2). Weitere Themenschwerpunkte sind die Bedeutung berufs- und familienbezogener Lebenspläne (3) sowie die Partizipationschancen junger Frauen an beruflicher Ausbildung, insbesondere im dualen System (4). Abschließend werden Fördermöglichkeiten junger Frauen im Übergang Schule - Ausbildung erörtert (5).
Angesichts der zunehmenden Vielfalt möglicher Lebensentwürfe und sozialer Lagen junger Frauen in Deutschland stellen Schulabgängerinnen eine in vieler Hinsicht heterogene Gruppe dar. Neben Unterschieden in Lebensstilen, Chancen und Bedingungen sind regionale Ungleichheiten sowie Transformations- und Migrationsprozesse Ursachen für die Ausdifferenzierung sozialer Lagen.
Nicht abschließend beantwortet ist jedoch, wie sich diese auswirken auf die Berufswahl und den Übergang junger Frauen von der Schule in eine Ausbildung bzw. in den Beruf.
Die Einmündung junger Frauen in Ausbildung und Beruf ist ein komplexer Vorgang, der sich gegenüber früher tendenziell über einen längeren Zeitraum ausdehnt und zunehmend mehr einzelne Stationen beinhaltet. Er kann Phasen der Orientierungssuche und Aufenthalte in berufsvorbereitenden Maßnahmen, Zeiten des "Unversorgtseins" und der Kindererziehung umfassen.
Ob dabei der Zugang zu einer beruflichen Ausbildung gelingt, ist für heutige Schulabgänger/ -innen ungewisser geworden. Der schulische Abschluss allein ist nicht ausschlaggebend dafür, wie junge Frauen einen Übergang in eine berufliche Ausbildung finden. Neben Einrichtungen schulischer und beruflicher Bildung gelten Einflüsse in der Familie (Hoose/ Vorholt 1997) sowie auch seitens Gleichaltriger (Granato/ Schittenhelm 2000) als maßgeblich und gehören neben Praktika und ersten Arbeitserfahrungen zum Umfeld einer vorberuflichen Sozialisation.
Der Übergang zwischen Schule und beruflicher Ausbildung ist auch abhängig von der Art und Weise, wie junge Frauen in dieser Phase die Erfahrungen der Möglichkeiten und Grenzen, die sich am Ausbildungsmarkt bieten, bewältigen. So stellt Krüger (1993) zur Diskussion, dass die Einmündung junger Frauen in so genannte "frauenspezifische" Ausbildungsberufe keinesfalls immer auf ihre berufliche Orientierung zurückzuführen ist. Vielmehr resultiert sie u. a. aus einer Verarbeitung eingeschränkter Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.
Bei Längsschnitt-Untersuchungen in der Bundesrepublik zu Einstellungen von Jugendlichen im Verlauf von Übergängen in den 80er Jahren wurde aufgezeigt, dass sich die Optionen, die junge Frauen während ihrer Such- und Orientierungsprozesse im Vorfeld einer Berufsausbildung ins Auge fassen, zunehmend verengen (Heinz u. a. 1987). Ähnliche Ergebnisse belegen dies gleichfalls für junge Frauen aus den neuen Bundesländern (Heyn/ Schnabel/ Roeder 1997).
Demnach wäre die Einmündung und Konzentration junger Frauen unterschiedlicher Zielgruppen in so genannte "frauenspezifische" Berufe nicht (allein) eine Folge ihrer Berufswahl, sondern auch des gegebenen Ausbildungsstellenmarktes, d. h. der Schwierigkeit, Orientierungen auch angesichts fehlender Ausbildungsstellen umsetzen zu können.
Wie unterschiedlich Prozesse der Entwicklung beruflicher Orientierungen und Strategien bei der heutigen Generation von Schulabgängerinnen verlaufen können, legt - vor dem Hintergrund der oben genannten These - der folgende Abschnitt dar.
Anhand vergleichender Fallanalysen, die junge Frauen aus Migrantenfamilien sowie aus ost- und westdeutschen Familien einbeziehen, werden exemplarisch berufliche Orientierungen sowie Strategien des Berufwahlverhaltens, die Entwicklung berufsbiografischer Entwürfe und mögliche Verlaufsformen des Übergangs junger Frauen an der ersten Schwelle aufgezeigt. (1)
Berufliche Orientierungen junger Frauen werden u. a. durch den Austausch mit Gleichaltrigen und durch das Aufwachsen mit den Lebensbedingungen in ihrem Wohnumfeld vermittelt. Auch Sozialisationsprozesse unter Gleichaltrigen aus der Schule oder dem Stadtteil tragen zur Entwicklung eigener Orientierungen und Strategien bei. Die jeweiligen sozialen Bedingungen beeinflussen diese Entwicklung.
Orientierung an weiblichen Bezugspersonen aus dem persönlichen Umfeld: Die im sozialen Umfeld praktizierten Lösungen bilden den Kontext für die Entwicklung eigener Handlungsstrategien.
Die Orientierung an anderen jungen Frauen kann bei Schulabgängerinnen eine Einmündung in so genannte "Frauenberufe" begünstigen: Bei den befragten jungen Frauen zeigt sich wiederholt eine Orientierung an weiblichen Bezugspersonen in ihrem sozialen Umfeld. Diese jungen Frauen wählen einen Beruf, den sie bei ihrer Schwester oder Freundin beobachten können oder sie entwickeln eine gemeinsame Orientierung im Freundinnenkreis hin zu Berufen, die als interessant und erreichbar gelten. Dies führt dazu, dass diese jungen Frauen fast durchweg in so genannte "frauenspezifische" Ausbildungsberufe, wie zum Beispiel in den Beruf der Erzieherin oder Krankenschwester, einmünden. Die Orientierung an den Erfahrungen anderer junger Frauen hat in diesen Fällen zur Folge, dass sie sich innerhalb eines begrenzten Spektrums bewegen und die Konzentration in spezifischen Berufen bzw. Berufsfeldern verstärkt wird. Dabei bilden die im sozialen Umfeld praktizierten Lösungen den Kontext für die Entwicklung eigener Handlungsstrategien.
Gegenentwurf: Junge Frauen grenzen sich von den Orientierungen weiblicher Bezugspersonen ihres Umfelds ab.
Aus der weiteren Analyse ergibt sich demgegenüber, dass junge Frauen sich auch zu etwas anderem entschließen können - gerade angesichts dessen, was sie in ihrer Umgebung wahrnehmen. Auch hier spielt die Anteilnahme an den im unmittelbaren Umfeld vorgefundenen Möglichkeiten eine Rolle. Allerdings wollen die Mädchen in diesen Fällen nicht nachahmen, sondern suchen bewusst nach anderen Möglichkeiten. Wiederholt zeigt sich dabei, dass solche Schritte in der Familie oder im sonstigen Umfeld unterstützt werden: Es gibt z. B. Eltern, eventuell auch ältere Geschwister, die für die Jüngeren etwas anderes wollen, als sie selber vorgefunden haben.
Offensichtliche Beispiele für ein solches Abgrenzungsverhalten gegenüber vorgelebten Handlungsentwürfen sind diejenigen jungen Frauen der Befragung, die sich für gewerblich-technische Berufe entschieden haben. Junge Frauen aus Migrantenfamilien, die anders als ältere Geschwister einen höheren Schulabschluss anstreben, um einen qualifizierten Beruf erlernen zu können, bilden ein weiteres Beispiel. Eine solche Bildungs- und Berufsorientierung ist auch mit einer bewussten Absage gegenüber sozialen Vorurteilen verbunden.
Die Einbindung in ein soziales Umfeld kann für Schulabgängerinnen eine Unterstützung in einer Lebensphase sein, in der sie aus institutionalisierten Zusammenhängen zumindest vorübergehend herausfallen. Wenn es sich um marginalisierte Milieus, soziale Brennpunkte oder um Regionen mit schlechten Standortbedingungen handelt, kann eine solche Einbindung jedoch eine potenzielle Grenze für eigene Handlungsspielräume bedeuten.
Orientierung an Bezugspersonen aus dem persönlichen Umfeld unter schwierigen Ausbildungsmarktbedingungen
Unter schwierigen Arbeitsmarktbedingungen können Orientierungen von Schulabgängerinnen am eigenen Umfeld bzw. an Personen des Umfelds in der Phase der Berufswahl zu weiteren Einschränkungen ihres Handlungsspielraums beitragen: Die Erfahrung von schwierigen Bedingungen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt kann dazu führen, dass sich die eigenen Maßstäbe an eine Umgebung angleichen, in der viele Gleichaltrige keinen Ausbildungsplatz erhalten und die Elterngeneration (zum Teil) arbeitslos ist. Ausbildungslosigkeit, Arbeitslosigkeit oder chancengeminderte Ausbildungsgänge können unter diesen Bedingungen akzeptabel erscheinen. Selbst eine Ausbildung mit geringen Übernahmechancen wird hingenommen, wenn die Ausbildungsmarktlage als aussichtslos eingeschätzt wird.
So wird z. B. bei jungen Frauen, die an Förderlehrgängen der Jugendberufshilfe teilnehmen, deutlich, wie ambivalent ihre Orientierung an anderen Gleichaltrigen in derselben Lage ist. Zwar erleben sie, dass sie mit ihren Problemen nicht allein sind und erfahren so Unterstützung. Gleichzeitig kann die Orientierung an den Gelegenheiten innerhalb dieses Umfeldes aber auch verhindern, dass sie die notwendige Mobilität aufbringen, um ihre Chancen zu verbessern (Schittenhelm 1998). So laufen sie Gefahr, im Maßnahmen- und Hilfesystem zu verbleiben - weit entfernt von einem Einstieg in eine anerkannte Ausbildung. (2)
Auch die Einmündung in einen Ausbildungsberuf, der ursprünglich nicht angestrebt wurde, kann vor dem Hintergrund eines schwierigen Ausbildungsmarktes zu einer positiven Bewertung der Ausbildungsstelle führen, wenngleich ein beruflicher Einstieg im jetzigen Ausbildungsberuf als chancenlos eingeschätzt wird. Durch die Bewertung der eigenen Situation als unveränderbar, vertun die jungen Frauen Potenziale, um doch noch eine Ausbildungsalternative mit Zukunftsaussichten zu suchen.
Dies lässt sich am Beispiel einer Gruppe von Schulabgängerinnen mit Realschulabschluss zeigen, die nicht im Wunschberuf unterkommen. Ihren derzeitigen Ausbildungsberuf der Bäckereifachverkäuferin schätzen sie als aussichtslos ein, da sie beobachten, wie alle ihre Vorgängerinnen nicht übernommen, sondern durch neue Auszubildende ersetzt wurden. Doch angesichts der knappen Lehrstellensituation in ihrer Umgebung sehen sie für sich selbst keine Alternative. Dabei beurteilen sie ihre Situation im Vergleich zu arbeitslosen Jugendlichen ihrer Umgebung und sind froh, "überhaupt etwas zu haben".
Die Deutungsangebote und Lösungsstrategien, die im sozialen Umfeld praktiziert werden, bilden auch hier den Kontext für eigene Handlungsstrategien. In einem Umfeld, in dem die Lage allgemein als aussichtslos gilt, verschieben sich die Maßstäbe dergestalt, dass die jungen Frauen Möglichkeiten, in eine Ausbildung mit Übernahmechancen einzumünden, nicht mehr wahrnehmen: Sie schätzen ihre eigene Situation als unveränderbar ein und ziehen keine positiven Alternativen mehr in Betracht.
Orientierungen an Freizeit und privaten Lebensentwürfen als Form des Rückzug aus dem Qualifizierungsprozess
Bei den befragten Schulabgängerinnen ist unter bestimmten Bedingungen auch ein Rückzug aus den Bereichen Schule, Ausbildung und Beruf zu beobachten. Die Möglichkeit der Existenzsicherung über eine Familiengründung alternativ zu einem Beruf besteht für die jungen Frauen in den betreffenden Fällen nicht. Statt dessen zeigen sich andere Formen eines Rückzugs von berufsbezogenen Lebensplänen: Junge Frauen können als Alternative dazu auf Aktivitäten in Gruppen von ebenfalls marginalisierten Jugendlichen ausweichen.
Anhand von Fallstudien bei jungen Müttern, die in der Abschlussklasse oder unmittelbar nach dem Abgang von der Schule ein Kind bekommen, ließ sich zeigen, dass eine Orientierung an tradierten familiären Lebensformen für diese Schulabgängerinnen nicht mehr möglich war. Stattdessen nahmen sie sozialstaatliche Hilfe in Anspruch; dabei erfolgte der Einstieg in die Qualifizierungsphase später und über die Jugendberufshilfe (Schittenhelm 1998).
Insgesamt weisen diese Ergebnisse darauf hin, dass heute für junge Frauen mit ungünstigen Bildungsabschlüssen oder unter schwierigen Ausbildungsbedingungen weder der Eintritt in eine anerkannte berufliche Qualifizierung noch der Rückzug auf eine Familiengründung als gesichert gelten können.
Die Erfahrungen früherer Etappen ihres Übergangs von Schule in Ausbildung und die Art und Weise, wie junge Frauen Schwierigkeiten verarbeiten, wirken sich gleichfalls auf weitere Strategien und Bewältigungsversuche aus.
"Handeln aus der Not" als Bewältigung von Misserfolgen: "Hauptsache eine Ausbildung"
Erleben junge Frauen bei der Realisierung der eigenen Ausbildungsziele Misserfolge, kann dies zu einer Orientierung an den verbleibenden Möglichkeiten führen, die bis hin zur Aufgabe der eigenen Wünsche und Interessen geht. In solchen Fällen lässt sich beobachten, dass junge Frauen nach dem Motto "Hauptsache eine Ausbildung" vorgehen.
Dabei zeigt sich in der vorliegenden Untersuchung folgendes Verlaufsmuster: Der Ausbildungseinstieg ist durch eine Abfolge von Misserfolgen gekennzeichnet; die jungen Frauen geben mehr und mehr eigene Wünsche und Interessen an einem Beruf auf und orientieren sich an den wenigen vorhandenen Möglichkeiten, bis hin zum kleinsten möglichen Nenner für sich selbst. Diese Orientierung, die sich unter dem Stichwort: "Hauptsache eine Ausbildung" zusammenfassen lässt, ist bereits aus früheren Untersuchungen bekannt (Heinz u. a. 1987, Seus 1993). Eine Folge hiervon ist - wie bereits in den vorigen Abschnitten dargestellt -, dass junge Frauen in Ausbildungsberufe mit geringeren Anforderungen aber auch geringeren Chancen oder in den zweiten Ausbildungsmarkt einmünden, nachdem bisherige Ausbildungsziele über Bord geworfen wurden.
Orientierungen am Umfeld und Handeln aus der Not heraus können dazu beitragen, dass junge Frauen ihre eigenen Perspektiven auf die unmittelbaren und erreichbar erscheinenden Optionen einschränken.
"Step by Step": schrittweise Realisierung eigener beruflicher Ziele und Wünsche
Als Gegenbeispiel zu einem schrittweisen Abbau von Motivation und einem Rückzug von den eigenen beruflichen Wünschen lassen sich Verlaufsmuster erkennen, die - ohne "glatte" Übergangsverläufe darzustellen - zu einem von den jungen Frauen positiv bewerteten Einstieg in eine Ausbildung führen. Auch in diesen Fällen machen junge Frauen wiederholt Versuche, ihre Ausbildungsziele zu realisieren; der Einstieg in eine Ausbildung kommt nur über Praktika und vorbereitende Lehrgänge zustande. Es handelt sich dabei um junge Frauen, denen zwar kein schneller oder direkter Einstieg gelingt, allerdings versuchen sie, schrittweise eine Ausbildung nach ihren Wünschen und Interessen zu erreichen. Ein Beispiel dafür aus der vorliegenden Untersuchung sind Auszubildende im Beruf der Krankenschwester, die zunächst eine Fülle von Absagen bekamen, daraufhin Praktika bei Ärzten und im Krankenhaus absolvierten und schließlich nach dem Besuch einer Vorschule einen Ausbildungsplatz in einer Klinik erhalten haben. Im Prozess der Einmündung in einen Beruf ist es ihnen möglich, eine berufliche Orientierung zu entwickeln, die schrittweise stabilisiert und umgesetzt werden konnte.
Junge Frauen können also den Einstieg in eine Ausbildung je nach bisherigem Verlauf des Übergangs als Erfolg oder als eine Reihe von Misserfolgen und als Aufgabe bisheriger Wünsche erleben.
Der Ablauf der einzelnen Etappen und die Art und Weise, wie Schulabgängerinnen ihre bisherigen Erfahrungen verarbeiten ist ausschlaggebend dafür, wie sie weitere Schritte bewältigen. Entscheidend für diesen Verlauf ist daher, ob junge Frauen den Einstieg in eine Ausbildung als Erfolg erleben, der das eigene Selbstvertrauen stärkt oder als Misserfolg bewerten, der mit dem Verlust von Vertrauen in die eigenen Handlungschancen einhergeht. Je nachdem kann es zu einem Rückzug, zu Neu- und Umorientierungen oder auch zu einer Stabilisierung beruflicher Orientierungen wie des Übergangsprozesses kommen.
Berufliche Orientierungen und Strategien junger Frauen sind damit auch für die heutige Generation von Schulabgängerinnen nicht nur Voraussetzung, sondern immer auch Ergebnis bisheriger Abläufe am Übergang Schule - Ausbildung und der dabei gebotenen Chancen und Gelegenheiten. Ausschlaggebend ist die Art und Weise, wie junge Frauen diese bewältigen und daraus weitere Strategien für ihren Einstieg in eine Ausbildung entwickeln.
Bewältigungsformen, die zu einer Selbstbeschränkung bei der Entwicklung beruflicher Perspektiven führen, wirken sich ungünstig auf den weiteren Verlauf von Statusübergängen aus. Umgekehrt gibt es auch bei nicht geradlinig verlaufenden Einmündungsprozessen an der ersten Schwelle Bewältigungsformen, die zu einem Versuch führen, die eigenen Qualifizierungsziele letztendlich doch schrittweise zu realisieren.
Gerade bei nicht geradlinigen Übergängen und schwierigen Ausbildungsmarktbedingungen ist es daher von Bedeutung, ob junge Frauen die Gelegenheit haben, während der Stationen im Vorfeld einer Ausbildung und im Verlauf von Neu- und Umorientierungen schrittweise einen realistischen beruflichen Handlungsentwurf zu entwickeln und eine entsprechende Motivation aufzubauen. So stellt sich z. B. bei Orientierungen am unmittelbaren Umfeld und bei Handeln aus der Not heraus, die bei jungen Frauen zu einer Einschränkung ihrer Perspektiven auf die unmittelbar erreichbaren Optionen beitragen können, die Frage nach der Verarbeitung von Misserfolgen. Das Verständnis in diese Dynamik von Misserfolgen und daraus resultierenden weiteren Einschränkungen der ohnehin geringen Handlungschancen kann dazu beitragen, rechtzeitig Angebote bereitzustellen, die den jungen Frauen im Umgang mit problematischen Erfahrungen Unterstützung bieten.
Immer wieder nimmt die These, dass eine schwierige Lage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu einer Restabilisierung traditioneller Orientierungen in den Lebensentwürfen junger Frauen führt, einen breiten Raum in öffentlichen Diskussionen ein. Es stellt sich daher die Frage, welchen Stellenwert Ausbildung, Beruf und Familienplanung im Leben junger Frauen heute haben und welche Vorstellungen Schulabgängerinnen über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie entwickelt haben. Diesen Fragen geht eine bundesweite Untersuchung von Auszubildenden in den alten wie neuen Ländern nach. (3)
Ausbildung und Beruf haben im Leben junger Frauen einen hohen Stellenwert. Das sind zentrale Ergebnisse nicht nur der vorliegenden bundesweiten Befragung von jungen Frauen in Ausbildung. (4)
Berufsarbeit steht gerade für weibliche Auszubildende in Ostdeutschland an vorderster Stelle ihrer Lebensplanung.
"Wenn ich viel Geld hätte, würde ich versuchen, damit beruflich weiterzukommen. (...) aber ohne Arbeit - nein. Ich war drei Monate arbeitslos, das hat mir gereicht" (w, Ost). (5)
Im dritten Ausbildungsjahr betonen weibliche Auszubildende in Ostdeutschland, wie wichtig es ist, durch eine Arbeit die eigene Existenz zu sichern: Für 80 % stehen "überhaupt eine Arbeit finden" und die Sicherheit des Arbeitsplatzes auf Platz eins der Erwartungen an das künftige Berufsleben. Als dritten Aspekt nennen 74 % der jungen Frauen gute Verdienstmöglichkeiten.
"Bei uns in der Firma spielen zur Zeit alle Lotto. Wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich das gar nicht erzählen. Und dann wäre ich so ehrgeizig, in meinem Beruf erst einmal weiter zu kommen (...)" (w, Ost).
61 % der weiblichen Auszubildenden im Osten können sich auch bei gegebener materieller Absicherung ein Leben ohne Arbeit nicht vorstellen. "Spaß" aber auch "Zufriedenheit" mit der Arbeit stehen an zweiter Stelle der Kriterienliste für die Berufsarbeit. Zudem halten zwei Drittel der jungen Frauen im Osten eine "interessante Arbeit" für sehr wichtig (69 %).
Welch hohen Stellenwert Erwerbsarbeit insbesondere für junge Frauen in den neuen Ländern hat, zeigt, wie bedeutsam für sie Anerkennung und Ansehen durch bzw. im Beruf sind: Häufiger als ihre männlichen Arbeitskollegen betonen sie, wie wichtig es ist, dass ihre Arbeit anerkannt (72 %) und gerecht beurteilt (69 %) wird, aber auch, dass sie später einen angesehenen Beruf ausüben können (50 %).
In der Frage beruflicher Erwartungen rangieren bei weiblichen Auszubildenden im Westen Sicherheits-, Reproduktions- und Leistungskriterien auf Platz zwei nach persönlichen Sinnkriterien wie Spaß an der Arbeit und Zufriedenheit. Das Kriterium "Spaß an der Arbeit" ist jungen Frauen im Westen wichtiger als der männlichen Vergleichsgruppe - ähnlich zu dem Anteil der Auszubildenden im Osten.
|
| Sehr wichtig |
Alle Auszubildenden |
Weibliche Auszubildende Ost |
Weibliche Auszubildende West |
| überhaupt eine Arbeit zu bekommen. |
61 |
77 |
60 |
| dass Ihr Arbeitsplatz auf alle Fälle gesichert ist? |
59 |
83 |
50 |
| dass Ihnen Ihre Arbeit Spaß macht? |
67 |
79 |
67 |
| dass Sie später mit Ihrem Arbeitsplatz zufrieden sind? |
63 |
75 |
62 |
| dass Sie gut bezahlt werden? |
56 |
74 |
46 |
| dass Sie Ihre Arbeit gut machen? |
57 |
71 |
55 |
| dass Ihre Arbeit anerkannt wird? |
44 |
72 |
40 |
| dass Sie einen angesehenen Beruf haben? |
29 |
50 |
27 |
| dass Ihnen Ihre Arbeit möglichst viel Freizeit lässt? |
26 |
26 |
31 |
| gerechte Beurteilung |
52 |
69 |
50 |
Quelle: BIBB Forschungsprojekt JuB (vgl. Granato 2000b).
Im Vergleich zu jungen Frauen in Westdeutschland räumen die Befragten in Ostdeutschland einer Vielzahl von Aspekten für die künftige Berufsarbeit eine vergleichsweise höhere Priorität ein. Dies gilt für Sicherheits-, Reproduktions- und Leistungskriterien genauso wie für Spaß an der Arbeit und Zufriedenheit. Auch ein hoher Verdienst ist jungen Frauen im Osten erheblich häufiger sehr wichtig als jungen Frauen im Westen. Im direkten Vergleich zeigt sich, dass bei weiblichen Auszubildenden in den neuen Ländern Sicherheitsaspekte an erster Stelle rangieren, dicht gefolgt von Spaß an der Arbeit, in den alten Ländern umgekehrt.
Auch für Schulabgängerinnen aus Migrantenfamilien haben berufliche Ausbildung und zukünftiger Beruf einen zentralen Stellenwert. Berufliche Qualifizierung ist für die große Mehrheit (75 %) der Schulabgängerinnen ausländischer Nationalität sehr wichtig - so die Ergebnisse einer bundesweiten Untersuchung des Bundesinstituts für Berufsbildung [18] (vgl. Granato 1999, 1999a). Ebenso halten es 84 % der Schulabgängerinnen ausländischer Herkunft für sehr wichtig, dass eine Frau einen Beruf erlernt und über ein eigenes Einkommen verfügt - ohne Unterschiede nach Nationalität. 58 % der Schulabgängerinnen wollen einen Beruf erlernen, genauso häufig wie die jungen Männer. Alternativ orientieren sie sich an einem Studium (11 %) oder am Besuch weiterführender Schulen (8 %) (Granato 1999).
An der ersten Schwelle weisen Schulabgängerinnen ausländischer Herkunft ein großes Engagement auf und unternehmen erhebliche Anstrengungen, um ihre Berufsziele auch tatsächlich zu erreichen: Sie verfolgen ihre Qualifizierungsziele konsequent und verwenden dabei unterschiedliche Strategien. Rund 90 % der Schulabgängerinnen türkischer aber auch italienischer, spanischer und portugiesischer Nationalität, die nach Abschluss der allgemein bildenden Schule eine berufliche Ausbildung aufnehmen wollten, haben sich auf eine Ausbildungsstelle beworben (Granato 1999).
Diese Ergebnisse widerlegen gängige Klischees, Mädchen ausländischer Herkunft würden sich seltener als Jungen für berufliche Qualifikation interessieren, denn Schulabgängerinnen bewerten häufiger als männliche Schulabgänger Berufsausbildung als sehr wichtig. Dieser Unterschied verstärkt sich noch mit steigendem Bildungsabschluss.
Untersucht man den Zusammenhang zwischen beruflichen und familiären Lebensplänen, stellt sich erst die Frage, welche familiären Lebenspläne junge Frauen entwickelt haben.
Für zwei Drittel der jungen Frauen im Osten und für die Hälfte der jungen Frauen im Westen (53 %) sind Kinder fester Bestandteil ihrer Lebensplanung. Dabei möchte rund die Hälfte der weiblichen Auszubildenden später sicher heiraten - junge Frauen in den neuen Ländern häufiger als in den alten (weibliche Auszubildende Ost 55 %, West 47 %, vgl. Granato 2000b).
Allerdings zeigen empirische Untersuchungen, dass die Realisierung der Familiengründung bei jungen Frauen in Ost und West innerhalb der eigenen Biografie verschoben wird. Dies geschieht in Abhängigkeit davon, wie ihnen eine Stabilisierung im Berufsleben gelingt (Seidenspinner u. a. 1996, S. 216).
Unterschiede in den Vorstellungen und Präferenzen wie Familie und Beruf vereinbart werden können, zeigen sich zwischen weiblichen Auszubildenden in Ost und West. Diese Unterschiede sind jedoch besonders deutlich zwischen weiblichen und männlichen Auszubildenden im Westen.
Rund 80 Prozent der jungen Frauen - und Männer - in den neuen Ländern bevorzugen die ganztägige Erwerbstätigkeit beider Partner und die gleichgewichtige Aufteilung der Familien- und Hausarbeit. Andere Vereinbarkeitskonzepte finden dagegen eine sehr viel geringere Zustimmung.
Im Westen befürworten junge Frauen zwei Modelle: Die gleichgewichtige Aufteilung der häuslichen und familiären Aufgaben zwischen den Partnern wird entweder mit einer Teilzeitarbeit für beide (55 %) oder mit einer Vollzeiterwerbstätigkeit von Frau und Mann kombiniert (53 %). Jede dritte junge Frau findet hier auch an dem Modell der alleinigen Erwerbsarbeit des Partners Gefallen (36 %). Deutlich anders denken dagegen junge Männer in den westlichen Ländern, wie die folgende Tabelle darlegt (vgl. Granato 2000b).
männlich |
weiblich |
|||
|
Ost |
West |
Ost |
West |
|
| Beide arbeiten ganztags und teilen Hausarbeit und Kindererziehung. |
80 |
41 |
78 |
53 |
| Beide arbeiten Teilzeit und teilen Hausarbeit und Kindererziehung. |
15 |
41 |
23 |
55 |
| Nur Mann arbeitet, Frau macht ganz oder überwiegend Hausarbeit und Kindererziehung. |
27 |
53 |
24 |
36 |
| Nur Frau arbeitet, Mann macht ganz oder überwiegend Hausarbeit und Kindererziehung. |
3 |
9 |
3 |
12 |
| Mann soll im Beruf mehr, dafür zu Hause weniger arbeiten. |
32 |
46 |
28 |
34 |
| Frau soll im Beruf mehr, dafür zu Hause weniger arbeiten. |
3 |
8 |
3 |
14 |
Quelle: BIBB Forschungsprojekt JuB (vgl. Granato 2000b).
Heirat ist für die große Mehrheit junger Frauen - für 85 % im Osten und 75 % im Westen - kein Grund, längere Zeit die Arbeit zu unterbrechen. Selbst im Falle eines Lottogewinns würde nicht einmal die Hälfte der jungen Frauen in Ausbildung längere Zeit die Erwerbstätigkeit unterbrechen, im Osten gerade jede Dritte. Nur die Geburt des ersten bzw. weiterer Kinder stellt für eine große Mehrheit junger Frauen in Ausbildung einen Grund für eine längere Unterbrechung dar (weibliche Auszubildende Ost 77 %, West 85 %). Dass dies gerade jungen Frauen im Osten nicht leicht fällt, zeigt ihre zurückhaltende Zustimmung, wenn es darum geht, "sich vorübergehend ganz dem Privatleben/ der Familie zu widmen". Dem stimmen nur 38 % der weiblichen Auszubildenden im Osten, jedoch 56 % der jungen Frauen im Westen zu.
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Frauen und Männer richten sich - gerade im Osten - auf lebenslange Erwerbsarbeit ein. Das bei weitem bevorzugte Modell bleibt in den neuen Bundesländern die ganztägige Berufsarbeit beider Partner und die Aufteilung von Hausarbeit und Kindererziehung. Während sich im Osten die Präferenzen junger Frauen und Männer am Ende der Ausbildung im Wesentlichen auf ein Vereinbarkeitskonzept konzentrieren, orientieren sich angehende Fachkräfte im Westen weniger an einem Modell als an einer Reihe unterschiedlicher Vorstellungen. Dabei zeigt es sich, dass die Auffassungen junger Frauen und Männer im Westen über die Vereinbarkeitsfrage zum Teil stark divergieren.
Die Mehrheit junger Frauen aus Migrantenfamilien wünscht Beruf und Familie realisieren zu können. Hierbei sind verschiedene lebenszeitliche Arrangements vorstellbar. Eine Orientierung, die sich ausschließlich an familiären Lebensplänen ausrichtet, ist bei Schulabgängerinnen ausländischer Herkunft kaum vorhanden. Lediglich wenn der Prozess des Übergangs von Schule in Ausbildung bzw. Beruf von ständigen Misserfolgen begleitet ist, kann sich bei Schulabgängerinnen mit Migrationshintergrund eine familiäre Orientierung herausbilden und durchsetzen: Familiengründung ist in diesem Falle eine "second best"-Strategie, um in der Umgebung doch noch als erfolgreich gelten zu können (Stanger 1994). Berufliche Pläne werden dabei meist nicht endgültig aufgegeben, sondern zeitlich verschoben.
Die Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede in den aktuellen Orientierungen junger Frauen dürfen über eines nicht hinwegtäuschen: Die biografischen Vergleichshorizonte, die jungen Frauen für ihre eigene Lebensplanung zur Verfügung stehen, unterscheiden sich bei den verschiedenen Zielgruppen z. T. erheblich. Während bei jungen Frauen ostdeutscher Herkunft die Lebensplanung der Müttergeneration mit stabilen Beschäftigungen und einer ausgebauten öffentlichen Betreuung für Kinder unter drei Jahren verbunden war, sind sie selbst vor völlig andere Bedingungen gestellt. Junge Frauen aus Migrantenfamilien, die mit einem Schulabschluss eine berufliche Ausbildung anstreben, finden ebenfalls ungesichertere Bedingungen vor als die erste Generation der Migranten. Im Verhältnis zu ihren Müttern, die in der Regel ungelernten Berufstätigkeiten nachgingen, sind sie zwar im Begriff einen Bildungsaufstieg zu vollziehen - allerdings ohne günstige Bedingungen auf dem Ausbildungsmarkt vorzufinden, trotz ihrer Schulabschlüsse.
Eine alleinige Orientierung an familiären Lebensplänen stellt, wie die vorliegenden Untersuchungsergebnisse belegen, für die große Mehrheit der heutigen Generation von Schulabgängerinnen keine Alternative dar. Sie kann sich für einen Teil derjenigen, die sich großen Schwierigkeiten beim Übergang in eine Ausbildung gegenübersehen, als eine "second best" Strategie darstellen, beinhaltet jedoch meistens lediglich eine zeitliche Verschiebung der eigenen Qualifizierungspläne. Junge Frauen aller Zielgruppen möchten in je unterschiedlichen zeitlichen und innerfamiliären Konstellationen Beruf und Familie miteinander in Einklang bringen.
Die These, dass eine schwierige Lage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu einer Restabilisierung traditioneller Muster in den Lebensentwürfen junger Frauen führt (vgl. Diezinger 1991), lässt sich für die hier betrachteten Zielgruppen von Schulabgängerinnen nicht empirisch belegen: Weder junge Frauen aus ost- bzw. westdeutschen Familien noch junge Frauen aus eingewanderten Herkunftsfamilien neigen dazu, ihre Ausbildungs- und Berufsziele aufzugeben und stattdessen ausschließlich familienbezogene Lebenspläne zu verfolgen. Auch am Beispiel von Teilnehmerinnen in Förderlehrgängen der Jugendberufshilfe wird deutlich, dass eine schwierige Lage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt die betreffenden jungen Frauen nicht notwendigerweise davon abhält, ihre an Ausbildung und Beruf orientierten Pläne zu verfolgen (Schittenhelm 1998). Die Ergebnisse der Fallstudien (vgl. Abschnitt 2) weisen gleichfalls darauf hin, mit welchem Engagement, Durchhaltevermögen und unterschiedlichen Strategien sich Schulabgängerinnen für den Zugang zu einer qualifizierten Berufsausbildung einsetzen, auch unter schwierigen Ausbildungsmarktbedingungen.
Mangelndes Interesse junger Frauen an einer beruflichen Ausbildung ist daher bei allen betrachteten Zielgruppen als eine Ursache für die (schwierige) Umsetzung ihrer beruflichen Ziele auszuschließen. Im Gegenteil haben Ausbildung und Beruf im Leben junger Frauen einen zentralen Stellenwert - auch unter schwierigen Ausbildungs- und Arbeitsmarktbedingungen.
Die Erkenntnisse von Berufs- und Frauenforschung an diesem Punkt weisen deutlich in eine Richtung: Während Männer eher vom Zusammenwirken von Beruf und Familie profitieren, ist für die Lebensentwürfe und Chancen von Frauen die Kombination selten unterstützend, häufig aber erschwerend (Krüger 1995). Insbesondere in der Phase des Übergangs von der Ausbildung in den Beruf prallen für Frauen die gegensteuernden Wirkungen aufeinander.
Die Ergebnisse im folgenden Abschnitt stützen sich einerseits auf Auswertungen bundesweiter Statistiken und sind andererseits Resultat überregionaler Untersuchungen und Studien. Die Ergebnisse werden thesenartig zusammengefasst
Eine abgeschlossene berufliche Erstausbildung ist für die meisten jungen Frauen in Deutschland Teil ihrer Bildungs- und Berufsbiografie. Jedoch bleibt 2000 - nach Auswertungen des Mikrozensus - rund jede zehnte junge Frau deutscher Nationalität im Alter zwischen 20-30 Jahren ohne einen anerkannten Berufsabschluss (w: 12 %; m: 10 %). Bei jungen Frauen aus Migrantenfamilien ist dieser Anteil mit 43 % erheblich höher (m: 34 %). (6)
Die Gründe für die geringen Ausbildungschancen junger Frauen ausländischer Herkunft sind jedoch kaum - wie eine Reihe von Forschungsergebnissen und der vorige Abschnitt zeigen - in restriktiven persönlichen oder familiären Einstellungen gegenüber einer beruflichen Zukunftsplanung zu finden. Im Vergleich zu ihrer hohen Motivation, an einer beruflichen Ausbildung zu partizipieren, sind jedoch ihre Chancen auf eine duale Ausbildung und damit auf eine tragfähige Integration auf dem Arbeitsmarkt eingeschränkt (s. u.).
Ausbildung und Beruf sind im Leben junger Frauen zentral. Die Mehrheit wünscht Ausbildung, Beruf und Familie realisieren zu können. So beabsichtigen rund zwei von drei jungen Frauen unmittelbar oder mittelbar nach dem Schulabschluss eine duale Ausbildung aufzunehmen (Fischer/ Schulte 2001). Ähnlich hoch liegt der Anteil von Schulabgängerinnen ausländischer Herkunft mit dieser beruflichen Planung (vgl. 3.1).
Doch nur rund 40 % der Auszubildenden im dualen System sind weiblichen Geschlechts.
Junge Frauen nutzen zwar auch häufiger als junge Männer Bildungsangebote von Vollzeitberufsschulen, die einen anerkannten Berufsabschluss ermöglichen, sie münden aber zum Teil auch in Bildungsgänge der Berufsschulen, die nicht zu einem anerkannten Berufsabschluss führen, sondern "Warteschleifen" bedeuten.
Das duale System bietet männlichen Schulabgängern auch weiterhin deutlich bessere Chancen einer qualifizierten Berufsausbildung als jungen Frauen, obgleich Schulabgängerinnen - deutscher wie ausländischer Nationalität - häufiger weiterführende Schulabschlüsse erreichen als die jeweilige männliche Vergleichsgruppe (Berufsbildungsbericht 2000).
Schulabgängerinnen in den neuen Bundesländern haben ein starkes Interesse unmittelbar nach der Schule eine duale Ausbildung zu beginnen (49 %) - häufiger als Schulabgängerinnen in den alten Ländern (34 %; Fischer/ Schulte 2001). Sie stehen mit guten bis zum Teil sehr guten schulischen Bildungsabschlüssen dennoch recht häufig vor der Wahl, eine Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Lernstätte zu beginnen (Ulrich 2001) oder mangels anderer Alternativen weiterführende schulische Bildungsgänge zu besuchen. Die vorliegenden Strukturdaten zur Berufsausbildung nach dem Arbeitsfördergesetz zeigen zudem, dass bei jungen Frauen in außerbetrieblichen Einrichtungen diejenigen mit Schulabschuss (Hauptschule und höher) überwiegen, während im Vergleich dazu bei den jungen Männern die Teilnehmer ohne Schulabschuss in der Mehrzahl sind (Schittenhelm 1998, S. 297).
In den letzten Jahren ist es nicht gelungen, die Teilhabe von Mädchen in gewerblich-technischen Berufen zu steigern.
Über 60 % der Berufe sind männlich dominiert bzw. überwiegend männlich besetzt, rund 20 % der Ausbildungsberufe sind von Frauen dominiert bzw. überwiegend von ihnen besetzt. Gemischt besetzte Berufe, in denen junge Frauen und Männer in ungefähr gleichen Anteilen ausgebildet werden, sind mit rund 10 % eindeutig in der Minderheit (Berufsbildungsbericht 2000).
Erwartungen, man könne die Teilhabe junger Frauen in gewerblich-technischen Berufen steigern, diese Berufe für Frauen öffnen und den Anteil weiblicher Auszubildenden erhöhen, haben sich nicht erfüllt. Im Gegenteil: Im Westen geht der Anteil junger Frauen in männlich dominierten Berufen seit einigen Jahren zurück und beträgt 9 % (2000). Gerade in den Handwerksberufen wie Kraftfahrzeugmechaniker/ -in, Tischler/ -in, Maler/ -in und Lackierer/ -in ist die Quote weiblicher Auszubildender rückgängig. (8) Dies gilt auch für eine Reihe industrieller Fertigungsberufe: So ist z. B. der Anteil junger Frauen im Ausbildungsberuf Geräte- und Feinwerktechnik von 9,0 % (1990) auf 5,7 % (2000) gesunken.
Die Segmentierung des Ausbildungsmarktes zeigt sich in den einzelnen Ausbildungsbereichen erneut. Im Vergleich zu ihrem bereits verhältnismäßig niedrigen Anteil von knapp 40 % im dualen System ist der Anteil junger Frauen an allen Auszubildenden des Handwerks mit 22 % besonders gering.
Im vergleichsweise kleinen Segment der freien Berufe sind junge Frauen in Ost und West dagegen fast unter sich. Auch im öffentlichen Dienst, der insgesamt nur knapp 3 % aller Ausbildungsplätze bietet, sind sie mit einer knappen Zweidrittelmehrheit stark vertreten.
Die wenigen jungen Frauen ausländischer Nationalität, denen ein Einstieg in das duale System gelingt, werden im Vergleich zu jungen Frauen in Westdeutschland seltener im Bereich von Industrie und Handel ausgebildet. Stärker vertreten sind sie dagegen bei den freien Berufen.
|
| Anteil weiblicher Auszubildender an den Wirtschaftsbereichen | Weibliche Auszubildende West |
Weibliche Auszubildende Ost |
Ausländische weibliche Auszubildende |
| Industrie und Handel | 42,6 |
45,3 |
38,8 |
| Handwerk | 22,8 |
18,7 |
24,0 |
| Freie Berufe | 95,7 |
94,7 |
98,0 |
| Öffentlicher Dienst | 63,6 |
67,2 |
73,6 |
| Landwirtschaft | 26,9 |
32,3 |
20,0 |
| Insgesamt | 41,5 |
38,3 |
41,0 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 3; Berechnungen des BIBB.
Die geschlechtsspezifische Einmündung in Ausbildungsberufe betrifft demnach junge Männer wie Frauen. Nur gibt es mehr männlich als weiblich dominierte Berufe und somit mehr Ausbildungsmöglichkeiten für junge Männer.
75 % der jungen Männer erhalten eine berufliche Qualifizierung in einem männlich dominierten Ausbildungsberuf, 42 % der jungen Frauen in einem weiblich dominierten Beruf (vgl. Freistaat Thüringen (Hrsg.) (2001), Kap. 1.6). Der Anteil junger Männer, der in gemischt besetzten Berufen eine Ausbildung durchläuft, ist kleiner als bei jungen Frauen. Auch dringen Männer mit rund 6 % seltener in überwiegend weiblich besetzte bzw. dominierte Ausbildungsbereiche ein als umgekehrt Frauen mit 19 % in überwiegend männlich besetzte bzw. dominierte Ausbildungsdomänen. Die These einer geschlechtsspezifischen Einmündung in Ausbildungsberufe trifft damit auf junge Männer deutlich stärker zu als auf junge Frauen.
|
|
Weibliche Auszubil- |
Männliche Auszubil- dende West |
Weibliche Auszubil- |
Männliche Auszubil- |
Alle weiblichen Auszubil- |
Alle männlichen Auszubil- |
|
Männlich dominierte Berufe 0 - 20 % weibliche Azubis |
9 |
73 |
19 |
84 |
11 |
74 |
Überwiegend männlich besetzte Berufe 20 % - 40 % weibliche Azubis |
8 |
9 |
6 |
5 |
8 |
8 |
Gemischt besetzte Berufe 40 % - 60 % weibliche Azubis |
25 |
12 |
21 |
6 |
24 |
11 |
Überwiegend weiblich besetzte Berufe 60 % - 80 % weibliche Azubis |
15 |
4 |
19 |
3 |
16 |
4 |
Weiblich dominierte Berufe 80 % - 100 % weibliche Azubis |
44 |
2 |
36 |
2 |
42 |
2 |
Insgesamt |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 3; Berechnungen des BIBB.
Im Osten liegt der Frauenanteil in männlich dominierten Berufen mit 19 % doppelt so hoch wie im Westen. Schulabgängerinnen in den neuen Ländern erhalten häufiger als in den alten Ländern eine Ausbildung in landwirtschaftlichen Berufen oder Gastronomieberufen, die zu den männlich dominierten Berufen gehören. In den gewerblich-technischen Berufen ist der Frauenanteil im Osten jedoch etwa so niedrig wie im Westen (Berufsbildungsbericht 2001). (9)
Unterschiede bestehen nach Ost und West bei den weiblich dominierten Berufen: Der Anteil junger Frauen in frauentypischen Ausbildungsberufen liegt im Osten mit 36 % unter dem junger Frauen im Westen mit 44 %, da der Dienstleistungs- und Bürobereich in den neuen Ländern noch nicht den Umfang wie in den alten Bundesländern erreicht hat. Dies spiegelt sich auch darin, dass im Osten nur rund jeder zwanzigste (weibliche bzw. männliche) Auszubildende im Bereich der freien Berufe ausgebildet wird, im Westen aber jede(r) Zehnte.
Die geschlechtsspezifische Segmentierung des Ausbildungsmarktes wird auch in der hohen Konzentration auf wenige Ausbildungsberufe deutlich: 54 % der jungen Frauen werden in nur 10 Berufen ausgebildet, bei den jungen Männern sind es nur 36 %, die sich auf 10 Berufe konzentrieren.
Junge Frauen werden am häufigsten zur Bürokauffrau ausgebildet, gefolgt von den Ausbildungsberufen Kauffrau im Einzelhandel und Arzthelferin. Im Vergleich zum Westen hat im Osten die Ausbildung als Arzt- oder Zahnarzthelferin eine untergeordnete Bedeutung. Stärker vertreten als in den alten Bundesländern sind hier hingegen weibliche Auszubildende in den Berufen Einzelhandelskauffrau und Verkäuferin, aber auch als Restaurant- oder Hotelfachfrau.
|
Weibliche Auszubildende West |
Weibliche Auszubildende Ost |
Ausländ. Auszubildende *) |
Weibliche Auszubildende alle |
|
| Bürokauffrau | 7,6 |
9,7 |
- |
8,0 |
| Arzthelferin | 7,7 |
/ |
12,1 |
6,7 |
| Zahnarzthelferin | 5,9 |
/ |
8,3 |
5,3 |
| Kauffrau im Einzelhandel | 6,5 |
8,7 |
15,5 |
6,9 |
| Friseurin | 6,2 |
5,7 |
14,9 |
6,1 |
| Industriekauffrau | 5,6 |
/ |
- |
5,0 |
| Fachverkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk | 4,6 |
4,1 |
- |
4,5 |
| Bankkauffrau | 4,2 |
/ |
- |
3,8 |
| Kauffrau Bürokommunikation | 3,7 |
4,3 |
- |
3,8 |
| Rechtsanwalts- (Notar-)fachangestellte | 4,1 |
2,9 |
3,9 |
|
| Verkäuferin | / |
5,3 |
/ |
|
| Restaurantfachfrau | / |
4,2 |
/ |
|
| Hotelfachfrau | 3,5 |
|||
| Köchin | / |
3,9 |
- |
/ |
| Die 4 am stärksten besetzten Berufe zusammen | 27,7 |
28,2 |
50,8 |
26,9 |
| Die 10 am stärksten besetzten Berufe zusammen | 56,1 |
52,3 |
- |
54,0 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 3 2000; Berechnungen des BIBB.
*) Da bei ausländischen Jugendlichen keine Differenzierung nach Geschlecht möglich ist, sind die 4 am stärksten besetzten Berufe, bei denen von einer starken weiblichen Dominanz ausgegangen wird, ausgewiesen.
Das weibliche Ausbildungsmarktsegment erfährt bei Frauen ausländischer Herkunft eine weitere, zusätzliche Segmentierung und Verengung auf noch weniger Berufe
Die Berufe, in die junge Frauen ausländischer Herkunft überproportional einmünden, sind in der Regel gekennzeichnet durch vergleichsweise ungünstige Arbeitszeiten bzw. Arbeitsbedingungen, geringere Verdienstmöglichkeiten, geringere Aufstiegschancen und oftmals geringere Übernahmechancen und damit ein höheres Arbeitsplatzrisiko.
Betriebe rekrutieren junge Frauen aus Migrantenfamilien verstärkt bei einem Mangel an anderen Bewerberinnen oder bei einem betrieblichen Eigeninteresse an der Ausbildung einer Fachkraft mit bilingualer bzw. interkultureller Kompetenz.
Die Konzentration auf wenige Ausbildungsberufe ist bei jungen Frauen ausländischer Herkunft erheblich höher als bei der inländischen Vergleichsgruppe: 51 % der jungen Frauen ausländischer Herkunft münden in nur vier Ausbildungsberufe. Dagegen sind es nur 28 % bei jungen westdeutschen Frauen.
Bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz konkurrieren junge Frauen ausländischer Herkunft auf einem engen Ausbildungsmarktsegment mit deutschen Schulabgängerinnen, die häufiger über weiterführende Schulabschlüsse verfügen. Mädchen ausländischer Herkunft erhalten deshalb eher eine berufliche Qualifizierung in Berufen und Wirtschaftsbereichen, an denen Schulabgängerinnen deutscher Nationalität weniger interessiert sind. So münden im Jahr 2000 15 % der ausländischen weiblichen Auszubildenden in eine Ausbildung als Friseurin, 12 % in eine als Arzthelferin und weitere 8 % in eine als Zahnarzthelferin. Daneben hat die Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau zunehmend Bedeutung. Auch 2000 hat jede siebte junge Frau, die eine Ausbildung als Friseurin erhält, einen ausländischen Pass (15 %).
Auch in den neuen Medien- und Serviceberufen haben sie einen bedeutenden Anteil. Ihre Teilhabe in den neuen IT-Berufen hingegen liegt weit darunter.
Während sich junge deutsche Frauen in einer Ausbildung im Bereich der neuen Medien- und Serviceberufe mit 53 % bzw. 51 % vergleichsweise gut behaupten können, ist der Anteil derjenigen, die in den IT-Berufen ausgebildet werden mit 14 % vergleichsweise gering. Dabei bilden gerade die vier IT-Berufe mit rund 40.000 Ausbildungsplätzen die größte Gruppe (vgl. auch Werner 2000). Etwas höher liegt ihr Anteil im Osten mit 18 % aller Auszubildenden (West 14 %). Verschwindend gering ist demgegenüber der Anteil Jugendlicher ausländischer Herkunft: Mit 3 % sind sie in den neuen Berufen kaum vertreten, der Anteil junger Frauen ausländischer Herkunft dürfte hier erwartungsgemäß noch niedriger liegen. (10)
|
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 3; Berechnungen des BIBB.
Ihnen ist es bislang nicht gelungen, eine ihrem Bevölkerungsanteil entsprechende Teilhabe an den "klassischen" Berufen des Dienstleistungssektors wie beispielsweise in den kaufmännischen Berufen zu erhalten. Noch viel geringer sind ihre Chancen bei den neuen Informations- und Kommunikationsberufen.
Besonders klein sind die Ausbildungschancen junger Frauen ausländischer Herkunft in bestimmten kaufmännischen Berufen, wie z. B. der Bank- oder Versicherungskauffrau. Gleichfalls unzureichend ist ihr Zugang zum öffentlichen Dienst: Von allen Auszubildenden im öffentlichen Dienst hat nur jede bzw. jeder 30. Auszubildende einen ausländischen Pass.
Jugendliche ausländischer Herkunft haben mit 6 % in den neuen Serviceberufen und mit je 3 % in den Medien- und IT-Berufen kaum Chancen. Noch niedriger dürfte der Anteil junger Frauen ausländischer Herkunft in diesen Berufen sein (vgl. Fußnote 11).
Aus allen vorliegenden Untersuchungen wird deutlich: Berufswahl ist eine komplexe und lang andauernde Entwicklung. Berufsorientierung beginnt bereits in der Kindheit, erstreckt sich über die Schulzeit hinweg und umfasst die Phasen des Übergangs an der ersten und zweiten Schwelle. Die Notwendigkeit richtungsweisender Bildungsentscheidungen ist mit der Berufswahl an der ersten Schwelle jedoch bei weitem nicht abgeschlossen.
Angesichts der wachsenden Wichtigkeit lebenslangen Lernens für die eigene berufliche Entwicklung, gewinnt berufliche Weiterbildung immens an Bedeutung und damit auch die Notwendigkeit von Berufswege- und Bildungsentscheidungen nach Beendigung der beruflichen Erstausbildung. Somit werden "Berufswahlkompetenzen", die die Entscheidungsfindung vorbereiten, zunehmend zu Fähigkeiten, die den Berufsweg wie das lebenslange Lernen des Einzelnen dauerhaft begleiten.
Dies gilt insbesondere für junge Frauen, da sie zum einen teilweise nicht in Ausbildungsberufe ihrer ersten Wahl einmünden, zum anderen häufig in Berufen ausgebildet werden, die als "Zuverdienerberufe" gelten. Für die Zeit nach Abschluss der beruflichen Erstausbildung sind sie daher in besonderer Weise von Prozessen der beruflichen Weiterentwicklung und Umorientierung betroffen. Dies macht die Betrachtung von Berufswahl als langfristigen Prozess, der mehrere Lebensphasen umspannt, gerade bei (jungen) Frauen besonders notwendig.
Aufgrund der demografischen Entwicklung ist schon heute absehbar, dass Auszubildende und junge Fachkräfte in wenigen Jahren in Ostdeutschland und spätestens in zehn Jahren auch in Westdeutschland Mangelware sein werden (Brosi u. a. 2001). Angesichts dieser demografischen Veränderungen gilt es bereits heute, das vorhandene Qualifizierungs- und Arbeitskräftepotenzial auszuschöpfen: (Junge) Frauen bilden eine erhebliche, schulisch gut vorgebildete Ressource, deren Kompetenzen und Profile es auch für gewerblich-technische Berufe bzw. für Berufe der Informationstechnologie auszuschöpfen gilt.
Für Betriebe, die bereits jetzt in manchen Regionen - wie Bayern und Baden-Württemberg - einen Facharbeitermangel beklagen, sind junge Frauen ein Nachwuchspotenzial, das es zu fördern gilt. Die attraktive Gestaltung von Ausbildungsplätzen und die stärkere Gewinnung von Schulabgängerinnen auch in technikorientierten Berufen stellen hier eine bildungspolitische Herausforderung aller beteiligten Akteure dar.
Einstellungstests und Auswahlverfahren von Betrieben in gewerblich-technischen wie bei IT-Berufen sind vielfach noch von geschlechtsspezifischen Mustern geprägt (Dietzen/ Westhoff 2001). Demnach werden Bewerberinnen eher in kaufmännisch orientierten Berufen bevorzugt, männliche Bewerber in technisch orientierten Berufen. Darauf weisen beispielsweise auch die Ausbildungsquoten junger Frauen in den vier IT-Berufen hin (vgl. Punkt 4.8).
Wollen Betriebe das Potenzial und die Kompetenzen junger Frauen stärker in technisch orientierten Berufen nutzen, so sind Einstellungstests wie betriebliche Auswahlverfahren darauf hin zu überprüfen, inwieweit sie noch implizit oder explizit Elemente enthalten, die eine geschlechtsspezifische Auswahl bedingen. Eine geschlechtssensible Überarbeitung von Einstellungstests und betrieblichen Auswahlverfahren kann einen Beitrag dazu leisten, den Anteil junger Frauen in technischen Berufen zu erhöhen (Puhlmann 2001).
Die Stärkung von (jungen) Frauen in technisch orientierten Berufen sollte in Betrieben nicht als einzelne Fördermaßnahme dastehen, sondern in eine allgemeine Unternehmensstrategie der Personalförderung eingebunden sein (vgl. Westhoff/ Dietzen 2001).
Schulische und außerschulische Berufsorientierung können in stärkerem Maße als bisher junge Frauen und ihre individuellen Vorstellungen von Lebens- und Berufsplanung unterstützen, d. h. sie dabei unterstützen eine Gesamtbiografie zu entwerfen, eigene Lebensentwürfe zu entwickeln, und sie konsequent zu verfolgen. Vorrangig ist es, die Stärken junger Frauen herauszuarbeiten und bewusst zu machen, um ihr Selbstbewusstsein zu fördern. Dieses gilt es unter Einbeziehung ihrer individuellen sowie - bei jungen Frauen mit Migrationshintergrund - ihrer migrationsspezifischen biografischen Erfahrungen zu erreichen. Anders ausgedrückt: Es geht um die Förderung ihrer Wahrnehmung und die Verarbeitung ihrer biografischen Erfahrungen im Prozess von Berufswahl und Lebensplanung (vgl. auch Lemmermöhle u. a. 1997).
Am Potenzial junger Frauen ansetzen bedeutet für die Ausbildung selbst, dass sich Lernprozesse in der Ausbildung stärker an den Herangehensweisen junger Frauen orientieren. Gerade in technisch orientierten Berufen sollten Ausbildungskonzepte stärker an den (Lern-) Voraussetzungen und dem individuellen Umgang junger Frauen mit Technik ansetzen. Hierfür ist auch das Ausbildungspersonal entsprechend zu schulen und einzusetzen (s. u.).
Um das Potenzial junger Frauen in einer langfristig angelegten Bildungslaufbahnberatung (s. u.) nutzen zu können und ihre Kompetenzen für weitere Berufsentscheidungen im Sinne eines lebenslangen Lernens zu fördern, ist es wichtig, frühzeitig in der Schule bei Schülerinnen (und Schülern) im Rahmen des Fachs Arbeitslehre "Berufswahlkompetenzen" zu fördern, d. h. die Fähigkeiten zur Selbsteinschätzung, zur Entscheidungsfindung und zur Berufsplanung zu entwickeln (vgl. OECD 2002). (11)
Innovative Ansätze, die eine solche vorberufliche Handlungskompetenz fördern, werden zur Zeit z. B. im Rahmen des Programms "Schule - Wirtschaft/ Arbeitsleben" [10] erprobt (vgl. BA/ BMBF 2002). Eine breitere Umsetzung innovativer Konzepte und Ansätze, die frühzeitig die Berufswahlkompetenzen von Schülerinnen (und Schülern) aber auch von Schulabgängerinnen (und Schulabgängern) stärken, ist wünschenswert im Anschluss an ihre Erprobung und Evaluierung.
Notwendig ist eine langfristig angelegte Bildungslaufbahnberatung ergänzend zur bisherigen Berufsberatung, die sich an schulischer und beruflicher Bildung orientiert und eine Beratung von Mädchen ausgehend von ihren individuellen Bildungsvoraussetzungen und den von ihnen gewünschten Bildungszielen ermöglicht.
Es hat sich z. B. bei Mädchen türkischer Nationalität gezeigt, dass sie insbesondere dann erfolgreich bei der Realisierung ihrer Berufspläne waren, wenn im angestrebten Beruf ihre schulischen Voraussetzungen und die Eingangsvoraussetzungen der Betriebe für den Ausbildungsberuf übereinstimmten. Lag eine (zu) große Diskrepanz zwischen den individuellen Voraussetzungen und den Leistungsanforderungen bzw. den (formalen) Einstellungskriterien der Betriebe vor, führte dies eher zu Misserfolg (Stanger 1994).
Nur eine langfristig angelegte Bildungslaufbahnberatung kann Möglichkeiten aufzeigen, um weiterführende Schul- und Bildungsabschlüsse zu erwerben, um doch den angestrebten "Traumberuf" zu erreichen oder die hinter dem "Traumberuf" stehenden Ansprüche reflektieren zu helfen. Erst in dieser Auseinandersetzung und Reflexion erhalten Mädchen die Chance, ihre mit dem Zielberuf verbundenen Vorstellungen sowie die Realisierbarkeit ihres Wunsches zu überprüfen. Dies aber ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine (mögliche) tragfähige berufliche Umorientierung.
Angesichts bestehender geschlechtsspezifischer Barrieren ist es im Rahmen einer Bildungslaufbahnberatung auch notwendig, Schülerinnen und Schulabgängerinnen Informationen und Gelegenheiten zu bieten, die ein breiteres Berufswahlspektrum fördern.
Das kann auch bedeuten, "Gegenangebote" zu vorherrschenden Orientierungen zu vermitteln: die Möglichkeit von Berufen im technischen Bereich und damit verknüpft anderer Berufswege, muss für junge Frauen stärker erfahrbar werden, etwa durch Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern dieser Branchen, durch Workshops oder durch Praktika.
So meinen beispielsweise zwei von drei Betrieben in der IT-Branche, dass ein Mehr an technikorientierten Betriebspraktika eine Möglichkeit darstellt, um junge Frauen für eine Ausbildung in einem IT-Beruf zu gewinnen (Dietzen/ Westhoff 2001; s. u.). Im Rahmen des Programms "Schule - Wirtschaft/ Arbeitsleben" [10] sind solche betreuten Betriebspraktika für Schülerinnen - und Schüler - vorgesehen, insbesondere im Bereich naturwissenschaftlich-technischer Berufe (BA/ BMBF 2002).
Orientierungsprojekte bieten im Rahmen einer langfristig angelegten Bildungslaufbahnberatung die Möglichkeit einer zeitlich kompakten und komprimierten Berufsinformation und Berufsorientierung und können junge Frauen bei ihrer Berufswahl unterstützen.
Im Rahmen eines solchen kompakten Seminars können junge Frauen die eigenen Interessen, Fähigkeiten und Potenziale ausloten. Dabei besteht die Chance, sich über Fragen der Berufswahl mit anderen Jugendlichen auf Lehrstellensuche bzw. mit Auszubildenden auszutauschen. Zudem kann im Rahmen von Orientierungsprojekten das Potenzial junger Frauen herausgearbeitet und ihre Berufswahlkompetenzen gestärkt werden.
Eine aktuelle OECD-Studie zur Bildungssituation in Deutschland stellt eine unterdurchschnittliche Ausstattung mit Computern an deutschen Schulen (12) und eine (große) Unsicherheit von Schülern in Deutschland im Umgang mit PCs fest. (13) Dabei tun sich Schülerinnen im Umgang mit dem PC besonders schwer. (14)
Auch wenn zu berücksichtigen ist, dass Mädchen bzw. junge Frauen in der Einschätzung ihrer naturwissenschaftlichen bzw. technischen Fähigkeiten und Kompetenzen vorsichtiger bzw. ehrlicher sind als Jungen, bleibt die Tatsache bestehen, dass neben dem sehr deutlichen Unterschied zwischen Schülerinnen und Schülern in der Einschätzung der Sicherheit im Umgang mit dem PC auch erhebliche Unterschiede zwischen Schülerinnen in Deutschland und anderen OECD-Staaten bestehen. So haben in einigen OECD-Ländern Mädchen eine deutlich bessere Einschätzung ihrer Sicherheit im Umgang mit dem PC als in Deutschland (vgl. BA/ BMBF 2002).
Neben der technischen Ausstattung an Schulen mit Computern ist auch der Umgang von Schülerinnen mit PCs erheblich zu verbessern und diese Kompetenzen für die Phase der Berufsorientierung und Berufswahl nutzbar zu machen. Der sichere Umgang mit dem Computer als Informations- und Kommunikationsmittel kann sich in der Berufsorientierung und Berufswahl als unterstützend herausstellen: Zwar sollte dies nicht überbewertet werden - denn allein mit Hilfe von Computerkenntnissen ist die Berufswahl nur schwerlich zu meistern - jedoch auch nicht unterschätzt werden. Denn die große Unsicherheit, die nach der OECD-Studie vor allem bei Schülerinnen in Deutschland im Umgang mit Computern besteht, kann ein Handicap in der Phase der Berufsorientierung und Berufswahl bedeuten. Von Vorteil könnten sich daher integrierte Ansätze erweisen, die in der Schule ansetzen und die Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen und Fähigkeiten im Umgang mit den elektronischen Informations- und Kommunikationsmitteln mit Fragen der Berufsorientierung und Berufswahl verbinden. Langfristig angelegten Konzepten ist hierbei der Vorzug zu geben.
Die Zufriedenheit junger Frauen und Männer mit ihrer Ausbildung in einem IT-Beruf ist ähnlich hoch - obwohl nur die Hälfte der weiblichen Auszubildenden im IT-Bereich im Wunschberuf ausgebildet wird (Dietzen/ Westhoff 2001). Das ist ein Hinweis darauf, dass das Engagement junger Frauen in Ausbildung nicht gering sein kann - im Gegenteil.
Um eine Entwicklung der IT-Branche zu einem männlich dominierten Ausbildungsbereich zu verhindern und die dauerhafte Öffnung auch der technikorientierten IT-Berufe für Frauen zu erreichen bzw. zu sichern, sollte die Förderung junger Frauen in den technikorientierten IT-Berufen vorrangig zwei Hauptzielrichtungen verfolgen: Erstens den Zugang der Bewerberinnen zu einer IT-Ausbildung unterstützen - und im Vorfeld die Betriebe hierfür zu gewinnen - und zweitens das Interesse von Schülerinnen und Schulabgängerinnen an einer solchen Ausbildung erhöhen bzw. stärken.
Aus Sicht der in einer BIBB-Studie befragten Betriebe finden folgende Möglichkeiten eine breite Zustimmung, um junge Frauen für eine Ausbildung in einem IT-Beruf zu gewinnen: die Durchführung von mehr technikorientierten Betriebspraktika (64 %) sowie die Kontakte zu jungen Frauen in Schule und Berufsberatung (61 %). Andere Möglichkeiten werden hingegen sehr viel seltener genannt (Dietzen/ Westhoff 2001).
Dies lässt darauf schließen, dass Betriebe davon ausgehen, dass die geringe Ausbildungsbeteiligung von jungen Frauen in IT-Berufen vorrangig auf die Phase der Berufswahl/ Berufsorientierung bzw. das mangelnde Interesse junger Frauen an technischen Berufen zurückzuführen ist (Dietzen/ Westhoff 2001). Dass dies jedoch nicht die einzige Ursache für die niedrige Ausbildungsquote junger Frauen in IT-Berufen sein kann, zeigt sich an der hohen Quote von Bewerberinnen im Vergleich zu den Einstellungen in Ausbildung: In den technikorientierten IT-Berufen bewerben sich doppelt so viel junge Frauen auf eine Ausbildungsstelle wie eingestellt werden (Dietzen/ Westhoff 2001).
Ein anderer Grund, den wiederum die Betriebe sehr verhalten nennen, sind - wie bereits dargestellt - wenig geschlechtssensible Einstellungstests und Auswahlverfahren. Nur 8 % der befragten Unternehmen gehen davon aus, dass verbesserte Eignungstests und Auswahlverfahren dazu beitragen können, junge Frauen für IT-Berufe zu gewinnen (Dietzen/ Westhoff 2001). Die Sensibilisierung von Betrieben für geschlechtssensible Einstellungstests und Auswahlverfahren ist daher ein wichtiger und unerlässlicher Schritt, um Betriebe für eine stärkere Ausbildung junger Frauen in technikorientierten Berufen und namentlich in IT-Berufen zu gewinnen.
Das Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern in der Teilhabe am dualen System spiegelt sich auch bei den Ausbildenden wider. So beträgt der Anteil der Ausbilderinnen in der Ausbildung nur rund ein Viertel. Sollen mehr junge Frauen für eine Ausbildung in technikorientierten Berufen gewonnen werden, so ist eine stärkere Einbeziehung von Frauen als Ausbilderinnen notwendig (Puhlmann 2001). Neben ihrer Vorbildfunktion für junge Frauen in Ausbildung können sie als Ausbildungs(mit)verantwortliche auch bei der Auswahl der Auszubildenden sowie bei der Gestaltung von Lernprozessen im Sinne einer stärkeren Beteiligung junger Frauen mitwirken.
Dem entgegen glauben nur 11 % der Betriebe, dass ein Mehr an Ausbilderinnen dazu beitragen kann, junge Frauen stärker für IT-Berufe zu gewinnen (Dietzen/ Westhoff 2001). Dies weist darauf hin, dass in dieser Hinsicht Überzeugungsarbeit und Anstrengungen bei Betrieben nicht nur von Seiten der Wirtschaftsverbände erforderlich sind.
Zudem ist das Ausbildungspersonal gerade in technisch orientierten Berufen stärker für die Belange weiblicher Auszubildender wie z. B. für ihre individuellen Lernvoraussetzungen und Lernstrategien zu sensibilisieren und zu schulen, um die Fähigkeiten von Frauen auch im technischen Bereich besser auszuschöpfen.
Außerbetriebliche Ausbildungen müssen einer doppelten Anforderung entsprechen: eine dem bestehenden Arbeitsmarkt zeitgemäße Ausbildung vermitteln und die betreffenden Zielgruppen entsprechend ihrem Bedarf im Rahmen einer sozialpädagogischen Betreuung fördern. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass gerade junge Frauen, insbesondere aus den neuen Bundesländern, meist nicht zu den "klassischen" Zielgruppen sozialer Arbeit gehören, sondern mehrheitlich zur Zielgruppe der so genannten "Marktbenachteiligten". Meist besteht hier das wirkliche Problem darin, dass in einer Region nicht genügend betriebliche Ausbildungsplätze existieren oder junge Frauen in der Vergabe benachteiligt sind.
Insofern müssen außerbetriebliche Ausbildungen konkreter auf verschiedene Zielgruppen abgestimmt werden, auf Personen, die sozialpädagogischer Betreuung bedürfen sowie auf die Belange von Personen, die lediglich in einer gegebenen Ausbildungs- und Arbeitsmarktlage aufgrund bestehender Vergabepraktiken oder Standortbedingungen benachteiligt sind. Für alle Zielgruppen gilt es, passende Angebote zu schaffen. Dabei ist zu vermeiden, dass Angebote von neuem benachteiligend wirken, indem sie als zweitklassige Berufsausbildung gelten und mit Stigmatisierungen verbunden sind (vgl. Ulrich 2001).
Zudem gilt es für alle Zielgruppen, das Spektrum der Ausbildungsberufe, die im Rahmen der außerbetrieblichen Ausbildung für junge Frauen zur Verfügung stehen, deutlich auszuweiten. Vorliegende Analysen zeigen, dass im Rahmen der Benachteiligtenförderung junge Frauen im Kern nur in 12-15 Berufen ausgebildet werden (vgl. Kollatz 2001).
Die Öffnung der außerbetrieblichen Ausbildung für Ausbildungsberufe in anderen Berufsfeldern, die Sicherung der Qualität außerbetrieblicher Ausbildung sowie die Erhöhung der Chancen von Auszubildenden aus außerbetrieblicher Ausbildung an der zweiten Schwelle erfordern auch eine erheblich stärkere Verzahnung von betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung als bisher. Unterschiedliche Modelle der Verknüpfung von betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung, die bereits erprobt sind, sollten deutlich häufiger - den Bedarfslagen der unterschiedlichen Zielgruppen entsprechend - umgesetzt werden: sei es, dass die fachpraktische Ausbildung in einem Stufenmodell sukzessive in den Betrieb verlagert wird, sei es, dass sie von Anfang an im Betrieb erfolgt. (15)
Insbesondere diese zweite Form der Verknüpfung außerbetrieblicher mit betrieblicher Ausbildung erlaubt es, die Palette der Ausbildungsberufe auszuweiten. Sie ist vornehmlich für diejenigen jungen Frauen mit weiterführenden Bildungsabschlüssen geeignet, die aufgrund der Ausbildungsmarktlage keine Ausbildungsstelle gefunden haben. Hingegen bietet das Stufenmodell den Vorteil, dass sich gerade Schulabgängerinnen mit weniger günstigen schulischen Voraussetzungen bzw. mit Lernschwierigkeiten in den Lehrwerkstätten des Bildungsträgers allmählich an die Anforderungen einer Ausbildung gewöhnen können. (16)
Die vorliegenden Analysen zeigen, dass 43 % der jungen Frauen ausländischer Nationalität im Alter von 20-30 Jahren ohne einen anerkannten Berufsabschluss bleiben - häufiger als die männliche Vergleichsgruppe und viermal so oft wie junge deutsche Frauen, obgleich Schulabgängerinnen mit ausländischem Pass häufiger als die männliche Vergleichsgruppe einen (weiterführenden) Schulabschluss erreichen. Ein Mangel an ausbildungsinteressierten jungen Frauen mit Migrationshintergrund kann aufgrund der vorliegenden Untersuchungen nicht festgestellt werden. Wesentlich schwieriger ist es, Betriebe zu finden, die bereit sind, (weibliche) Jugendliche aus Migrantenfamilien auszubilden - aus unterschiedlichen Gründen (vgl. Granato 2002).
Angesichts des stagnierenden Zugangs junger Frauen ausländischer Nationalität zu einer Berufsausbildung sowie der katastrophalen Lage junger Frauen ohne Berufsabschluss aus Migrantenfamilien, ist es eine vorrangige bildungspolitische Aufgabe allen jungen Frauen mit Migrationshintergrund einen qualifizierten Berufsabschluss zu ermöglichen.
Das Integrationsangebot für dieses knappe Drittel der jungen Frauen in Deutschland - der heutigen Generation von Schülerinnen und Schulabgängerinnen mit Migrationshintergrund - muss erheblich verbessert werden, wenn sie eine faire Chance auf eine berufliche Qualifikation und damit auf eine berufliche Integration erhalten sollen.
So wird die programmatische Forderung "Ausbildung für alle" zwar von allen gesellschaftlichen Gruppen mitgetragen. Wesentlich sind dabei allerdings die Anstrengungen der Sozialpartner und der Bundesregierung im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit mit dem Ziel allen ausbildungswilligen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz anzubieten. Die Aktivitäten zur Verbesserung der Ausbildungschancen von jungen Migrantinnen und Migranten bilden hierbei einen Schwerpunkt. Im neuen Programm "Kompetenzen fördern" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung [16] hat die Bundesregierung deswegen auch diesen Akzent gesetzt: Ein eigener Innovationsbereich zielt auf die Verbesserung der beruflichen Qualifizierung junger Migrantinnen und Migranten. (17)
Die Heterogenität der Lebenslagen junger Frauen (und Männer) mit Migrationshintergrund und ihre je unterschiedlichen Lernvoraussetzungen verlangen mehrdimensionale Ansätze und Maßnahmen. Zielgruppenspezifische und differenzierte Maßnahmen müssen insbesondere in folgenden Bereichen vorgesehen bzw. umgesetzt werden (vgl. Alt/ Granato 2001):
Dies sind auch zentrale Arbeitsschwerpunkte der "Initiativstelle Berufliche Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten" (IBQM) [25], die für die Umsetzung des Programms "Kompetenzen fördern" in diesem Bereich (Innovationsbereich IV) im Bundesinstitut für Berufsbildung [18] eingerichtet wurde (vgl. Granato/ Schapfel-Kaiser 2002 sowie IBQM (Hrsg.) 2002).
1) Die Erhebung "Soziale Lage, Lebensstil und Orientierungen junger Frauen zwischen Schule und Beruf in interkulturell vergleichender Forschungsperspektive" beruht auf Gruppendiskussionen und Einzelinterviews und wurde 1998-1999 am Institut für Schulpädagogik und Bildungssoziologie der Freien Universität Berlin durchgeführt. Auf der Grundlage von Fallstudien wird untersucht, in welcher Weise junge Frauen im Kontext ihrer milieuspezifischen Lebensverhältnisse mit Konflikten und Risiken im Verlauf der Einmündung in Ausbildung und Beruf umgehen. Berlin als eine eher strukturschwache Region eignet sich dabei in besonderer Weise, um exemplarisch die speziellen Bedingungen junger Frauen in städtischen Ballungszentren aufzuzeigen. Ausführlicher zu Ergebnissen und Methodik der qualitativen Untersuchung vgl. Schittenhelm 2001, 2000.
2) Sie erfahren dadurch zwar mit Gleichaltrigen ihres Umfelds eine gemeinsame Sozialisation, jedoch verläuft diese in Richtung eingeschränkter beruflicher Chancen. Dies kann mit Ostendorf (1986) als eine gemeinsame Selbstsozialisation in eingeschränkte soziale Chancen bezeichnet werden.
3) Diese Ergebnisse beruhen auf einer Panel-Untersuchung von Auszubildenden in Ost und West. Das Forschungsprojekt "Jugend und Berufsbildung in Deutschland" wurde im Bundesinstitut für Berufsbildung [18] durchgeführt. Jugendliche ausländischer Herkunft sind in dieser Untersuchung nicht explizit ausgewiesen. Zu den Ergebnissen, vgl. Granato 2000a, b, zu methodischen Fragen der Befragung vgl. Granato, Hecker 2000.
4) Für weitere wissenschaftliche Ergebnisse zur Vereinbarkeitsfrage, zur Gestaltung beruflicher und familiärer Lebensformen wie zu Chancen junger Frauen und Männer in Ausbildung und Beruf vgl. die Auswertung vorhandener Umfragen durch Cornelißen u. a. 2002.
5) Diese und das folgende Zitat sind den Gruppendiskussionen mit Jugendlichen in Ost und West entnommen (vgl. SINUS 1996).
6) Anteil der jungen Erwachsenen ohne anerkannten Berufsabschluss in der Altersgruppe der jungen Erwachsenen von 20 bis 29 Jahren im Bundesgebiet West und Berlin (West), vgl. hierzu www.bibb.de/reader/fram_fo1.htm [26]
7) Bei den Arbeitsämtern gemeldete Bewerber für Berufsausbildungsstellen Oktober 2001 bis September 2002: Weibliche Bewerber nach Schulabschluss 4,2 % ohne Hauptschulabschluss, 28,3 % mit Hauptschulabschluss, 52,1 % mittlerer Abschluss, 14,2 % (Fach-)Hochschulreife. Männliche Bewerber nach Schulabschluss 8,3 % ohne Hauptschulabschluss, 36,9 % mit Hauptschulabschluss, 45,7 % mittlerer Abschluss, 8,0 % (Fach-) Hochschulreife.
8) Der Anteil junger Frauen in einer Ausbildung zur Tischler/ -in ist zwischen 1990 und 2000 von 10,2 % auf 7 % zurückgegangen.
9) Aussagen zu dem Anteil junger Frauen ausländischer Nationalität in weiblich bzw. männlich dominierten Berufen sind nicht möglich, da die Statistik den Anteil ausländischer junger Frauen und Männer an den einzelnen Ausbildungsberufen nicht ausweist.
10) Aussagen zum Anteil junger Frauen ausländischer Nationalität in den IT-Berufen bzw. in den anderen neuen Berufen sind aufgrund der eingeschränkten statistischen Datenlage nicht möglich.
11) Für differenziertere Vorschläge zur Förderung von Berufswahlkompetenzen vgl. u. a. OECD 2002.
12) An Schulen in Deutschland kommt rund ein Computer auf 22 Schüler, im OECD-Durchschnitt steht ein PC 13 Schülern zur Verfügung (vgl. BMBF 2002).
13) Deutsche Schüler fühlen sich im Vergleich zu Schülern aus anderen OECD-Ländern unsicherer im Umgang mit dem PC. Sie liegen in ihrer Selbsteinschätzung unter dem OECD-Durchschnitt von 0,0 (vgl. BMBF 2002).
14) Die Selbsteinschätzung der Jungen liegt bei -0,07. Schülerinnen in Deutschland schätzen sich im Umgang mit dem PC besonders unsicher ein. Ihr Wert liegt bei -0,53 (vgl. BMBF 2002).
15) Aus den im Rahmen einer Untersuchung des Bundesinstituts für Berufsbildung [18] durchgeführten explorativen Fallstudien wird deutlich, dass es bei den von den Bildungsträgern praktizierten Ansätzen zur Verzahnung von außerbetrieblicher und betrieblicher Ausbildung zwar eine Vielzahl von Organisationsformen gibt, die sich jedoch auf diese zwei Strukturtypen zurückführen lassen (vgl. Zimmermann 2002).
16) Zu weiteren Vor- wie Nachteilen des jeweiligen Modells vgl. Zimmermann 2002.
17) Im Herbst 2001 startete das Programm: "Kompetenzen fördern - Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf" [27] des Bundesministeriums für Bildung und Forschung [16]. Es hat eine 5-jährige Laufzeit und zielt auf die "Ausbildung für alle" und damit auf die Integration von Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf in die duale Ausbildung. Das Programm setzt die Ziele des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit bezüglich der Benachteiligtenförderung und der Förderung von Migrantinnen und Migranten in vier Innovationsbereichen um (vgl. BMBF (Hrsg.) 2001; Arbeitsgruppe "Aus- und Weiterbildung" im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit 2000)
Alt, Christel; Granato, Mona (2001): Chancengleichheit von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der Beruflichen Ausbildung verwirklichen. In: Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste (ibv), Nr. 41
Arbeitsgruppe "Aus- und Weiterbildung" im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit (2000): Beschluss zur Benachteiligtenförderung vom 27. Mai 1999 und Beschluss zu Migrantinnen und Migranten vom 26.Juni 2000
Arbeitsgruppe "Aus- und Weiterbildung" im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit (2000): Beschluss vom 26. Juni 2000 zur Aus- und Weiterbildung von Migrantinnen und Migranten. In: Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste (ibv), Nr. 35
BA (Bundesanstalt für Arbeit) (2001): Frauen und IT. Zukunftsorientierte Arbeitsmarktpolitik. Chancengleichheit von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt. In: Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste (ibv), Nr. 38
BA/ BMBF (Bundesanstalt für Arbeit/ Bundesministerium für Bildung und Forschung) (2002): Zwischenbericht für das Programm "Schule-Wirtschaft/ Arbeitsleben". In: Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste (ibv), Nr.1
Beer, Dagmar; Dresbach, Bernhard; Granato, Mona; Schweikert, Klaus (1997): An der Schwelle zum Berufsleben: Erfahrungen und Perspektiven von Auszubildenden in Ost- und Westdeutschland. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 25/97
BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) (2000, 2001): Berufsbildungsbericht. Bonn
BMBF (Hrsg.) (2001): Kompetenzen fördern - Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf. Berlin, Bonn
Brosi, Walter; Troltsch, Klaus; Ulrich, Joachim Gerd (2001): Rückblick auf den Ausbildungsstellenmarkt 2000. In: Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Nachfrage Jugendlicher nach Ausbildungsplätzen. Analysen und Prognosen 2000-2015. Forschung spezial 2. Bonn
Cornelißen, Waltraud; Gille, Martina; Knothe, Holger; Meier, Petra; Stürzer, Monika (2002): Die Lebenssituation und die Perspektiven junger Frauen und Männer in Deutschland. Eine sekundärstatistische Auswertung vorhandener Umfragedaten. In: Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Das Forschungsjahr 2001. München
Dietzen, Agnes; Westhoff, Gisela (2001): Qualifikation und Perspektiven junger Frauen in den neuen Berufen der Informations- und Kommunikationstechnologien. In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 30 (2001) 6, S. 26-30
Diezinger, Angelika (1991): Frauen: Arbeit und Individualisierung. Chancen und Risiken. Eine empirische Untersuchung anhand von Fallgeschichten. Opladen
Fischer, Bernd; Schulte, Barbara (2001): Schulabgängerbefragung 2001 - Frauen entscheiden anders - . In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP), Heft 6
Freistaat Thüringen (Hrsg.) (2001): Berufliche Ausbildung in Thüringen. Berufsbildungsbericht 2001. Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur. Erfurt
Geissler, Birgit; Oechsle, Mechthild (1996): Lebensplanung junger Frauen. Zur widersprüchlichen Modernisierung weiblicher Lebensläufe. Weinheim
Granato, Mona (1999): Junge Frauen ausländischer Herkunft - Pluralisierung und Differenzierung ihrer Lebenslagen. Dissertation. Technische Universität Berlin
Granato, Mona (1999a): Berufsorientierung und Berufswahl junger Frauen der zweiten Generation. In: Bildungszentrum der Wirtschaft im Unterwesergebiet (Hrsg.): Berufe mit Zukunft in der Region - Chancengleichheit junger Frauen beim Übergang von der Schule in die Berufsausbildung. Bremen
Granato, Mona (2000a): Stellenwert von Arbeit und Beruf aus der Sicht von Auszubildenden. In: Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Jugendliche in Ausbildung und Beruf. Pressereferat. Veröffentlichungen und Materialien aus dem BIBB. Bonn
Granato, Mona (2000b): Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus der Sicht von Auszubildenden. In: Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Jugendliche in Ausbildung und Beruf. Pressereferat. Veröffentlichungen und Materialien aus dem BIBB. Bonn
Granato, Mona (2000c): Förderung der Teilhabe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Ausbildung und Beruf. In: Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Berufsausbildung Jugendlicher ausländischer Herkunft. Pressereferat. Veröffentlichungen und Materialien aus dem BIBB. Bonn
Granato, Mona (2002): Qualifizierungspotentiale in Deutschland nutzen: Jugendliche mit Migrationshintergrund und berufliche Ausbildung. In: Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Chancengleichheit für Migrantinnen und Migranten durch berufliche Qualifizierung. Pressereferat. Veröffentlichungen und Materialien aus dem BIBB. Bonn. Bestellung über pr@bibb.de [28]
Granato, Mona; Hecker, Ursula (2000): Lehrlinge befragen? Methodische Anmerkungen. In: Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Jugendliche in Ausbildung und Beruf. Pressereferat. Veröffentlichungen und Materialien aus dem BIBB. Bonn
Granato, Mona; Schapfel-Kaiser, Franz (2002): Den Stein ins Rollen bringen... "Initiativstelle Berufliche Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten" im BIBB. In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP), Heft 2
Granato, Mona; Schittenhelm, Karin (2000): Junge Frauen im Übergang zwischen Schule und Beruf: Chancen und Perspektiven. In: Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren, Jugendliche und Stiftung SPI (Hrsg.): Mädchen in sozialen Brennpunkten. Berlin, Bonn
Heinz, Walter R. u. a. (1987): Hauptsache eine Lehrstelle. Jugendliche vor den Hürden des Arbeitsmarkts. Weinheim, Basel
Heinz, Walter R. (1995): Arbeit, Beruf und Lebenslauf. Eine Einführung in die berufliche Sozialisation. Weinheim, München
Heyn Susanne; Schnabel, Kai Uwe; Roeder, Peter Martin (1997): Von der Options- zur Realitätslogik. Stabilität und Wandel berufsbezogener Wertvorstellungen in der Statuspassage Schule-Beruf. In: Meier, Artur u. a. (Hrsg.): Transformation in Ost und West. Jahrbuch Bildung und Arbeit '97. Opladen
Hoose, Daniela; Vorholt, Dagmar (1997): Der Einfluss von Eltern auf das Berufswahlverhalten von Mädchen. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 25/97
IBQM (Initiativstelle Berufliche Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten) (Hrsg.) (2002): occasional papers. Bundesinstitut für Berufsbildung. Bonn
Kollatz, Heidemarie (2001): Förderung von Mädchen und jungen Frauen mit Benachteiligungen durch Berufsausbildung in innovativen Berufsfeldern. In: Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Benachteiligte durch berufliche Qualifizierung fördern!. Ergebnisse, Veröffentlichungen und Materialien aus dem BIBB. Bonn
Krüger, Helga (1993): Die Berufsorientierung weiblicher Jugendlicher - ein Phänomen der achtziger Jahre? In: Bendit, René u. a. (Hrsg.): Jugend und Gesellschaft. Deutsch-Französische Forschungsperspektiven. Baden-Baden
Krüger, Helga (1995): Dominanzen im Geschlechterverhältnis: Zur Institutionalisierung von Lebensläufen. In: Becker-Schmidt, Regina (Hrsg.): Das Geschlechterverhältnis als Gegenstand der Sozialwissenschaften. Frankfurt a.M., New York
Lemmermöhle, Doris; Lührig, Marion (1997): Bedingungen, Methoden und Ziele einer geschlechtsbewussten Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern. In: Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport Berlin (Hrsg.): Evaluation und Perspektiven für die Förderung von Mädchen und Jungen in den Schulen Europas. Tagungsbericht. Berlin
Lemmermöhle, Doris (1998): Geschlechter(un)gleichheiten und Schule. In: Oechsle, Mechthild; Geissler, Birgit (Hrsg.): Die ungleiche Gleichheit. Junge Frauen und der Wandel im Geschlechterverhältnis. Opladen
Lutz, Helma (1999): "Meine Töchter werden es schon schaffen". Immigrantinnen und ihre Töchter in den Niederlanden. In: Apitzsch, Ursula (Hrsg.): Migration und Traditionsbildung. Opladen
OECD (2002): OECD-Gutachten zur Berufsberatung. Deutschland. Länderbericht.
Ostendorf, Helga (1986): Mädchen am Start: Gute Konditionen, aber schlechte Wegstrecke. In: Rudolph, Hedwig u. a. (Hrsg.): Berufsverläufe von Frauen. Lebensentwürfe im Umbruch. München
Puhlmann, Angelika (2001): Zukunftsfaktor Chancengleichheit - Überlegungen zur Verbesserung der Berufsausbildung junger Frauen. In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP), Heft 6
Schittenhelm, Karin (1998): Zwischen Unterstützung und Reglementierung. Mädchen und junge Frauen in Einrichtungen der Jugendberufshilfe. In: Neue Praxis 3
Schittenhelm, Karin (2000): Dissens, Distinktion und Gegenentwürfe in soziokulturellen Milieus junger Frauen. In: Roth, Roland; Rucht, Dieter (Hrsg.): Jugendkultur, Politik und Protest. Opladen
Schittenhelm, Karin (2001): Milieubildung, symbolische Gewalt und soziale Ungleichheit. Statuspassagen junger Frauen aus eingewanderten Herkunftsfamilien. In: Weiß, Anja u. a. (Hrsg.): Klasse und Klassifikation. Die symbolische Dimension sozialer Ungleichheit. Opladen
Schweikert, Klaus (1999): Aus einem Holz? Lehrlinge in Deutschland. Berichte zur beruflichen Bildung. Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.), Bielefeld
Seus, Lydia (1993): Soziale Kontrolle von Arbeitertöchtern. Eine kriminologische Studie über junge Frauen im Berufsbildungssystem. Pfaffenweiler
Seidenspinner, Gerlinde u. a. (1996): Junge Frauen heute - Wie sie leben, was sie anders machen. Opladen
Sinus (1996): Jugend, Berufsausbildung in Deutschland. Gruppendiskussionen mit jungen Erwachsenen in den neuen und alten Bundesländern. Kurzbericht. München
Stanger, Barbara (1994): Leben zwischen zwei Stühlen. Türkische Mädchen in Deutschland - ein anwendungsorientiertes Forschungsprojekt. Förderverband e. V. (Hrsg.), Mannheim
Troltsch, Klaus (1999): Jugendliche ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Struktur und Biografiemerkmale. In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP), Heft 5
Ulrich, Joachim Gerd (2001): Benachteiligung - ein schillernder Begriff? Stigmatisierung im Bereich der außerbetrieblichen Lehrlingsausbildung. In: Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Benachteiligte durch berufliche Qualifizierung fördern! Ergebnisse, Veröffentlichungen und Materialien aus dem BIBB. Bonn
Werner, Rudolf (2000): 30.000 Ausbildungsverträge in neu entwickelten Berufen. In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP), Heft 2
Zimmermann, Hildegard (2002): Verzahnung außerbetrieblicher mit betrieblicher Ausbildung. In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP), Heft 2
Die Zeiten sind vorbei, in denen Migration in Politik und Öffentlichkeit eine gesellschaftliche Randerscheinung darstellte. Der folgende Beitrag handelt von einem Drittel der Kinder, die heute in der Bundesrepublik Deutschland leben und davon, ob wir ihre und unsere Zukunftschancen nutzen oder vertun.
"Langfristig Wohlstand sichern. Humanitär handeln. Miteinander leben." Das sind die Grundprinzipien, auf die sich die Zuwanderungskommission unter Vorsitz der ehemaligen Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth verständigt hat.
Deutlicher als die handelnden Politiker bisher hat die Zuwanderungskommission der Bundesregierung darauf hingewiesen, dass gerade die Anstrengungen in Richtung gesellschaftliche Integration und tatsächliche Einbürgerung von Migranten einen neuen Schub brauchen. Bestätigt wird dies zudem durch die neuesten Ergebnisse der PISA-Studie, die auf erhebliche Schwächen im Schulsystem hinweisen.
Was not tut, ist eine umfassende Qualifizierungsoffensive, die in den Blick nimmt, dass etwa ein Drittel aller Kinder in Westdeutschland und insbesondere in den Ballungsgebieten, Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund sind.
In der Bundesrepublik leben über 7 Millionen Menschen mit ausländischem Pass und über 2 Millionen Spätaussiedler, die zwar die deutsche Staatsangehörigkeit haben, aber gleichfalls Zuwanderer sind. Es gibt darüber hinaus viele hunderttausend Eingebürgerte. Es besteht ein erhebliches Interesse daran, diese und andere Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund sozial und ökonomisch zu integrieren. Das gilt insbesondere auch für die junge Generation.
Um Chancengleichheit zu realisieren, sind Bildung, Ausbildung und Weiterbildung, aber auch gleiche Chancen beim Zugang zum Arbeitsmarkt zentral.
Ein großer Teil der Jugendlichen ausländischer Herkunft - und auf sie bezieht sich überwiegend die nachfolgende Analyse (s. u.) - ist bereits in Deutschland aufgewachsen. Vielfach kennen sie das Heimatland der Eltern bzw. Großeltern aus dem Urlaub, aus Erzählungen oder Medien. Die Mehrheit ist in Deutschland fest verankert und hat einen Platz in der Gesellschaft gefunden: Jugendliche ausländischer Herkunft sind Teil der pluralisierten Lebenswelten von Jugendlichen in Deutschland.
12 % der Kinder in Westdeutschland haben einen ausländischen Pass, über 7 % stammen aus binationalen Ehen. Rechnet man noch die Kinder hinzu, deren Eltern als Aussiedler zwar einen deutschen Pass haben aber gleichfalls zugewandert sind sowie die Kinder, deren Eltern eingebürgert sind und einen Migrationshintergrund haben, so sprechen wir heute von rund einem knappen Drittel der Kinder in Deutschland, die mit mindestens einem Eltern- oder Großelternteil einen Migrationshintergrund besitzen: Ihre Eingliederung in Berufsausbildung, Berufsleben und Gesellschaft ist zumindest für die Ballungsgebiete und die westdeutschen Bundesländer quantitativ und qualitativ eine zentrale gesellschaftspolitische Herausforderung. Qualifizierung und gesellschaftliche Integration gehören zusammen.
Angesichts der zu erwartenden enormen demografischen "Lücke" und der Prognosen zur Entwicklung des Ausbildungsstellenmarktes bzw. des Arbeitskräftebedarfs ist schon heute deutlich: Zuwanderung alleine genügt nicht, um den Arbeitskräftebedarf in den nächsten Jahren zu decken. Deswegen gilt es, das Arbeitskräftepotenzial im Inland stärker als bisher auszuschöpfen und vor allem zu qualifizieren (vgl. ausführlich Bethscheider u. a. 2001).
Sektoral und regional unterschiedlich ist bereits heute ein Rückgang an Bewerbern um Ausbildungsstellen und ein Anteil an unbesetzten Lehrstellen festzustellen.
So bleibt beispielsweise im Handwerk, trotz eines bundesweiten Angebotsrückgangs an Ausbildungsstellen, bereits heute jeder 18. Ausbildungsplatz unbesetzt. Der Bewerbermangel ist seit einiger Zeit insbesondere in Süddeutschland spürbar (Brosi u. a. 2001). Aufgrund der demografischen Entwicklung ist schon jetzt absehbar, dass in wenigen Jahren Auszubildende und junge Fachkräfte in Ostdeutschland Mangelware sein werden. In den westlichen Ländern tritt dies mit wenigen Jahren Zeitverzögerung ein.
Daher ist bereits jetzt das Ausbildungs- und Qualifikationspotenzial von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund stärker als bisher auszuschöpfen, sollen nicht perspektivisch gesehen, soziale Spannungen in Ballungsgebieten zunehmen und gleichzeitig erhebliche wirtschaftliche Einschnitte durch Facharbeitermangel die Folge sein.
Das Potenzial Jugendlicher mit Migrationshintergrund für die berufliche Ausbildung haben auch die Bündnispartner im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit [29], d. h. Bundesregierung, Unternehmerverbände und Gewerkschaften erkannt. In ihrem Beschluss zur "Aus- und Weiterbildung junger Migrantinnen und Migranten" fordern sie die Betriebe auf, das Potenzial von Jugendlichen mit Migrationshintergrund stärker als bisher für eine betriebliche Erstausbildung zu nutzen. Sie betonen, dass das interkulturelle Kapital der Jugendlichen von Betrieben bisher zu wenig erkannt und genutzt wird. Gleichzeitig fordern sie Betriebe auf, ihre bisherige Zurückhaltung gegenüber Jugendlichen mit ausländischem Pass zu revidieren, ihre Vorbehalte aufzugeben und diese verstärkt in der Ausbildung zu berücksichtigen. Es gilt jetzt, die Beschlüsse der Bündnispartner konsequent umzusetzen.
Eine der größten Schwierigkeiten im Vorfeld der Berufsausbildung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund ist es, überhaupt einen Ausbildungsplatz zu bekommen, trotz Interesse der Jugendlichen. Alle Untersuchungen zeigen: Ein Mangel an ausbildungsinteressierten Schulabgängerinnen und Schulabgängern ausländischer Herkunft kann nicht festgestellt werden. Auch der Unterstützung durch die Eltern können sich die Jugendlichen überwiegend gewiss sein.
Wesentlich problematischer ist es nach wie vor, genügend Betriebe zu finden, die bereit sind, Jugendliche ausländischer oder anderer ethnischer Herkunft auszubilden.
Der vorliegende Beitrag analysiert daher die Chancen Jugendlicher ausländischer Herkunft in der Berufsausbildung (1), Hemmnisse und Schwierigkeiten beim Erhalt eines Ausbildungsplatzes (2), Möglichkeiten, den Ausbildungserfolg von Jugendlichen im Verlauf der Ausbildung zu sichern (3) sowie die Qualifikationsentwicklung junger Erwachsener zu fördern (4).
Da zur Bevölkerungsgruppe "Jugendliche mit Migrationshintergrund insgesamt" kaum statistische Angaben bzw. Untersuchungen existieren, konzentriert sich die folgende Analyse auf einen Teil dieser Gruppe, auf Jugendliche ausländischer Nationalität, da hier entsprechendes statistisches Material vorhanden ist. Die Schlussfolgerungen gelten jedoch für alle Jugendlichen mit Migrationshintergrund, auch und gerade für Jugendliche aus Aussiedlerfamilien.
Die Ausbildungschancen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund haben sich in den letzten Jahren nicht verbessert.
Die Chancen junger Menschen aus Migrantenfamilien auf eine berufliche Erstausbildung und damit auch ihre Chancen auf eine berufliche Integration haben sich in den letzten Jahren nicht verbessert - im Gegenteil. Seit einiger Zeit ist der Anteil junger Menschen ausländischer Herkunft in einer beruflichen Ausbildung sogar rückläufig bzw. stagniert.
Liegt der Anteil Jugendlicher ausländischer Herkunft, die in eine berufliche Ausbildung im dualen System einmünden, 1986 noch bei 25 %, so steigt die Ausbildungsquote bis 1994 deutlich auf 44 % an, ist seither jedoch im Sinken begriffen. 1998 erreicht die Ausbildungsquote ausländischer Jugendlicher mit 38 % gerade den Stand von 1991. 1999 ist mit 39 % eine leichte Besserung festzustellen; inwieweit dies eine Trendwende darstellt, bleibt abzuwarten.
Ein Rückgang der Partizipation an beruflicher Ausbildung und damit auch der Chancen auf eine berufliche Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist u. a. zurückzuführen auf ein im Durchschnitt der letzten Jahre rückläufiges betriebliches Ausbildungsangebot, was nicht nur aber in besonderem Maße junge Menschen aus Migrantenfamilien trifft (Granato/ Werner 1999).
Die Chancen von Schulabgängern ausländischer Herkunft auf eine berufliche Ausbildung haben mit den Verbesserungen ihrer Schulabschlüsse im letzten Jahrzehnt nicht Schritt gehalten. Die Chancen Jugendlicher ausländischer Herkunft auf einen betrieblichen Ausbildungsplatz sind nach wie vor wesentlich geringer als bei deutschen Jugendlichen.
Die Chancen von Schulabgängern ausländischer Herkunft an einer beruflichen Ausbildung haben mit den Verbesserungen ihrer Schulabschlüsse nicht Schritt gehalten. So haben 81 % der Schulabgänger ausländischer Nationalität 1999 einen Schulabschluss. Einen Realschulabschluss haben 29 % erreicht, die Hochschulreife 11 %. 41 % schließen die allgemein bildende Schule in Deutschland mit dem Hauptschulabschluss ab. Doch nur 39 % der Jugendlichen erhalten einen Ausbildungsplatz im dualen System. (1)
Obgleich sich die Schulabschlüsse ausländischer Jugendlicher seit Mitte der 80er Jahre kontinuierlich verbessert haben, hat dies kaum eine nachhaltige Auswirkung auf ihre Ausbildungschancen.
Wiewohl sich der Trend zu höheren Schulabschlüssen - seit 1993 zwar verlangsamt - auch weiter fortsetzt, hat sich im letzten Jahrzehnt der Abstand zwischen Schulabschlüssen deutscher und ausländischer Jugendlicher nicht wesentlich verringert, da auch bei deutschen Schulabgängern eine stetige Hinwendung zu höheren Abschlüssen festzustellen ist (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2001, S. 78).
Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz und damit auf eine qualifizierte Berufsausbildung sind für Jugendliche ausländischer Herkunft im Vergleich zu deutschen Jugendlichen wesentlich geringer. Insgesamt erhalten 1999 nur 39 % der Jugendlichen ausländischer Herkunft aber 68 % der jungen Deutschen eine Ausbildung im dualen System.
Trotz besserer Schulabschlüsse sind junge Frauen beim Zugang zum dualen System besonders benachteiligt.
Trotz besserer Schulabschlüsse im Vergleich zur männlichen Vergleichsgruppe und einem hohen Engagement an der ersten Schwelle haben 1999 nur 33 % der jungen Frauen mit ausländischem Pass Zugang zu einer Ausbildung im dualen System - seltener als männliche Jugendliche ausländischer Herkunft (44 %), aber auch wesentlich seltener als junge deutsche Frauen (57 %). (78 % der jungen Männer deutscher Nationalität durchlaufen 1999 eine Ausbildung im dualen System.)
Ungeachtet verbesserter Bildungsabschlüsse hat sich in den letzten Jahren der Anteil junger Frauen ausländischer Nationalität an einer Ausbildung im dualen System kaum erhöht. Liegt ihre Ausbildungsbeteiligung 1986 noch bei 17 %, so steigt sie bis 1994 auf 34 % an und ist seither jedoch leicht im Sinken begriffen. 1998 erreicht die Ausbildungsbeteiligung ausländischer junger Frauen mit 32 % gerade den Stand, der schon 1991/ 92 festzustellen war. Auch hier ist 1999 eine leichte Besserung festzustellen (33 %) (vgl. Granato 2000b).
Große Differenzen bestehen in der Ausbildungsbeteiligung zwischen Jugendlichen ausländischer Herkunft.
Jugendliche ausländischer Herkunft stellen keine homogene Gruppe dar. Im Hinblick auf die Chancen eines Zugangs zu dualer Ausbildung existieren große regionale Unterschiede, aber auch Differenzen nach der Herkunft und dem Migrationshintergrund. Mit statistischen Daten belegbar sind die Unterschiede nach der Nationalität. So liegt die Ausbildungsbeteiligung spanischer Jugendlicher im dualen System mit 79 % höher als bei deutschen Jugendlichen in Westdeutschland (68 %) - dies gilt für Mädchen und Jungen. Während italienische und portugiesische Mädchen und Jungen eine mittlere Position einnehmen, liegt der Anteil Jugendlicher türkischer Nationalität, die sich in einer Berufsausbildung befinden mit 42 % (1998) weiterhin niedriger als bei anderen genannten Nationalitäten.
Das Interesse von Schulabgängern ausländischer Herkunft an einer qualifizierten Berufsausbildung ist nach wie vor hoch.
Die Ausbildungsleistung der Wirtschaftsbereiche für junge Menschen ausländischer Herkunft ist sehr unterschiedlich, teilweise drastisch zu niedrig. Besondere Anstrengungen sind im öffentlichen Dienst zu unternehmen.
Rund 80.000 Schulabgänger ausländischer Herkunft haben sich 1999 allein bei den Arbeitsämtern um eine Ausbildungsstelle beworben. Damit ist der Anteil gegenüber den Vorjahren gleich hoch geblieben. Zu Beginn des Ausbildungsjahres 1999 waren noch über 4.000 ausländische Jugendliche ohne Lehrstelle, das war rund ein Fünftel aller unversorgten Jugendlichen.
Jugendliche ausländischer Nationalität sind in der beruflichen Ausbildung weit unter ihrem Bevölkerungsanteil vertreten. Nur 7 % der Auszubildenden im dualen System haben einen ausländischen Pass, während unter den Jugendlichen im Alter von 15-18 Jahren rund 12 % nichtdeutscher Herkunft sind (Bundesgebiet West).
In allen Ausbildungsbereichen werden Jugendliche ausländischer Herkunft im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil unterdurchschnittlich ausgebildet. Das gilt in Industrie und Handel mit 7 %, aber auch in den Freien Berufe (2000: 9 %) und im Handwerk (8 %), wobei im Handwerk die Quote seit einigen Jahren rückläufig ist (1994: 12 %, 1997: 10 %, 1999: 9 %).
Nach wie vor ist es jedoch der öffentliche Dienst, dessen Ausbildungsleistung am geringsten ist: Gerade 3 % der Auszubildenden haben eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit.
Bereits jetzt sind erhebliche regionale Unterschiede in der Ausbildungsleistung der Wirtschaftsbereiche festzustellen. Diese sind zum Teil die ersten Vorboten der sich bundesweit ankündigenden demografischen Lücke.
So bilden beispielsweise das Handwerk in Baden-Württemberg mit 15 %, in Hessen mit 13 % und in Hamburg mit 12 % bereits heute über dem Bundesdurchschnitt Jugendliche ausländischer Herkunft aus (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2001, S. 78).
Jugendliche ausländischer Herkunft haben am ehesten in den Ausbildungsberufen eine Chance, die für junge Deutsche nicht mehr so attraktiv sind.
Auch heute noch haben Mädchen und Jungen ausländischer Herkunft am ehesten Ausbildungschancen in den Berufen, die für Deutsche weniger attraktiv sind, wie z. B. Berufe im Bauhandwerk, als Friseurin usw.
Diese Berufe sind in der Regel gekennzeichnet durch vergleichsweise ungünstige Arbeitszeiten bzw. Arbeitsbedingungen, geringere Verdienstmöglichkeiten, geringere Aufstiegschancen und oftmals geringere Übernahmechancen und ein höheres Arbeitsplatzrisiko.
Jugendliche ausländischer Herkunft werden häufig in folgenden Ausbildungsberufen ausgebildet:
| Tabelle 1: Anteil der Auszubildenden ausländischer Nationalität
|
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 3, 2000, Berechnungen des BIBB; vgl. auch Werner 2000.
Die Chancen Jugendlicher ausländischer Herkunft in den neuen Berufen müssen deutlich verbessert werden.
Der expandierende Wirtschaftsbereich neu entwickelter Berufe im Rahmen der Informations- und Kommunikationsmedien bietet ein interessantes Betätigungsfeld mit guten Qualifizierungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Hier existieren mittlerweile 60.000 Ausbildungsplätze (Werner 2000). Sehr gering ist demgegenüber mit 4 % der Anteil von Jugendlichen ausländischer Herkunft in diesen Berufen (2000).
Mit 6 % in den Serviceberufen und 3 % in den Medienberufen ist die Aussicht von Jugendlichen ausländischer Nationalität in diesen Branchen unterproportional. Vergleichbares gilt für die neuen IT-Berufe, wo sie mit 3 % gleichfalls stark unterdurchschnittlich eine Ausbildung erhalten.
| Tabelle 2: Anteil der Auszubildenden mit ausländischem
Pass an allen Auszubildenden in
den neu entwickelten Berufen 1998 und 2000 Bundesgebiet West - absolut und in Prozent -
|
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 3, 1998 und 2000; Berechnungen des BIBB.
In den beruflichen Schulen sind Jugendliche ausländischer Nationalität überproportional in den Schularten vertreten, die nicht zu einem anerkannten Berufsabschluss führen. Häufig stellen diese Ausbildungsgänge "Warteschleifen" dar und sind Ausdruck des Verdrängungswettbewerbs auf dem betrieblichen Ausbildungsmarkt.
Im Berufsvorbereitungsjahr und im Berufsgrundbildungsjahr hat 1999 jeder sechste Schüler einen ausländischen Pass. Diese werden häufig als Ausweichmöglichkeiten bei mangelnden Lehrstellen genutzt. Insbesondere in den weiterführenden Zweigen des berufsbildenden Schulsystems, die in der Regel den Abschluss einer Lehre voraussetzen, sind Jugendliche ausländischer Herkunft stark unterproportional vertreten (z. B. Fachoberschule 7,1 %, Fachschule 3,9 %). In den Berufsfachschulen, die zu einem berufsbildenden Abschluss führen (können) beträgt der Anteil der Schüler ausländischer Nationalität rund 10 % und hat sich damit ihrem Bevölkerungsanteil angenähert (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2001, S. 84).
Die Potenziale von Jugendlichen mit Migrationshintergrund müssen stärker anerkannt und genutzt werden.
In den Einstellungsverfahren werden interkulturelle und bilinguale Kompetenzen von Ausbildungsplatzbewerbern ausländischer Herkunft noch immer zu wenig erkannt und anerkannt. Selbst in Wirtschaftszweigen mit Bedarf an interkulturellem und mehrsprachigem Fachpersonal, so im Bereich der personalen Dienstleistungen, aber auch in Branchen mit einem hohen Anteil an Kunden ausländischer Nationalität, wie in Beratungsinstitutionen, im Banken- und Versicherungsgewerbe sowie im Servicebereich für ausländische Unternehmen in Deutschland, werden Jugendliche ausländischer Herkunft noch zu selten als Auszubildende und junge Fachkräfte nachgefragt.
Eine der größten Hemmnisse im Vorfeld der Berufsausbildung ist es für Jugendliche mit Migrationshintergrund überhaupt einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Ein Mangel an ausbildungsinteressierten Schulabgängerinnen und Schulabgängern ausländischer Herkunft kann nicht festgestellt werden. Auch der Unterstützung durch die Eltern können sich die Jugendlichen überwiegend gewiss sein. Wesentlich problematischer ist es nach wie vor, Betriebe zu finden, die bereit sind, Jugendliche ausländischer oder anderer ethnischer Herkunft auszubilden.
Hierfür gibt es unterschiedliche Ursachen und Gründe. Exemplarisch werden hier eine Reihe von zentralen Ursachen thematisiert, die den Übergang Jugendlicher aus Migrantenfamilien von der Schule in eine Ausbildung und den Zugang zu einer betrieblichen Ausbildung erschweren und behindern.
Noch immer gibt es Betriebe, die durch ihre Selektionsmechanismen und Auswahlkriterien Ausbildungsplatzbewerber ausländischer Nationalität benachteiligen. Dem muss durch Beratung und gemeinsame Initiativen von Verbänden, Gewerkschaften und Arbeitsverwaltung entgegengewirkt werden.
a) Weniger häufig als Deutsche können Jugendliche mit Migrationshintergrund betriebsinterne Netzwerke für eine Einstellung nutzen. Sie können den betriebsinternen Arbeitsmarkt weniger nutzen, da ihre Eltern aufgrund ihrer betrieblichen Positionen seltener über ein gutes Informationsnetz und Kontakte innerhalb des Betriebs verfügen.
Dazu ein Hinweis: Deutsche Auszubildende geben wesentlich häufiger als Auszubildende ausländischer Nationalität an, den persönlichen Beziehungen der Eltern die Ausbildungsstelle zu verdanken.
b) Negativ wirken sich die in Betrieben verwendeten schriftlichen Testverfahren für die Ausbildungsbeteiligung von ausländischen Jugendlichen aus.
Diese angeblich "kulturneutralen" schriftlichen Testverfahren benachteiligen Jugendliche mit Migrationshintergrund. Sie haben zusätzlich den Mangel, wie wissenschaftliche Untersuchungen festgestellt haben, dass sie nur von geringem prognostischen Wert im Hinblick auf den Ausbildungserfolg der Jugendlichen sind.
c) Ein weiteres Ausbildungshemmnis sind Vorurteile von Personalchefs vor allem gegenüber jungen Menschen türkischer Nationalität, insbesondere gegenüber jungen Frauen.
Vor allem Betriebe, die bislang keinen Jugendlichen ausländischer Nationalität ausgebildet haben 'befürchten' Schwierigkeiten, sei es mit Sprachproblemen, sei es mit ausländerfeindlichen Vorurteilen von Kunden bzw. Mitarbeitern (Schaub 1991).
Diese Befürchtungen haben sich jedoch bei Betrieben mit Ausbildungserfahrung mit dieser Zielgruppe als unbegründet erwiesen.
Zudem nutzen Betriebe, wenn es einmal zu Schwierigkeiten in der Ausbildung eines Jugendlichen mit Migrationshintergrund kommt - aufgrund mangelnder Information - zu wenig ausbildungsbegleitende Hilfen und betriebliche Maßnahmen zur Förderung von Nachwuchskräften aus Migrantenfamilien.
d) Die Zurückhaltung von Betrieben und Verwaltungen aufgrund von Diskriminierung sind eine zusätzliche Schwierigkeit beim Zugang Jugendlicher ausländischer Herkunft zu einem Ausbildungsplatz.
Jugendliche aus Migrantenfamilien sind beim Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt durch ethnische Diskriminierung zusätzlich benachteiligt. Eine im Auftrag der ILO durchgeführte Studie belegt empirisch eindrucksvoll die ethnische Diskriminierung von Fachkräften ausländischer Herkunft mit einem in Deutschland erworbenen anerkannten Berufsabschluss beim Zugang zu einer ihrer Ausbildung entsprechenden Berufstätigkeit in Deutschland.
Vergleichbares gilt auch für den Zugang zu einer betrieblichen Berufsausbildung: Jugendliche ausländischer Herkunft - so die Ergebnisse einer Studie, die im Auftrag des BIBB [18] durchgeführt wurde - sind beim Zugang zu einer Berufsausbildung sowohl quantitativ als auch qualitativ aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit benachteiligt (Schaub 1991). Sie erhalten - im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil im Bundesgebiet West - unterdurchschnittlich Zugang zu einer (betrieblichen) Ausbildung im dualen System insgesamt und zudem sind sie stark unterproportional in zukunftsorientierten Berufen z. B. der IT-Branche aber auch des kaufmännischen Bereichs vertreten.
e) Schulabgänger ausländischer Herkunft konkurrieren mit deutschen Schulabgängern um qualifizierte betriebliche Ausbildungsplätze.
Im Vergleich zu deutschen Schulabgängern verfügen Jugendliche mit Migrationshintergrund seltener über mittlere Reife und Abitur. Sie konkurrieren daher z. T. mit schulisch besser vorgebildeten deutschen Schulabgängern um qualifizierte betriebliche Ausbildungsplätze in attraktiven gewerblich-technischen, kaufmännischen wie Dienstleistungsberufen. Die betrieblichen Auswahlkriterien und Rekrutierungsverfahren wie die sogenannten kulturneutralen Tests (s. o.) wirken sich hier doppelt benachteiligend aus, da zu den o. g. Ausgrenzungsmechanismen hinzukommt, dass die besonderen Potenziale von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, wie interkulturelle Basiskompetenzen und eine - mindestens in Ansätzen ausgebildete - Zweisprachigkeit als Auswahlkriterien und im Rekrutierungsverfahren nur selten berücksichtigt werden.
Die bestehenden Beratungsmöglichkeiten beim Übergang von der Schule in eine Ausbildung bieten Jugendlichen meist nicht hinreichend Vorschläge für eine längerfristig angelegte Bildungslaufbahn und Berufsperspektive.
Zudem sind Ausbildungsplatzbewerber ausländischer Herkunft wie deutsche Schulabgänger mit und ohne Hauptschulabschluss bei der Suche nach Ausbildungsplätzen stärker auf die Angebote der Arbeitsverwaltung angewiesen, da sie wesentlich seltener auf familiäre Netzwerke zurückgreifen können. Übrigens nehmen Schulabgänger ausländischer Nationalität das Beratungsangebot der Arbeitsämter [1] vergleichsweise stark in Anspruch.
Neue Initiativen zur besseren beruflichen und Ausbildungsintegration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund müssen darauf angelegt sein, bisher vernachlässigte Potenziale besser auszuschöpfen und Chancen zu verbessern.
Wichtig ist es hier, unterschiedliche Bildungsvoraussetzungen und die Heterogenität in den Lebenslagen dieser Zielgruppe ähnlich wie bei deutschen Jugendlichen zu berücksichtigen (vgl. ausführlich Alt/ Granato 2001, Granato 2000).
Dies gilt insbesondere für Schulabgänger ohne und mit Hauptschulabschluss, die zum Teil bereits lange in Deutschland sind.
Erhalten diese Jugendlichen im Verlauf der Ausbildung eine kontinuierliche Unterstützung, so sind sie in der Lage die Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Unterstützung benötigen sie insbesondere im Fachtheoretischen.
Ein besonderes Qualifikationspotenzial, das bislang kaum ausgeschöpft wird und gleichzeitig eine Arbeitsmarktreserve darstellt, sind junge Erwachsene mit Migrationshintergrund im Alter von 20-30 Jahren.
Die geringeren Chancen von Jugendlichen mit ausländischem Pass auf eine qualifizierte Berufsausbildung spiegeln sich auch darin wider, dass sie wesentlich häufiger als die deutsche Vergleichsgruppe ohne anerkannten Berufsabschluss bleiben: Neueste Auswertungen des Statistischen Bundesamtes [3] dokumentieren, dass 1998: 40 % der 20- bis unter 30-jährigen Jugendlichen ausländischer Nationalität ohne Berufsabschluss bleiben (m: 37 %, w: 43 %) und nur 12 % der deutschen Vergleichsgruppe (m: 10 %, w: 13 %) (dazu auch Troltsch 1999).
Auch dieses Qualifikationspotenzial - so ein weiterer Beschluss der Bündnispartner - gilt es zu nutzen und den jungen Erwachsenen im Wege der Nachqualifizierung das Nachholen eines anerkannten Berufsabschlusses zu ermöglichen. Die meisten der jungen Erwachsenen besitzen bereits berufliche Erfahrungen und haben Kompetenzen in der Arbeitswelt erworben, an denen geeignete Maßnahmen ansetzen können.
Wie Untersuchungen des BIBB [18] zeigen, sind junge Erwachsene ausländischer Nationalität - Frauen wie Männer - stark an einer (qualifizierten) Erwerbsarbeit interessiert (Granato 2000b). Um ihnen eine tragfähige und dauerhafte berufliche Integration zu ermöglichen, benötigen sie den Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung.
Hier gilt es die im Verlauf der Modellversuchsreihe "Nachqualifizierung" des Bundesinstituts für Berufsbildung entwickelten Konzepte (z. B. Davids (Hrsg.) 1998), für diese Zielgruppe zu erproben und - stärker als bisher - flächendeckend zu fördern (Bundesministerium für Bildung und Forschung u. a. (Hrsg.) 1999). In diesem Zusammenhang ist die Externenprüfung ein wichtiges Instrument (vgl. Hecker 1994).
Auch spät eingereiste Jugendliche und nachziehende junge Erwachsene verdienen ein besseres Angebot zur Nachqualifizierung in anerkannten Berufen.
Modellversuche haben gezeigt, dass junge Ausländer wie Aussiedler, die erst als Jugendliche oder junge Erwachsene einreisen, bei entsprechender Förderung, eine anerkannte berufliche Erstausbildung erfolgreich durchlaufen und abschließen.
Haben sie in ihrem Heimatland eine in sich geschlossene Schullaufbahn absolviert, so haben sie "systematisches Lernen" gelernt, besitzen eine hohe muttersprachliche Kompetenz, z. T. Erfahrungen im Erlernen einer Fremdsprache und sind oft stark bildungsmotiviert (Beer 1992). Auf der Grundlage ihrer guten muttersprachlichen Kenntnisse meistern sie, bei entsprechend kontinuierlicher sprachlicher und fachlicher Unterstützung oftmals in kurzer Zeit die sprachlichen und theoretischen Herausforderungen einer Berufsausbildung erfolgreich.
Eine Schwierigkeit besteht nach wie vor darin, dass Betriebe bisher zu selten bereit sind, Jugendliche dieser Zielgruppe auszubilden und die bestehenden Fördermöglichkeiten der Bundesanstalt für Arbeit [1] wie ausbildungsbegleitende Hilfen zu wenig kennen (Granato 2000b; Alt/ Granato 2001).
Soll die gesellschaftliche Zielsetzung einer Integration durch Qualifikation der jüngeren Generation mit Migrationshintergrund nicht politisches Statement bleiben, sondern tatsächlich realisiert werden, so sind erhebliche Anstrengungen aller gesellschaftlichen Kräfte notwendig.
Die Heterogenität der Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund und die damit verbundenen komplexen Problemkonstellationen verlangen mehrdimensionale Ansätze und Maßnahmen; hierbei stellt der Spracherwerb jeweils nur eine Dimension dar. Zielgruppenspezifische und differenzierte Maßnahmen müssen u. a. in folgenden Bereichen vorgesehen bzw. umgesetzt werden (vgl. ausführlich Granato 2000; Alt/ Granato 2001):
Erst wenn Jugendliche aus Migrantenfamilien entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil in allen Branchen und Berufen die Möglichkeit der Teilnahme an einer beruflichen Ausbildung erhalten, kann von Chancengleichheit auf dem Ausbildungsstellenmarkt gesprochen werden. Erst wenn (junge) Menschen aus Migrantenfamilien in allen Branchen und Berufen und auf allen Hierarchieebenen die Möglichkeit der Teilnahme am Erwerbsleben erhalten, kann von Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt gesprochen werden.
Der Weg zur Chancengleichheit ist noch immer weit. Um so zentraler ist es, Kräfte zu bündeln und weitere Ressourcen zu aktivieren, um Chancengleichheit und gleichberechtigte Partizipation von (jungen) Menschen mit Migrationshintergrund in Ausbildung und Beruf konsequent zu realisieren.
Alt, Christel; Granato Mona (2001): Berufliche Bildung einschließlich Nachqualifizierung junger Erwachsener mit Migrationshintergrund. In: Forum Bildung (Hrsg.): Bildung und Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten - Anhörung des Forum Bildung am 21. Juni 2001 in Berlin. Materialien des Forum Bildung 11. Forum Bildung, Bonn
Arbeitsgruppe "Aus- und Weiterbildung" im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit (2000): Beschluss vom 26. Juni 2000 zur Aus- und Weiterbildung von Migrantinnen und Migranten. In: ibv, Nr. 35 vom 30.August 2000, S. 3473 ff.
Beer, Dagmar (1992): Lern- und Integrationsprozess ausländischer Jugendlicher in der Berufsausbildung. Bundesinstitut für Berufsbildung. Berlin
Bethscheider, Monika; Granato, Mona; Kath, Folkmar; Settelmeyer, Anke (2001): Grenzenlos zum Erfolg - Das wirtschaftliche Potential Zugewanderter. Beitrag zum Gesellentag der Handwerkskammer Dortmund 2001 (unveröffentlichtes Manuskript). Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn
Brosi, Walter; Troltsch, Klaus; Ulrich, Joachim Gerd (2001): Rückblick auf den Ausbildungsstellenmarkt 2000. In: Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.) (2001): Nachfrage Jugendlicher nach Ausbildungsplätzen. Analysen und Prognosen 2000-2015. Forschung spezial 2. Bonn
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2001): Berufsbildungsbericht 2001. Bonn
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bundesinstitut für Berufsbildung, Bundesanstalt für Arbeit, Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik GmbH (INBAS) (Hrsg.) (1999): Neue Wege zum Berufsabschluss - ein Handbuch zur berufsbegleitenden Nachqualifizierung an- und ungelernter (junger) Erwachsener. Bonn, Berl, Nürnberg, Frankfurt a.M.
Davids, Sabine (Hrsg.) (1998): Modul für Modul zum Berufsabschluss. Berufsbegleitende Nachqualifizierung zwischen Flexibilität und Qualitätssicherung. Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Berichte zur beruflichen Bildung, Bielefeld
Granato, Mona; Werner, Rudolf (1999): Sinkende Ausbildungschancen für Jugendliche mit ausländischem Pass: motiviert, engagiert und dennoch weniger Chancen? In: Vermittlungsdienste der Bundesanstalt für Arbeit, Nr. 16
Granato, Mona (2000): Förderung der Teilhabe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Ausbildung und Beruf. In: Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Berufsausbildung Jugendlicher ausländischer Herkunft. Pressereferat. Veröffentlichungen und Materialien aus dem BIBB. Pressereferat, Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn. Bestellung über pr@bibb.de [28]
Granato, Mona (2000a): Junge Frauen zwischen Schule und Ausbildung. Chancen junger Frauen aus Migrantenfamilien. In: Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Jugendliche in Ausbildung und Beruf. Ergebnisse, Veröffentlichungen und Materialien aus dem BIBB. Pressereferat, Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn. Bestellung über pr@bibb.de [28]
Granato, Mona (2000b): Junge späteingereiste Frauen: Chancen und Möglichkeiten für eine berufliche Qualifizierung. In: Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren, Jugendliche und Stiftung SPI (Hrsg.) (2000): Mädchen in sozialen Brennpunkten. Berlin, Bonn
Hecker, Ursula (1994): Externenprüfung - eine Chance zum nachträglichen Berufsabschluss. Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Berufsausbildung nachholen. Wege zum nachträglichen Berufsabschluss für ungelernte (junge) Erwachsene. Ergebnisse, Veröffentlichungen und Materialien aus dem BIBB, Berlin, S. 49-60
Müller, Annette (1996): Förderkonzept Deutsch als Zweitsprache im ausbildungsbegleitenden Deutschunterricht; S. 13-20. In: Bildungsarbeit in der Zweitsprache Deutsch Nr. 3
Schaub, Günther (1991): Betriebliche Rekrutierungsstrategien und Selektionsmechanismen für die Ausbildung und Beschäftigung junger Ausländer. Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.). Berlin
Sprachverband Deutsch für Ausländische Arbeitnehmer (Hrsg.) (1998): Artikel zum Thema berufsorientierter/ berufsbezogener Deutschunterricht. Stand Oktober 1998, Mainz
Troltsch, Klaus (1999): Jugendliche ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Struktur und Biographiemerkmale. In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, Heft 5
Unabhängige Kommission Zuwanderung (2001): Zuwanderung gestalten, Integration fördern. Bericht der Unabhängigen Kommission "Zuwanderung". Berlin
Unabhängige Kommission Zuwanderung (2001a): Zuwanderung gestalten - Integration fördern, Zusammenfassung.. Bericht der Unabhängigen Kommission "Zuwanderung". Berlin
Werner, Rudolf (2000): 30.000 Ausbildungsverträge in neu entwickelten Berufen. In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, Heft 2
In: Schudy, J. (Hrsg.): Berufsorientierung in der Schule. Grundlagen und Praxisbeispiele. Bad Heilbrunn/ Obb. 2002, S. 17 - 31.
[/S. 17:] Die Notwendigkeit einer beruflichen Orientierung in allgemein bildenden Schulen ist in der Bundesrepublik Deutschland Mitte der 1950er Jahre deutlicher bewusst geworden.
Damals - in der Wiederaufbauphase nach dem 2. Weltkrieg - war die Jugend beim Übergang von der Schule in die Berufswelt mit großen Problemen konfrontiert. Diese hatten ihre Ursache zunächst vor allem in einem Mangel an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen. Die "Berufsnot der Jugend" (DGB 1952) nahm dann aber mit der Verknappung des Faktors Arbeit und den fehlenden Qualifikationen für die Einführung moderner, automatisierter Produktionsverfahren in der westdeutschen Wirtschaft zunehmend qualitative Züge an: Die Jugend geriet in eine allgemeine Qualifikationsnot. Vor diesem Hintergrund wurde eine bessere Ausbildung der künftigen Berufstätigen gefordert. Diese Forderung richtete sich nicht nur an die Institutionen der Berufsausbildung, sondern auch an ihre 'Zubringer' - die allgemein bildenden Schulen.
Insbesondere die Berufspädagogik verwies nachdrücklich auf die Probleme der Jugendlichen beim Eintritt in den Betrieb, der unvermittelt, also ohne schulische Vorbereitung erfolgte. Außerdem gab es Vorbehalte gegen die Berufsaufklärung durch die Berufsberatungsämter, weil sie Befunde der Berufsforschung kaum berücksichtigte. Zu nennen ist vor allem der Berufspädagoge Heinrich Abel. Er hat sich in mehreren Veröffentlichungen mit den pädagogisch-didaktischen Problemen im "Vorraum der beruflichen Bildung" (Abel 1956, S. 271) auseinander gesetzt. Dabei konnte sich die Berufspädagogik auf soziologische und sozialpsychologische Untersuchungen über die Situation der Jugend stützen. So hat Helmut Schelsky in seiner bekannten Studie "Die skeptische Generation" auf die Kompliziertheit und andauernde Veränderung der Berufsmöglichkeiten der Jugendlichen [/S. 18:] hingewiesen (vgl. Schelsky 1957, S. 245). Außerdem sah er den Übergang vom Kind zum Erwachsenenstatus durch die traditionelle Betriebslehre beeinträchtigt, weil sie keine dem Reifungs- und Entwicklungsstand der Schulabsolventen angemessene Lehrform sei. Deshalb müsse der Pflichtschulbesuch um ein Jahr oder gar um zwei Jahre verlängert und eine Vorbereitung auf die Berufswelt erfolgen, bevor die jungen Menschen in sie eintreten (vgl. Schelsky 1957, S. 297 ff.).
Die Überlegungen bezogen sich ursprünglich auf die allgemein bildenden Schulen generell. Gefolgt wurde Georg Kerschernsteiners Gedanken, dass alle Schulen die "erste Aufgabe" haben, die Schüler auf einen bestimmten Berufsbereich vorzubereiten (vgl. Kerschensteiner 1920). Dabei wurden jene Ansätze einer allgemeinen, arbeits- und berufsorientierten Erziehung wieder aufgenommen, die in der Geschichte des unteren und mittleren Schulwesens in Deutschland seit dem 17. Jahrhundert eine Rolle gespielt haben (vgl. Dedering 2000, S. 178 ff.). Die Betrachtung der historischen Ansätze beförderte eine schulformspezifische Konkretisierung der Diskussion. Dabei herrschte die Meinung vor, dass sich eine Berufsorientierung vornehmlich an praktisch Begabte richten sollte und sie insbesondere eine Aufgabe der enger auf das praktische Leben bezogenen Volksschule sein müsse. Mit diesem Argument ist die Einführung des 9. Volksschuljahres maßgeblich begründet worden. Dies führte dazu, dass sich die Diskussion über Berufsorientierung zunehmend auf die Volksschule beschränkte. Sie bezog sich aber nicht mehr nur auf die Übergangsprobleme der Jugendlichen, sondern es wurde umfassender über die Frage diskutiert, wie die Schülerinnen und Schüler auf die Berufs- und Arbeitswelt vorbereitet werden könnten. Nun ging es darum, die veraltete volkstümliche Volksschulbildung durch eine stärkere didaktische Ausrichtung der Volksschuloberstufe auf die künftigen Anforderungen der Berufsarbeit zu überwinden und der fragmentierten Volksschule einen pädagogischen Sinn zu geben. Konkrete Ansätze sind mit der Einführung des 9. Pflichtschuljahres realisiert worden. Die Maßnahmen bezogen sich jedoch nur auf Teilaspekte der Arbeitswelt. Im Vordergrund standen Hilfen bei der Berufsfindung durch "Erkundung der heimatlichen Arbeitswelt" (Wagner 1955, S. 200 ff.). Auch wurden Betriebspraktika durchgeführt. Hiermit hatten einige Volksschulen (z. B. in Hamburg und Berlin) schon seit Anfang bzw. Mitte der fünfziger Jahre Erfahrungen.
In ihrem Anfangsstadium war die schulische Berufsorientierung also durch zwei gegensätzliche Entwicklungen gekennzeichnet: Einerseits wurde ihre Perspektive auf die Volksschule verengt und andererseits erfolgte eine Ausweitung ihrer Problemstellung auf die Hinführung zur Berufs- und Arbeitswelt. Dies erklärt, warum die berufliche Orientierung in der damaligen Frühphase der Arbeitslehrediskussion einen geringen Stellenwert hatte. [/S. 19:]
Mitte der 1960er Jahre - mit Beginn der Bildungsreform - hat der Deutsche Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen die schulische Berufsorientierung in seinem Hauptschulgutachten in den umfassenden Begründungszusammenhang einer Arbeitslehre gestellt (vgl. Deutscher Ausschuss 1964).
Der Deutsche Ausschuss empfiehlt den Aufbau einer bis zum 10. Schuljahr verlängerten Hauptschule (die die Volksschuloberstufe ersetzen soll). Er setzt den "Beruf als didaktisches Zentrum" dieser neuen Schulform und versteht sie insgesamt als "Eingangsstufe des beruflichen Bildungsweges". Arbeitslehre als neue "selbstständige Unterrichtsform" der Hauptschule hat die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern eine "bildungswirksame Hinführung zur modernen Arbeitswelt" zu ermöglichen. "Dabei wird der Schüler mit Grundzügen des Arbeitens in der modernen Produktion und Dienstleistung so weit vertraut, dass er danach seine Berufswahl verständiger treffen kann" (ebd., S. 41).
Aus diesen Vorschlägen, die stark von den Arbeitslehre-Vorstellungen Heinrich Abels (der Mitglied des Deutschen Ausschusses war) geprägt sind (vgl. u. a. Abel 1966, S. 617 ff.), lässt sich schließen, dass in Arbeitslehre auch eine Hilfestellung bei der Berufswahl gegeben werden soll. Der Deutsche Ausschuss unterlässt es aber, die Berufswahlvorbereitung näher zu bestimmen. Ein besonderes Inhaltsangebot für das postulierte Ziel der "Berufswahlreife" sieht er nicht vor. Vielmehr erklärt er die Berufswahlvorbereitung als Grundprinzip, dem die ganze Arbeitslehre - mit Technik, Wirtschaft und Hauswirtschaft - verpflichtet ist. Dabei wird dem praktischen Tun in der Schule und dem Betriebspraktikum eine Zentralfunktion zugesprochen. Der vom Deutschen Ausschuss zugrunde gelegte traditionell-handwerkliche Berufsbegriff und die Konzentration seiner Arbeitslehre auf Industrie und Handwerk engt die Vorbereitung auf die Berufswahl jedoch stark auf den gewerblichen Bereich ein. Diese kann im 10. Schuljahr nach Berufsfeldern differenziert werden. Eine spezielle "Berufsreife" soll aber erst in der anschließenden Berufsausbildung angestrebt werden.
Aufgrund der vagen Vorstellungen des Deutschen Ausschusses zum Thema 'Berufsorientierung' bestand hierzu in den Jahren nach seinen Arbeitslehre-Empfehlungen ein großer Klärungsbedarf. Inzwischen lagen auch neue empirische Befunde und Theorien zur Berufswahl vor (z. B. von Scharmann, Jaide und Daheim), auf die die schulische Berufsorientierung zurückgreifen konnte (vgl. Steffens 1975). Außerdem traten in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre die Probleme des Berufs (Auflösung traditioneller [/S. 20:] Berufsbilder) und des beruflichen Ausbildungswesens (u. a. unbesetzte Lehrstellen, Unzufriedenheit der Lehrlinge sowie hohe Abbrecher- und Wechselquoten unter den Auszubildenden) auch in der Öffentlichkeit deutlicher hervor. Vor diesem Hintergrund begannen Pädagogik und Bildungspolitik sich stärker mit der Berufsorientierung zu beschäftigen. Zum einen wurden didaktische Entwürfe einer Berufswahlvorbereitung als ein Aufgabenfeld der Arbeitslehre und einer Arbeitslehre als vorberufliche Bildung (z. B. von Wiemann, Blankertz, Klafki, Stratmann und Kaiser) entwickelt (zum Überblick siehe Dauenhauer 1974 und Hendricks 1975). Zum anderen schlugen sich die Bemühungen in einer Reihe von Positionspapieren bildungspolitischer Institutionen und Gremien wieder (vgl. Dibbern u. a. 1974, S. 21 ff.). Diese zeugen - bei allen Unterschieden im Detail - von einem breiten politischen Konsens über die Notwendigkeit einer beruflichen Orientierung in der Schule. Richtungsweisend waren die Aussagen und Vorschläge der Kultusministerkonferenz [11] (KMK), des Deutschen Bildungsrates und der Bundesanstalt für Arbeit [1].
Die Empfehlungen der KMK zur Hauptschule (1969) sehen in dem Fach Arbeitslehre ein eigenständiges Unterrichtsfeld "Hinführung zur Berufswahl" vor, in dem "auf der Grundlage praktischen Tuns und theoretischer Durchdringung" sowie in Betriebserkundungen und Betriebspraktika eine "Orientierung über Berufsfelder, Berufsgruppen und Berufe" ermöglicht werden soll, die "am Ende der 9. Klasse zu einer revidierbaren Berufsfeldentscheidung" führt (KMK 1969, S. 29).
Nach den Empfehlungen des Deutschen Bildungsrates in seinem "Strukturplan für das Bildungswesen" (1970), der eine umfassende pädagogische sowie gesellschafts- und bildungspolitische Begründung für die Reform des deutschen Erziehungswesens enthält, gehört eine "Berufsbildungsberatung" (die gleichrangig neben der Schullaufbahnberatung und der individual-psychologischen Beratung steht) zu den Aufgaben des Bildungswesens. Sie ergänzt die berufliche Orientierung (über Berufsfelder, Berufsbilder und Berufschancen) in der Arbeitslehre, "damit der Lernende eine Berufswahl treffen kann" (Deutscher Bildungsrat 1970, S. 91). Grundsätzlich sollen die Lernangebote und die Wahl der Unterrichtsfächer auch an beruflichen Bildungsgängen und beruflichen Anforderungen orientiert werden. Damit nimmt der Deutsche Bildungsrat die Idee des Deutschen Ausschusses, die Hauptschule als Eingangsstufe des beruflichen Bildungsweges zu konzipieren, auf; er weitet sie aber auf alle allgemein bildenden Schulen aus (vgl. Dibbern u. a. 1974, S. 26).
§ 32 des Arbeitsförderungsgesetzes (1969) verpflichtet die Bundesanstalt für Arbeit, "mit den Einrichtungen der allgemeinen und der beruflichen Bildung" zusammenzuarbeiten. Dieser Kooperationsauftrag ist 1971 in einer [/S. 21:] "Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung" zwischen KMK und Bundesanstalt konkretisiert worden. Danach soll die Kooperation bei "berufsaufklärenden Maßnahmen" erfolgen. Die berufliche Einzelberatung, die Unterrichtung über die Berufsausbildung und die Vermittlung in berufliche Ausbildungsstellen sind ausschließlich Aufgabe der Bundesanstalt. "Bei ihren berufswahlvorbereitenden Maßnahmen stützt sich die Berufsberatung auf die durch die Schule geleistete Hinführung zur Wirtschafts- und Arbeitswelt" (Rahmenvereinbarung 1971, S. 449 ff.). Insbesondere den Berufsberatungsstellen der Arbeitsämter obliegt es, Verbindung zu den Schulen ihres Bezirkes zu halten und mit den Lehrerinnen und Lehrern zusammenzuarbeiten. Die Rahmenvereinbarung bildet die Grundlage für länderspezifische Richtlinien und Erlasse. In der Regel stehen der kooperativen Berufswahlvorbereitung folgende Möglichkeiten und Formen zur Verfügung (vgl. Landesarbeitsamt Hessen (Hrsg.) 1996):
Die pädagogischen und bildungspolitischen Vorschläge, insbesondere die Beschlüsse der KMK [11] von 1969, veranlassten die meisten Bundesländer, Lehrpläne, Richtlinien, Handreichungen bzw. Arbeitsgrundlagen für eine Arbeitslehre in Form eines Unterrichtsbereiches ("Arbeit - Wirtschaft - Technik") bzw. - seltener - in Form eines integrativen Unterrichtsfaches in der Hauptschule (sowie der Sonderschule) zu erlassen. Außerdem gehörte Arbeitslehre von Anfang an zum Curriculum der Gesamtschule. Während einige Bundesländer (z. B. Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen) schon Ende der sechziger Jahre Lehrpläne für Arbeitslehre vorlegten, geschah dies in anderen Ländern (z. B. in Hessen) erst Ende der siebziger Jahre. In diesen Plänen hat die Berufsorientierung einen didaktischen Ort bekommen. In der Regel sahen sie eine der folgenden Formen vor:
In den 1970er Jahren haben auch die Realschulen besondere Anstrengungen unternommen, den Schülerinnen und Schülern Hilfen bei der Berufswahl zu geben. Während es zunächst primär um organisatorische Aspekte ging (Zusammenarbeit mit der Berufsberatung, Durchführung von Betriebserkundungen und Betriebspraktika), rückten zunehmend inhaltliche Fragen in den Vordergrund (vgl. Wollenweber 1992, S. 469 f.). Berufsorientierung wurde entweder in dem neu eingeführten Fach bzw. Fächerverbund Arbeitslehre oder in einem vorhandenen Fach (Wirtschaft/ Politik u. a.) als Pflicht- und/ oder Wahlpflichtangebot (in der Regel in der 9. und 10. Klasse) angesiedelt oder als eine Aufgabe mehrerer Unterrichtsfächer betrachtet, wobei der Sozialkunde meist eine Leitfachfunktion zukam.
Die didaktischen Ansätze zur Berufsorientierung waren also unterschiedlich. Die Curriculumgestalter mussten die besonderen Schulsituationen in den Bundesländern (Vorläuferfächer, Schulausstattung, Vorbildung des Lehrpersonals u. a.) berücksichtigen, sie waren Eingriffen der Politik ausgesetzt und sie orientierten sich jeweils an bestimmten Konzeptionen, die mehr oder weniger kontrovers waren. Außerdem kam die Forderung nach Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung in Curricula und Unterrichtspraxis nur selten zum Tragen. Angesichts dieser Situation hat die Bundesanstalt für Arbeit [1] an die Wissenschaftler Harald Dibbern, Franz-Josef Kaiser und Adolf Kell 1974 ein Gutachten zur Entwicklung eines Curriculums >> Berufswahlunterricht << mit dem Auftrag vergeben, die Rahmenvereinbarung zur Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung unter Berücksichtigung der vorhandenen pädagogischen Ansätze und bildungspolitischen Empfehlungen didaktisch umzusetzen (vgl. Dibbern u. a. 1974).
Die Autoren weisen der schulischen Berufsorientierung ihren Platz in der Arbeitslehre zu. Diese verstehen sie als ein obligatorisches Unterrichtsfach für alle Schüler der Sekundarstufe I. Der Berufswahlunterricht soll ein kooperativer Aufgabenbereich von Bundesanstalt und Schule sein. Seine globale Aufgabe ist die Vermittlung einer Berufswahlreife, verstanden als "die erworbene Qualifikation zur Durchführung einer ersten Berufs- und Ausbildungsentscheidung unter der Perspektive einer langfristigen individuellen Berufswegplanung" (Dibbern u. a. 1974, S. 74). Diese enthält - im Hinblick auf die zentralen Bedingungen des Berufweges - drei Teilaufgaben: [/S. 23:]
Für diese Teilaufgaben, die auf Themenfelder verweisen, werden einzelne Lernziele und Teillernziele mit Inhalten und methodischen Vorschlägen angegeben.
Dieses "Rahmencurriculum" hat zu mehreren, von der Bundesanstalt für Arbeit bzw. von Landesarbeitsämtern initiierten und geförderten Modellversuchen geführt. Außerdem gab es eine Reihe von Versuchen, die auf die Initiative der Bildungsverwaltung oder einzelner Schulen zurückgingen (vgl. Büchner u. a. 1979, S. 65 ff.). Diese Modelle und Ansätze zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie Curricula mit konkreten Arbeitsmöglichkeiten im Bereich der Berufswahlvorbereitung entwickelt und erprobt haben. Damit haben sie einen maßgeblichen Anteil an der unterrichtspraktischen Wende in der Arbeitslehre-Entwicklung in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre.
In den 1980er Jahren ist verstärkt versucht worden, die schulische Berufsorientierung theoretisch neu zu bestimmen und auf eine neue curriculare Grundlage zu stellen. Die Notwendigkeit hierzu wurde in den Veränderungen der beruflichen Orientierungen, Einstellungen und Verhaltensweisen der Jugend und in dem Strukturwandel der Arbeitswelt gesehen (vgl. Dedering 2000, S. 338 ff.).
Ein wichtiger Bezugspunkt der theoretischen Arbeiten zur Berufsorientierung war die Realisierung von unternehmerischen Strategien zur Flexibilisierung der Berufsarbeit im Zusammenhang mit der Einführung neuer Technologien und Organisationsstrukturen. Diese zielten - und zielen auch heute noch - auf erweiterte Gestaltungspotenziale der Arbeitenden, über deren Einsatz in den Betrieben oft kurzfristig entschieden wird. Dabei stehen die Arbeitnehmer vor neuen Orientierungs- und Qualifizierungsproblemen, wie sie z. B. unter den Chiffren "häufiger Berufswechsel", "Vermittlung von Schlüsselqualifikationen" und "ständiges Um- und Weiterlernen" diskutiert werden.
Im Wesentlichen bezogen sich die Reflexionen und Vorschläge zur beruflichen Orientierung auf folgende, zum Teil auch empirisch untersuchte Aspekte:
Diese Ansätze sind in den Folgejahren teilweise weiterentwickelt und erprobt worden. Beispielsweise war der Vorschlag eines integrativen Berufswahlunterrichts von Lothar Beinke Grundlage eines Modellversuchs (von 1993 bis 1996) an sächsischen Mittelschulen. Gegenstand des Versuchs war der fächerübergreifende berufsorientierende Unterricht unter Einschluss von Betriebspraktika und unter Berücksichtigung der Förderung von Berufstätigkeiten für Mädchen (mit besonderer Gewichtung der technischen Berufe). Die Versuchsergebnisse - Durchführung von Betriebserkundungen und eines zweiten Betriebspraktikums, Vorschläge für Projektthemen, Einbeziehung der Berufsberatung u. a. - sind in Sachsen inzwischen in die Schulpraxis umgesetzt worden (vgl. Referate zur Abschlusstagung 1996).
Einen zukunftsträchtigen Reformansatz stellt das "Modell für eine schulformübergreifende, kooperativ gestaltete Berufsorientierung in der Sekundarstufe I" von Karl-Heinz Dammer dar (vgl. Dammer 1997, S. 47 ff.). Es [/S. 25:] handelt sich um ein (im Einvernehmen mit allgemein- und berufsbildenden Schulen entwickeltes) einheitliches Konzept für alle Schüler der 9. und 10. Klassen allgemein bildender Schulen, das unter Berufsorientierung die Vorbereitung auf die Berufswahl versteht und diese als eine "zentrale Entwicklungsaufgabe der Adoleszenz" definiert. Die Berufswahlvorbereitung soll (zur Auseinandersetzung mit allgemeinen Aspekten von Arbeit und Beruf) in die Pflichtfächer der Bereiche Gesellschaftslehre und/ oder Arbeitslehre integriert werden und in besonderen berufsfeldeinführenden Wahlpflichtkursen erfolgen. Das Modell sieht folgende Arbeitsformen vor:
Ein Kernelement des Konzepts ist die räumliche und personelle Zusammenarbeit verschiedener allgemein bildender Schulformen, die auch mit berufsbildenden Schulen in Kontakt stehen. Es kann im Rahmen der bestehenden Stundentafel realisiert werden.
Parallel zu den theoretischen Bemühungen sind die Arbeitslehre-Lehrpläne überarbeitet worden. Dies geschah in den meisten Bundesländern Anfang und Mitte der 1980er Jahre; die anderen, z. B. Bremen, Hamburg und Hessen, folgten in den 1990er Jahren.
In den Neufassungen hat die Vorbereitung auf die Berufswahl gegenüber den frühen Lehrplänen der 1960er und 1970er Jahre eine Verstärkung erfahren. Der Gegenstandsbereich 'Beruf' ist in sämtlichen Lehrplänen relativ umfangreich, in mehreren Plänen hat er sogar einen zentralen Stellenwert (z. B. in den Lehrplänen der Bundesländer Bayern, Berlin und Rheinland-Pfalz). Die neueren Erkenntnisse zur Berufsorientierung haben jedoch kaum Eingang in die Lehrpläne gefunden. Insbesondere ist die zukünftige Entwicklung von Beruf, Qualifikation und Berufsausbildung vernachlässigt worden. Der vorgesehene Berufswahlunterricht ist nach wie vor stark auf Vermittlung berufskundlicher Informationen ausgerichtet, z. B. zur konkreten Berufsfindung. Dabei wird aber stärker auf außerschulische Dienstleistungsangebote zurückgegriffen, z. B. des Arbeitsamtes [1] (in BIZ-Besuchen) und von Betrieben (in Betriebserkundungen und -praktika) (vgl. hierzu Ziefuß 1992, S. 142 ff.). [/S. 26:]
Angesichts dieser Situation in den Curricula kann der geringe Einfluss der Schule auf die Berufswahl der Jugendlichen nicht verwundern. So weisen empirische Untersuchungen darauf hin, dass die Schule als Wirkungsfaktor für die Berufswahlentscheidung in den Augen der Schüler erst nach den Eltern, dem Betriebspraktikum, der Berufsberatung und den Freunden rangiert (vgl. z. B. Kleffner u. a. 1996, S. 21). Diese Feststellung sollte für den Berufswahlunterricht Anlass sein, sich auf seine inhaltlichen Vorteile zu besinnen. Sie bestehen primär in der Vermittlung berufsorientierender Zusammenhänge, während für die konkrete Berufswahl die anderen beteiligten Institutionen und Personen bessere Voraussetzungen haben.
Vor dem Hintergrund der Diskussion um eine neue Allgemeinbildung gab es Bemühungen, eine technische, ökonomische und berufsorientierte Grundbildung stärker auch im Gymnasium zu verankern. Arbeitslehre sollte nicht länger ein 'Blaukittelfach' für praktisch Begabte sein, sondern ein allgemein bildendes Angebot für alle Schülerinnen und Schüler. Angesichts der Tatsache, dass immer mehr Gymnasiasten in Ausbildungsberufe drängen, erschien insbesondere ihre Vorbereitung auf die Berufswahl notwendig.
Entsprechend hat die KMK [11] 1987 Materialien verabschiedet, die die Empfehlungen zur Arbeitslehre an der Hauptschule von 1969 aktualisieren und auf die gesamte Sekundarstufe I erweitern (vgl. KMK 1988, S. 3 ff.). Danach kann Arbeitslehre als eigenständiges Fach, als Fächerverbund oder als Teil von bestehenden Fächern unterrichtet werden. Neben Technik, Wirtschaft und Haushalt bildet der Beruf einen eigenen Gegenstandsbereich. Dieser ist - in starker Anlehnung an die Vorschläge von Dibbern, Kaiser und Kell in ihrem Gutachten für die Bundesanstalt für Arbeit - auf die Bedingungen und Formen von Erwerbsarbeit bezogen und zielt auf die Fähigkeit zur Berufswahl. Während die Arbeitslehre-Materialien inhaltlich offen und politisch unverbindlich geblieben sind, hat die KMK 1993 die "Hinführung zur Berufs- und Arbeitswelt" als verbindliche Aufgabe aller Schulen der Sekundarstufe I festgeschrieben (vgl. KMK 1993, S. 9). Sie hat aber auf eine Präzisierung dieser Aufgabe verzichtet, so dass die Bundesländer die Hinführung zur Berufs- und Arbeitswelt im Sinne ihrer eigenen Vorstellungen gestalten konnten. Da sich die neuen Bundesländer bei der Entwicklung der Lehrpläne mehr oder weniger eng an einzelne Lehrpläne der alten Bundesländer angelehnt haben, hat die in den westdeutschen Curricula vorgesehene Berufsorientierung - neben der institutionellen - auch eine regionale Ausweitung erfahren.
[/S. 27:] In den 1990er Jahren ist zunehmend erkannt worden, dass die Berufswahl ein Prozess ist, der nicht auf die Sekundarstufe I begrenzt werden darf. Demzufolge sind auch zur Berufsorientierung in der Sekundarstufe II Regelungen getroffen worden. Zum einen haben KMK, Bundesanstalt für Arbeit [1] und Hochschulrektorenkonferenz [13] 1992 eine Gemeinsame Empfehlung zur Zusammenarbeit von Schule, Berufsberatung und Studienberatung in der gymnasialen Oberstufe und in berufsbildenden Schulen beschlossen. Hierin werden die Kompetenzen der beteiligten Bereiche sowie die gemeinsamen Ziele und Aufgaben - detaillierter als in der Rahmenvereinbarung von 1971 - festgelegt (vgl. Gemeinsame Empfehlung 1992, S. 452 ff.). Zum anderen hat die KMK 1997 in einer Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe ihre bereits im Jahre 1972 erhobene Forderung nach Verbesserung der beruflichen Orientierung und der Studier- und Berufswahlfähigkeit wiederholt und konkretisiert (vgl. KMK 1997). Inzwischen haben fast alle Landesregierungen Erlasse zur Berufs- und Studienorientierung in der gymnasialen Oberstufe herausgegeben.
Bei der institutionellen und regionalen Ausweitung der Berufsorientierung ist - ebenso wie bei den Lehrplanrevisionen - der Theoriestand nur ansatzweise berücksichtigt worden. Auch haben dabei Rezeptionen der Berufsorientierung im Ausland (vgl. z. B. Bojanowski/ Dedering 1991; Ziefuß 1996, S. 130 ff.) kaum Beachtung gefunden. Die aufgezeigten Veränderungen in der Praxis der Berufsorientierung bleiben also hinter ihren theoretisch ausgewiesenen Möglichkeiten zurück.
Eine berufliche Orientierung sehen die Curricula für die Schulen der Sekundarstufe I oder/ und für die gymnasiale Oberstufe aller Bundesländer vor. Zwischen den Schulformen bestehen aber erhebliche Unterschiede in der Gestaltung der Berufsorientierung:
Grundsätzlich erscheint es als sinnvoll, wenn alle Unterrichtsfächer zur Berufsorientierung beitragen, indem z. B. die fachspezifischen Berufe vorgestellt werden. Es ist aber problematisch, den Inhaltskomplex der Berufsorientierung zu 'zerstückeln' und die einzelnen Elemente in andere Fächerstrukturen einzufügen. Die Vorbereitung auf die Berufswahl als ein biografiebedeutsamer Zusammenhang erfordert auch eine Organisation als eigenständiger Unterrichtsbereich, entweder im Rahmen eines Faches oder in Form von fächerübergreifenden Veranstaltungen. Dabei kann ein arbeitsweltbezogener Kontext, wie er mit dem Fach Arbeitslehre hergestellt wird, durchaus lernförderlich sein, denn er ermöglicht die stetige Berücksichtigung [/S. 29:] übergreifender, gesellschaftlicher Aspekte der Berufswahl. Dies bedeutet, dass in der Hauptschule sowie in den anderen Schulen, in denen eine Arbeitslehre mit einem eigenen Berufswahlunterricht existiert, relativ günstige Voraussetzungen für die Vorbereitung der Schüler auf die Berufswahl gegeben sind. Hier hat der Berufswahlunterricht - umgekehrt - auch die Arbeitslehre im Laufe ihrer Entwicklung konsolidiert. Demgegenüber führt die fachliche Einbindung der Berufsorientierung im Gymnasium in der Regel zu Defiziten in der unterrichtlichen Vermittlung. Im gymnasialen Bereich sind die bildungspolitischen Ansprüche und bildungstheoretischen Vorschläge zur Berufsorientierung am wenigstens schon umgesetzt worden. Dabei ist auch die Tatsache von Bedeutung, dass mit steigenden Schülerzahlen im Gymnasium mehr Jugendliche eine schlechte Berufswahlvorbereitung erhalten. Die Situation der schulischen Berufsorientierung ist also zwiespältig. Sie ist aufgrund der schon angeführten inhaltlichen Reduzierungen (primär Informationsvermittlung u. a.) zwar auch dort nicht 'rosig', wo es einen eigenständigen Berufswahlunterricht gibt, die organisatorischen Unterschiede treten aber deutlich hervor. Somit nötigt die aktuelle Situation zur Fortführung der jahrzehntelangen Bemühungen um eine bessere berufliche Orientierung, nun aber mit stärkerer Konzentration auf das Gymnasium.
Abel, Heinrich (1956): Die berufsbildende Schule im Oberbau einer allgemeinen Deutschen Volksschule. In: Die Deutsche Schule, Jg. 48, Heft 6, S. 262-277.
Abel, Heinrich (1966): Berufsvorbereitung als Aufgabe der Pflichtschule. In: Pädagogische Rundschau, Jg. 20., Nr. 7, S. 617-629.
Beinke, Lothar (1987): Modellvorschlag zum Berufswahlunterricht. Köln.
Bojanowski, Arnulf/ Dedering, Heinz (1991): Vorberufliche Bildung in Osteuropa. Sachstandsanalysen für Bildungsreformen in West und Ost. Wiesbaden.
Büchner, Peter/ de Haan, Gerhard/ Müller-Daweke, Renate (1979): Von der Schule in den Beruf. Berufsorientierung und Berufwahlvorbereitung in der Sekundarstufe I. München.
Dammer, Karl-Heinz (1997): Berufsorientierung für alle. Über einen Schulversuch, der Versuch blieb! Wetzlar.
Dauenhauer, Erich (1974): Einführung in die Arbeitslehre. München.
Dedering, Heinz (2000): Einführung in das Lernfeld Arbeitslehre. München, Wien.
Deutscher Ausschuss (Deutscher Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen) (1964): Empfehlungen und Gutachten. Folge 7/8, Stuttgart.
Deutscher Bildungsrat (1970): Strukturplan für das Bildungswesen. Empfehlungen der Bildungskommission. Bonn.
DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) (Hrsg.) (1952): Arbeitslosigkeit und Berufsnot der Jugend. Erarbeitet von der Sozialwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft zur Erforschung von Jugendfragen unter der wissenschaftlichen Leitung von Helmut Schelsky. 2 Bd., Köln.
Dibbern, Harald (1983): Berufsorientierung im Unterricht. Verbund von Schule und Berufsberatung in der vorberuflichen Bildung. In: Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Nr. 78, Nürnberg.
Dibbern, Harald (1993): Theorie und Didaktik der Berufsvorbildung. Ein Studienbuch für Berufs- und Wirtschaftspädagogen. Baltmannsweiler.
Dibbern, Harald/ Kaiser, Franz-Josef/ Kell, Adolf (1974): Berufswahlunterricht in der vorberuflichen Bildung. Der didaktische Zusammenhang von Berufsberatung und Arbeitslehre. Bad Heilbrunn.
Famulla, Gerd-E. (1985): Wozu Berufe? Über die Zukunft des Berufskonzepts von Arbeit. In: arbeiten+lernen, Heft 39, S. 2-7.
Feldhoff, Jürgen/ Otto, Karl A./ Simoleit, Jürgen/ Sobott, Claus (1985): Projekt Betriebspraktikum. Berufsorientierung im Problemzusammenhang von Rationalisierung und Humanisierung der Arbeit. Lehrerhandbuch zur Didaktik, Methodik, Organisation. Düsseldorf.
Gemeinsame Empfehlung (1992): Gemeinsame Empfehlung der Kultusministerkonferenz, der Bundesanstalt für Arbeit und der Hochschulrektorenkonferenz über die Zusammenarbeit von Schule, Berufsberatung und Studienberatung im Sekundarbereich II. In: Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.): Handbuch zur Berufswahlvorbereitung. Ausgabe 1992, Nürnberg.
Hendricks, Wilfried (1975): Arbeitslehre in der Bundesrepublik Deutschland. Theorien, Modelle, Tendenzen. Ravensburg.
Hoppe, Manfred (1980): Berufsorientierung. Studien zur Praxis der Arbeitslehre. Weinheim, Basel.
Kahsnitz, Dietmar (1982): Aufgaben fachdidaktischer Forschung und Lehre für den Unterrichtsbereich Arbeit - Wirtschaft - Technik bzw. Arbeitslehre. In: arbeiten+lernen, Heft 20, S. 6-9.
Kerschensteiner, Georg (1920): Begriff der Arbeitsschule. Leipzig, Berlin.
Kleffner, Annette/ Lappe, Lothar/ Raab, Erich/ Schober, Karen (1996): Fit für den Berufsstart? Berufswahl und Berufsberatung aus Schülersicht. Materialien aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Nr. 3, Nürnberg.
Klippert, Heinz (1987): Berufswahl-Unterricht. Handlungsorientierte Methoden und Arbeitshilfen für Lehrer und Berufsberater. Weinheim, Basel.
KMK (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland) (1969): Empfehlungen zur Hauptschule (Beschluss der 131. Sitzung vom 3./4. Juli 1969). In: betrifft: erziehung, Heft 8, S. 29.
KMK (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland) (1988): Material zum Lernfeld Arbeitslehre im Sekundarbereich I (Beschlussfassung vom 235. Plenum am 8./9. Oktober 1987 in Berlin). In: arbeiten+lernen, Heft 57, S. 3-5.
KMK (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland) (1993): Vereinbarung über die Schularten und Bildungsgänge im Sekundarbereich I (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 03.12.1993 in der Fassung vom 27.09.1996). Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz. o. O. (Bonn).
KMK (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland) (1997): Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 in der Fassung vom 28.02.1997). o. O. (Bonn).
Kramer, Wolfgang (Hrsg.) (1988): Zur Berufsorientierung am Gymnasium. Bundesarbeitsgemeinschaft Schule, Wirtschaft. Köln.
Landesarbeitsamt Hessen (Hrsg.) (1996): Berufswahl im Team. Angebote der Berufsberatung. Frankfurt/M.
Lemmermöhle-Thüsing, Doris u. a. (1991-1993): Wir werden was wir wollen! Schulische Berufsorientierung (nicht nur) für Mädchen. Bd. 1-6. Ministerium für die Gleichstellung von Mann und Frau des Landes Nordrhein-Westfalen. Dokumente und Berichte 16. Düsseldorf.
Mueller, Heinz Dieter (1989): Zukunft der Berufswahlfreiheit. Plädoyer für eine soziokulturelle Neuinterpretation und Neuorganisation der Berufswahl und Berufsorientierung. In: Wiebe, H.-H. (Hrsg.): Jugend in der Sackgasse? - Gegen die Entwarnung in der Jugendfrage! - Bad Segeberg, S. 141-164.
Rahmenvereinbarung (1971): Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 5. Februar 1971. In: Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.): Handbuch zur Berufswahlvorbereitung. Ausgabe 1992. Nürnberg.
Referate zur Abschlusstagung (1996): Referate zur Abschlusstagung des Modellversuchs "Berufsorientierender Unterricht an Mittelschulen im Freistaat Sachsen unter Einschluss von Betriebspraktika unter Berücksichtigung der Förderung von Berufstätigkeiten für Mädchen" am 13.11.1995 in Dresden. In: Didaktik der Berufs- und Arbeitswelt, Heft 2-3.
Schelsky, Helmut (1957): Die skeptische Generation. Düsseldorf, Köln.
Steffens, Heiko (1975): Berufswahl und Berufsvorbereitung. Wiesbaden.
Wagner, Otto (1955): Erkundung der heimatlichen Arbeitswelt. In: Westermanns Pädagogische Beiträge, 6. Jg., S. 200 ff.
Wollenweber, Horst (1992): Berufliche Orientierung als Bestimmungsmerkmal der Realschule in Geschichte und Gegenwart. In: Keim, H./ Wollenweber, H. (Hrsg.): Realschule und moderne Arbeitswelt. Arbeitsgesellschaft und Qualifikation im Wandel. Köln, S. 455-473.
Ziefuß, Horst (1992): Lehrpläne in den westlichen Bundesländern. In: Ziefuß. H. (Hrsg.): Arbeitslehre. Eine Bildungsidee im Wandel, Bd. 5. Seelze-Velber.
Ziefuß, Horst (1996): Arbeitslehre im Spiegel der Meinungen. In: Ziefuß, H. (Hrsg.): Arbeitslehre. Eine Bildungsidee im Wandel. Bd. 3. Seelze.
[/S. 22:] Als besondere Erziehungswissenschaft wendet sich die Berufs- und Wirtschaftspädagogik pädagogisch relevanten Situationen zu, die in Verbindung mit ökonomischen und beruflichen Phänomenen der Arbeitswelt stehen. Zur Bewältigung dieser Situationen will sie Bildungshilfe anbieten. In der Berufsvorbildung geht es dabei um Situationen jenes Teils der Arbeitswelt, der vor jeder beruflichen Spezialisierung dem Jugendlichen als wenig bekannter Erfahrungsraum beim Übergang vom Bildungs- in das Beschäftigungssystem entgegentritt. Ich wähle folgende begriffliche Grundlage:
"Beruf" ist zum einen objektives Phänomen spezialisierter Erwerbsarbeit, zum anderen eine pädagogische Leitidee, eine pädagogische Norm, die eine positiv zu bewertende Beziehung zwischen dem Einzelnen und seiner Arbeit ausdrückt. Die Frage nach der Gültigkeit einer pädagogischen Leitidee "Beruf" beantwortet sich durch die pädagogische Relevanz der vier wichtigsten Aspekte des Phänomens Beruf:
Damit wird Beruf berufspädagogisch definiert als Zuwendung des Menschen
Gegenstand der Berufsorientierung ist die Berufsarbeit in einem doppelten Sinne: Erschließung individueller Chancen im konkreten Beruf und Erkenntnis des gesellschaftlichen Systems beruflicher Arbeitsteilung. "Den Unterschied zwischen dem individuell-dispositionalen und dem gesellschaftlich-politischen Ansatz zum Gegenstand eines Streits zu machen, in dem es um ein 'Entweder - Oder' geht, erscheint angesichts der Schwächen beider Ansätze müßig. Eine 'Didaktik der Berufswahl' kann infolgedessen das subjektive Einzelinteresse und die kollektiv-solidarische Interessenvertretung als die beiden Seiten eines gesellschaftlichen Auftrages nur zusammenhängend begreifen" (Steffens 1978, S. 276). [/S. 24:]
Mit der Kategorie Arbeit geht die Berufsorientierung voll in der Arbeitslehre auf, stellt sie Berufsausbildung und Berufstätigkeit als Erscheinungsformen gesellschaftlicher Arbeit dar, hinterfragt sie kritisch und schafft solidarisches Interesse arbeitender Menschen. Sie macht dem jungen Menschen Gesellschaft und Arbeitswelt, in die er eintreten wird, in ihren Gegebenheiten, Defiziten und Veränderungsmöglichkeiten durchschaubar und erkennbar, damit er als mündiges Mitglied der Gesellschaft seinen Beitrag zu ihrer Fortführung und Verbesserung aus aufgeklärtem Wissen leisten kann. Über die didaktische Kategorie Arbeit wird verhindert, dass Berufsorientierung zum bloßen Anpassungsdienst am Beschäftigungssystem wird, sondern zum Ziel hat, "das Klientenpotenzial für die Berufsberatung (Individualberatung) zu vergrößern und vor allem eine Effektivierung des Beratungsgesprächs durch eine intensive Vorbereitung in der Schule zu erreichen" (Büchner u. a. 1979, S. 15).
Über die Kategorie Beruf stellt die Berufsorientierung die Identität des Einzelnen im System der gesellschaftlichen Arbeitsteilung her und gewinnt hier eine pragmatische Funktion. Unterrichtsinteresse wird das Einzelinteresse. "Beruf" sucht als pädagogische Leitidee nach den (verbliebenen) Möglichkeiten beruflicher Identität, nach individueller Selbsterfahrung und Selbstbestimmung durch Arbeit. Berufsorientierung kann diese gedachten und gesuchten Möglichkeiten in das Bewusstsein der Schüler heben und zugleich deren Abhängigkeit von den vielfältigen Bedingungen des Beschäftigungssystems, ihre Begrenzung durch Mitbestimmung und ihre Gefährdung durch Unmündigkeit und Herrschaft.
Wenn in der Schule pädagogische Hilfe für eine Lebenssituation geleistet werden soll, die den Jugendlichen in Kürze erwartet, muss sich Berufsorientierung als praxis- und handlungsnahe Orientierungs- und Entscheidungshilfe konkretisieren. Sie hat das Ziel, die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit des Schülers für seine berufliche Entwicklung zu fördern. Das Ziel ist gesellschaftspolitisch durch das Grundrecht auf freie Berufswahl und den Anspruch auf Chancengerechtigkeit begründet, erziehungswissenschaftlich als notwendige Hilfe zur Selbsthilfe für die Realisierung von Chancen. Berufsorientierung hat die Aufgabe, "den sozialen Zwang der beruflichen Allokation durch die Schule für den Schüler erträglicher zu machen, indem ihm die Chance eingeräumt wird, unter didaktischer Hilfestellung Strategien beruflicher Entscheidungsfindung anzuwenden, die ein hohes Maß an Rationalität der Berufswahl gewährleisten. Je überschaubarer die Wirkungszusammenhänge beim individuellen Berufsfindungsprozess für den Einzelnen gemacht werden und je mehr Optionen für die Berufswahl erschlossen werden können, desto eher lässt sich ein Minimum an individueller Berufswahlfreiheit erreichen" (Ammon 1980, S. 107 ff.).
Bei der Berufsorientierung im Unterricht geht es also um die Motivierung und Befähigung [/S. 25:] des Schülers zur individuellen Berufswegplanung: Der einzelne Jugendliche ist betroffen bzw. betroffen zu machen. Durch unterrichtliche Vermittlung von Informationen und Handlungsweisen will die Schule eine Orientierungs- und Entscheidungshilfe für die persönliche Berufswahl anbieten. Um das Grundrecht auf freie Berufswahl material zu sichern, insbesondere für diejenigen Jugendlichen, die bei ihrer Berufswahl benachteiligt sind, verlangt das sozialpolitische und pädagogische Postulat der Chancengerechtigkeit die Institutionalisierung eines Lernprozesses als Hilfe zur Selbsthilfe. "Er hat alle wesentlichen Daten und Kriterien zu vermitteln, die den Einzelnen befähigen, beruflich bedeutsame objektive und subjektive Gegebenheiten und Entwicklungstendenzen sowie die Möglichkeiten ihrer Beeinflussung zu erkennen, damit er die eigene berufliche Entwicklung so weit wie irgend möglich selbst bestimmen kann. Dieser Lernprozess wird Berufsorientierung genannt" (Dibbern u. a. 1974, S. 133). Dabei sind entwicklungspsychologische und entscheidungstheoretische Elemente des Berufswahlprozesses im curricularen Ansatz zu verbinden, der die Handlungskompetenz des Jugendlichen in Fragen seiner beruflichen Entwicklung anstrebt.
Berufsbezogene Informationen und Handlungsweisen stehen allerdings immer in einem größeren Zusammenhang, der durch die gesellschaftlichen Strukturen der Berufswelt gegeben ist. Schon deswegen kann und muss Berufsorientierung immer nur Teilaufgabe einer umfassenden Berufsvorbildung sein. Sie muss außerdem einen fachbezogenen Standort haben; als bloßes Unterrichtsprinzip der Schule schlechthin und durch beliebige Lehrer gehandhabt, kann sie wohl nur sehr begrenzte Wirkung erreichen. Berufsorientierung im Unterricht wird insbesondere als Teilaufgabe einer alle Schulformen umfassenden Arbeitslehre verstanden und gefordert. Sie lässt sich in drei Qualitätsstufen realisieren.
(Abb. 1)

aber seine besondere Wirkung durch die Inanspruchnahme spezifischer Leistungen der Berufsberatung. Andererseits behält berufliche Beratung neben der Integration in Unterricht ihren eigenständigen Aufgabenbereich außerhalb der Schule. Es ist daher eine wichtige Aufgabe, diese beiden Teilaufgaben zu identifizieren und in einer Gesamtkonzeption der beruflichen Beratung soweit wie möglich miteinander zu verbinden. Die Bundesanstalt für Arbeit [1] sollte dabei eine Koordinierungsrolle einnehmen und die Schulen bzw. die Kultusverwaltungen durch konkrete Kooperationsangebote zur Zusammenarbeit inspirieren, z. B. durch Anregung regionaler Kontaktkommissionen, Angebot von Organisationsmodellen und curricularen Bausteinen, Fortbildungsangeboten.
Für die Arbeitsverwaltung war "Berufsaufklärung" nach dem Arbeitsförderungsgesetz (AFG) von 1969 eine Aufgabe der Berufsberatung. "Dieser Begriff erwies sich für den Kontakt mit Jugendlichen und Eltern als weniger geeignet und missverständlich; die Berufsberatung benutzt deshalb, angelehnt an den internationalen Sprachgebrauch, hierfür nun den Begriff Berufsorientierung" (Nieder 1981, S. 22). Berufsorientierung kennzeichnet den Zeitraum von den ersten bewussten, aber noch unsicheren Fragen zur künftigen Berufstätigkeit bis zur planmäßigen Analyse beruflicher Alternativen, aus der schließlich die Berufsentscheidung hervorgeht. Leitziel der Berufsorientierung ist dementsprechend die "Berufswahlreife", verstanden als individuelle Fähigkeit, Informationen zur Berufswahl gezielt nachzufragen und zu verwerten. "Berufswahlreife soll die Chancen zur Selbstbestimmung, zumindest die Freiheit von Fremdbestimmung bei der Berufswahl vergrößern" (Nieder 1981, S. 22). Mit diesem Bezug auf die Selbstbestimmung des Einzelnen gewinnt der Begriff Berufsorientierung [/S. 27:] auch im Bereich der Arbeitsverwaltung pädagogische Qualität. Die Auffassung, dass die Berufsberatung, also auch die Berufsorientierung, keine erzieherische Aufgabe leiste, sollte als formalistisch entfallen (Nieder 1981, S. 16). In einem didaktischen Verbund ist die pädagogische Aufgabe weder theoretisch noch praktisch teilbar, weil zielorientierte Lernprozesse immer zugleich erzieherische Absicht ausdrücken, Unterricht schlechthin Erziehung ist. Es wäre sicherlich eine Unterschätzung, wollte man den im Berufswahlunterricht mitarbeitenden Berufsberater bloß als "Datenbank" verwenden. Über seine unterrichtliche Mitwirkung hinaus wird die spezifische Beratungsaufgabe des Berufsberaters, die immer situativ auf die Belange des Einzelnen abstellt, in der Kontinuität beruflicher Beratung als wichtiges Element auch des Berufswahlunterrichts gefordert.
Durch § 32 AFG gesetzlich zur Zusammenarbeit mit der Schule verpflichtet, hat die Bundesanstalt für Arbeit [1] in einem Übereinkommen vom 12.2.1971 mit der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder [11] deren "Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung" vom 5.2.1971 bestätigt. Darin sind die Aufgaben der Schule und der Berufsberatung bei ihrer Zusammenarbeit festgelegt. Als Kernaussagen dürfen gelten:
Es wird die Vorstellung eines Stufengangs sichtbar: Der Unterricht beginnt mit einer allgemeinen Einführung in die Arbeitswelt, darauf aufbauend bereitet der Berufsberater die individuelle Berufsentscheidung vor und bietet schließlich als Entscheidungshilfe die berufliche Einzelberatung an. Es ist zu prüfen, ob diese Vorstellung und Aufgabenteilung für einen didaktischen Verbund von Schule und Berufsberatung optimal ist. "Inhalte der Berufsorientierung, die nur der Berufsberatung vorbehalten sind, kann es rechtlich nicht geben" (Nieder 1981, S. 22). Es ist zu fragen, ob individuelle Orientierung auch schon vom Lehrer geleistet werden muss, obwohl die Bundesanstalt immer noch auf dem Standpunkt steht, "Informationen über die eigene Person und über persönliche Konsequenzen sollen und können durch Berufsorientierung nicht gegeben werden; diese Inhalte gehören zur individuellen Beratung" (Nieder 1981, S. 18). In einer Neukonzeption beruflicher Beratung sollte gesehen werden, dass Berufswahlunterricht stets individualisierende Impulse enthält, die aus der Situation der Klasse heraus gleichermaßen vom Lehrer und vom Berufsberater aufgenommen und gegeben werden können. [/S.28:]
Berufsorientierung im Unterricht mit dem Ziel, im Jugendlichen Verhaltensänderungen in Richtung auf selbstbestimmte Berufswahl in Gang zu setzen, ist also begrifflich und inhaltlich eine erzieherische, immer auch auf den Einzelnen ausgerichtete Aufgabe, soweit dies die unterrichtliche Form überhaupt zulässt. In ihr wirkt der Berufsberater mit. Dabei wird natürlich die kulturhoheitliche Zuständigkeit und Verantwortlichkeit von Schule und Lehrer vorausgesetzt.
Die erzieherische Bedeutung der Berufsorientierung zeigt sich auch in ihrer Bedeutung für die Einzelberatung. "Berufsorientierung bereitet die berufliche Beratung vor und ergänzt sie; zwischen beiden Aufgaben besteht daher ein enger Zusammenhang" (Schäfer 1977, S. 14). Berufsorientierung muss den Jugendlichen beratungswillig und beratungsfähig machen, damit er auch andere Angebote beruflicher Beratung annimmt und nutzen kann. Er muss sich z. B. trauen, eine "Dienststelle" der Bundesanstalt für Arbeit [1] aufzusuchen oder anzurufen und in der Lage sein, die Zeit des Beratungsgesprächs durch gezielte Informationsfragen voll auszuschöpfen. Wenn also dem Jugendlichen durch Berufsorientierung nicht nur berufskundliches Wissen, sondern "Verarbeitungs- und Bewertungskriterien zur Vorbereitung eigener Entscheidungen vermittelt" werden sollen und er informiert sein muss, damit "die Beratung auf die Erörterung der individuell wesentlichen Entscheidungsfaktoren ausgerichtet werden" kann, wird eine zeitliche und sachliche Schlüsselfunktion der Berufsorientierung deutlich. Wenngleich verständlich ist, dass die Bundesanstalt für Arbeit aus prinzipiellen Erwägungen alle Aufgabenbereiche der Berufsberatung für grundsätzlich gleichrangig erklärt, sollte m. E. die Berufsorientierung Priorität erhalten. Schon die Verpflichtung des § 31 AFG, "über die Berufe, deren Anforderungen und Aussichten, über Wege und Förderung der beruflichen Bildung sowie über beruflich bedeutsame Entwicklungen in den Betrieben, Verwaltungen und auf dem Arbeitsmarkt umfassend (zu) unterrichten", ist in maximal zwei Schulbesprechungen nicht zu leisten, ganz abgesehen von der Aufgabe, auch individualisierende Impulse zu geben und zu anderen Formen beruflicher Beratung hinzuführen. Wenn also zu vermuten ist, dass Berufsorientierung einen herausragenden Stellenwert im System der Hilfen zur Selbsthilfe einnimmt, andererseits die gestellte Aufgabe inhaltlich in der herkömmlichen Weise nicht zu lösen ist, wird die Notwendigkeit, nach neuen Formen zu suchen, unabweisbar.
Neben ihrer Mitwirkung am kooperativen Berufswahlunterricht führt die Berufsberatung eigene Maßnahmen zur Berufsorientierung durch. Das geschieht entweder in der Schule (Schulbesprechungen, Gruppenberatungen) oder an anderen Lernorten, z. B. auf berufskundlichen Ausstellungen, in stationären oder mobilen Berufsinformationsstellen und -zentren, bei berufskundlichen Veranstaltungen für Jugendliche und Erziehungsberechtigte im Arbeitsamt. Über Einzelheiten dieser Maßnahmen kann an anderer Stelle nachgelesen werden (Nieder 1981, S. 44 ff.).
Die Tatsache, dass Berufsorientierung auch von anderen Institutionen betrieben [/S. 29:] wird, z. B. von Gewerkschaften, Wirtschaftsverbänden, Kammern, Betrieben, sei der Vollständigkeit halber erwähnt, bleibt in diesem Zusammenhang unberücksichtigt.
"Berufsorientierung" ist ein pädagogischer Normbegriff und bezeichnet eine komplexe Lernorganisation mit mehreren Lernorten, die aus der Kooperation von Schule und Berufsberatung entsteht und in der Regel ihren Schwerpunkt im Berufswahlunterricht der allgemeinen Schule hat, mit dem Ziel, Berufswahlkompetenz im Schüler zu entwickeln, verstanden als die Fähigkeit, Informationen zur Berufswahl gezielt nachzufragen und zu verwerten und damit die Chance für eine selbstbestimmte Berufswahl zu vergrößern.
Ammon, Hermann (1980): Berufsorientierung in der Schule. Eine didaktische Grundlegung, München
Büchner, Peter/ de Haan, Gerhard/ Müller-Daweke, Renate (1979): Schule-Arbeitsmarkt-Beschäftigungssysteme. Schulische Berufswahlvorbereitung im Spannungsfeld widersprüchlicher Interessen.
Dibbern, Harald/ Kaiser, Franz-Josef/ Kell, Adolf (1974): Berufswahlunterricht zur vorberuflichen Bildung. Der didaktische Zusammenhang von Berufsberatung und Arbeitslehre, Bad Heilbronn
Nieder, Heinrich (1981): Aufgaben und Methoden der Berufsorientierung, Stuttgart
Rahmenvereinbarung (1971): Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 2.1.1971
Schäfer, Joachim (1977): Praxis der beruflichen Beratung, Stuttgart
Statistisches Bundesamt (1975): Klassifizierung der Berufe, Wiesbaden
Steffens, Heiko (1978): Arbeitslehre zwischen Integration und Desintegration, in: Northemann, Wolfgang (Hrsg.): Politisch-gesellschaftlicher Unterricht in der Bundesrepublik: curricularer Stand und Entwicklungstendenzen, Opladen
[/S. 115:] Wer der Berufsorientierung in der Schule einen Stellenwert, möglicherweise sogar einen hohen Stellenwert im Berufsfindungsprozess von Mädchen beimisst, setzt sich leicht dem Verdacht aus, Mädchen und Frauen anzulasten, was tatsächlich der geschlechtlichen Arbeitsteilung, einem geschlechtshierarchisch segmentierten Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt sowie einem nach Geschlechtern selektierendem Berufsausbildungssystem geschuldet ist. Haben nicht empirische Untersuchungen längst belegt, dass Mädchen eine qualifizierte Berufsausbildung anstreben, eine schulische Berufsorientierung als "Motivationspropaganda" für Mädchen somit überflüssig ist? Sind es nicht die Zwänge des Arbeitsmarktes, die junge Frauen immer wieder in die schlechter bezahlten "typischen Frauenberufe" einmünden lassen. Und mussten wir uns nicht längst von der Illusion verabschieden, dass Frauen allein durch Bildungsanstrengungen gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt erreichen?
Mit diesen Fragen sind strukturelle Grenzen der Berufsorientierung in der Schule angedeutet. Die Benachteiligung von Frauen abzubauen, ihnen gleichberechtigte Teilnahme am Erwerbsleben, am gesellschaftlichen und politischen Leben zu ermöglichen, das ist nicht in erster Linie ein Bildungsproblem, sondern ein Problem der politischen Gestaltung dieser Gesellschaft. Das heißt, es geht um Quotierung, Frauenförderung und letztlich um die Umverteilung und Neubewertung aller gesellschaftlich notwendigen Arbeit, ohne die keine Aussicht auf ein neues, gleichwertiges Geschlechterverhältnis besteht. [/S. 116:]
Dennoch möchte ich im Folgenden weder auf diese Grenzen eingehen noch auf den begrenzten Stellenwert, den Bildung im Allgemeinen und für Frauen im Besonderen hat, wenn soziale und Geschlechterungleichheiten zu überwinden sind. Auch mit der Analyse der Situation von Mädchen und Frauen in Ausbildung und Beruf will ich mich hier nicht beschäftigen. Ich setze dies alles als bekannt voraus und gehe auch davon aus, dass mir nicht unterstellt wird, diese Grenzen und Bedingungen nicht zu sehen oder zu vernachlässigen.
Ich möchte vielmehr im Folgenden
Hintergrund meiner Ausführungen sind Überlegungen, Erfahrungen und Ergebnisse des Projekts "Mädchen und Berufsfindung", das ich von 1987-1991 zusammen mit wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, Lehrerinnen und Lehrern aus Haupt-, Real- und Gesamtschulen am Zentrum für Lehrerbildung der Universität Bielefeld durchgeführt habe.
Aufgaben dieses Projektes waren
Zweifellos kann Schule auf die Arbeitswelt nicht direkt verändernd einwirken, wohl aber kann sie den Prozess der Berufsfindung begleiten, Erklärungen anbieten für die widersprüchliche Situation der weiblichen Jugendlichen, und sie kann vor allem den weiblichen Jugendlichen die Möglichkeit bieten, ihre Wahrnehmungen der (Arbeits-) Wirklichkeit zur Diskussion zu stellen, zu überprüfen und Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Dass dies notwendig ist und warum trotz aller Einschränkungen der schulischen Berufsorientierung ein hoher Stellenwert beizumessen ist, möchte ich an einigen Interviewauszügen deutlich machen. Die Äußerungen der 13- bis 15jährigen Schülerinnen, die in der Schule in einem "Mädchenprojekt" mit von uns entwickelten Unterrichtsmaterialien arbeiteten, geben auch einen Hinweis darauf, was schulische Berufsorientierung leisten könnte oder sollte.
Zunächst Sonja auf die Frage nach Problemen und Schwierigkeiten weiblicher Auszubildender in männlich dominierten Berufen:
"Weil, wenn man so in einen Betrieb kommt, wo hauptsächlich Männer arbeiten, und dann als einzige Frau da ist, und dann wird schon, also so Blicke kriegt man dann schon mit, und dann wird auch über einen geredet, und das denkt man sich auch alles schon vorher."
Zum gleichen Thema Ilka, eine Hauptschülerin:
"Als Erstes musst du (..) zeigen, was du kannst, und vor allen Dingen musst du nicht nur einmal, sondern mehrere Male musst du beweisen, dass du gut bist, dass man dich genauso respektieren kann wie die Männer auch."
Beate, die ihren Berufswunsch Mechanikerin inzwischen aufgegeben hat: [/S. 119:]
"Ja, weil die Eltern so dagegen sind. Also, mein Vater, der sagt, ich soll so was machen, bloß nicht in ne Firma gehen, da, wo nur Männer sind und so z. B. mit Mechaniker. Ich weiß nicht, ich werkel da gern so rum. Ich nehm mein Radio auseinander oder so, meint er, ich soll das bloß sein lassen, ich kann, ich könnte das sowieso nicht."
Zu einem anderen Thema die Aussage von Dagmar:
"Meine Zukunft? Naja, heiraten, Kinder haben und trotzdem berufstätig bleiben. (...) Och, wenn es nach mir ginge, dann würde ich die ganze Zeit nur im Kindergarten arbeiten, also überhaupt nicht mehr aufhören ... aber das ist eben fast unmöglich."
Oder Tanja, die vehement den Wunsch nach Beruf und Familie vertritt:
"Wenn man also 'ne Arbeit hat, also den ganzen Tag, dann kann man auch kein Kind, keine Familie gründen, zumal wenn man Erfolg haben will auch in dem Beruf und nach oben streben möchte, da kann man sich dann keine Familie leisten. Ich mein, `n Ehemann klar, das kann man immer, aber so Kinder, das ist dann schon schwieriger, dann muss man für die Kinder da sein, das ist eben auch ein Problem ... Ich mein, wenn man Familie gründet, dann bleibt man eigentlich immer zu Hause, und dann hat man Gelegenheitsjobs und so halbtags, und das ist dann auch nicht das Wahre. Das lässt sich nicht ändern."
Und Angela auf die Frage, ob nicht auch der Partner die Kinderversorgung übernehmen könne:
"Wenn`s für mich schon schwer ist, allein zu Hause zu bleiben, dann wird`s dem Mann bestimmt auch genauso schwer sein. Das kann ich ja dann nicht verlangen, wenn ich arbeiten will, dass er zu Hause bleibt."
Und zum Schluss noch einmal Tanja auf die Frage, ob sich für sie durch das Mädchenprojekt etwas geändert hat: [/S. 120:]
"Durch das Mädchenprojekt, also da hat sich schon viel geändert. Früher hab ich immer gedacht: Ach, wenn du Kinder hast, hörst du auf zu arbeiten und du bleibst zu Hause. Und jetzt denke ich eben, och, du gehst auch arbeiten und lässt dich nicht unterdrücken. Das hat sich geändert."
Keine dieser Äußerungen ist repräsentativ, und das "Mädchenprojekt" hat keinen zusätzlichen Ausbildungsplatz geschaffen und auch die realen Bedingungen der Mädchen beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt nicht verändert. Dennoch lassen sich "Erträge" dieser Form und Inhalte schulischer Berufsorientierung festhalten:
In der Aufklärung über Strukturen und zentrale Entwicklungstendenzen der Arbeitswelt, in der Diskussion und Überprüfung der Interpretationen gesellschaftlicher Wirklichkeit, in der Unterstützung berechtigter Ansprüche, im Aufzeigen, Diskutieren und Erproben alternativer Handlungsmöglichkeiten jenseits der traditionellen [/S. 121:] weiblichen oder männlichen Verhaltensweisen und Erwerbsbiografien liegen m. E. die Aufgaben und die Möglichkeiten schulischer Berufsorientierung.
Wollen wir die weiblichen Jugendlichen weder an die vorherrschende geschlechtliche Arbeitsteilung und damit verbundene Erwartungen anpassen noch ihnen die männliche Erwerbsbiografie als neue Norm empfehlen, so muss es um die Entwicklung einer kritischen, d. h. einer auf die Veränderung einengender und diskriminierender Bedingungen gerichteten Handlungsfähigkeit gehen. Kritische Handlungsfähigkeit als Ziel schulischer Berufsorientierung, darunter verstehe ich die Motivation und Kompetenz der Mädchen,
Einer solchen kritischen Handlungsfähigkeit stehen die vorherrschende Theorie und Praxis der Berufsorientierung in der Schule entgegen.
Rein formal gilt auch in der schulischen Berufsorientierung Chancengleichheit. Berufswahlvorbereitung, Betriebserkundungen und Betriebspraktika gelten für Mädchen wie Jungen gleichermaßen. Und auch die alte Trennung in Hauswirtschaft für Mädchen und [/S. 122:] Technik für Jungen ist längst ein alter Hut. Ein etwas genauerer Blick aber zeigt sehr schnell, dass in der schulischen Berufsorientierung weder die mit der geschlechtlichen Arbeitsteilung zusammenhängenden Widersprüche zur Sprache kommen, noch der Komplexität des weiblichen Berufsfindungsprozesses Rechnung getragen wird.
Was ist diesen didaktischen und organisatorischen Defiziten entgegenzusetzen?
Der in den Punkten 2, 3 und 4 benannte theoretische Bezugsrahmen betrifft die Berufsorientierung von Mädchen und Jungen gleichermaßen. Zugleich wird von diesem Erklärungszusammenhang her aber auch deutlich, dass über die vorherrschenden Geschlechterverhältnisse als Herrschaftsverhältnisse Mädchen wie Jungen unterschiedliche Positionen in der Arbeits- und Lebenswelt zugewiesen werden, sie deshalb auch unterschiedliche Erfahrungen machen, die Wirklichkeit unterschiedlich wahrnehmen, interpretieren und sich aneignen. Sie müssen deshalb auch Unterschiedliches lernen. Vor diesem Hintergrund kann auch, was ohne ein umfassendes Verständnis des Berufsfindungsprozesses als "natürlich", als traditionell und rollenspezifisch erscheint und oft abwertend als "typisch Mädchen" bezeichnet wird, angemessen interpretiert werden.
Die widersprüchlichen Erfahrungen der Mädchen im Berufsfindungsprozess, ihre unter den vorherrschenden gesellschaftlichen Bedingungen ambivalenten Orientierungen auf Beruf und Familie dürfen nicht negiert, sondern müssen zum Ausgangspunkt schulischer Lernprozesse gemacht werden. In diesen widersprüchlichen Orientierungen liegen einerseits die Gefahr der Anpassung und der Zwang zum Kompromiss, wenn das Vorgefundene als unveränderbar, [/S. 130:] Widersprüche als individuell überwindbar wahrgenommen werden, Alternativen nicht sichtbar sind oder unrealisierbar erscheinen. Andererseits liegt darin aber auch die Chance, sich mit widersprüchlichen Anforderungen und eigenen Orientierungen kritisch auseinander zu setzen und dadurch neue Sichtweisen und eine erweiterte Handlungsfähigkeit zu gewinnen. (3)
Die genannten Bezugspunkte waren neben der Analyse der Orientierungsprobleme von Mädchen beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt und ihrer Sichtweisen auf Arbeit, Beruf und den Zusammenhang von Beruf und Familie maßgeblich für die Auswahl der inhaltlichen Schwerpunkte und der Anlage der Themeneinheiten im Projekt "Mädchen und Berufsfindung".
Den aufgezeigten Gefahren des Betriebspraktikums versuchen wir dadurch zu begegnen, dass wir in Anlehnung an Feldhoff u. a. (1985) Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Betriebspraktika als didaktische Einheit konzipieren. Vorbereitung und Auswertung erfolgen in Projekttagen direkt vor bzw. nach der Praxisphase durch eine Lehrperson bzw. durch ein Team, das auch die Praktikantinnen in der Praxisphase betreut. Um inhaltlich die Überprüfung der Praxiserfahrungen zu gewährleisten, schlagen wir vor, nach folgendem Erkundungskonzept vorzugehen:
Erster Schritt: Problemwahrnehmung
Über Vorinformationen, Beispiele aus der Erfahrungswelt der SchülerInnen oder anhand von Fallbeispielen wird die Arbeitswelt bzw. ein Aspekt der Arbeitswelt als Problem bewusst (z. B. Frauen und Männer arbeiten in der Regel an unterschiedlichen Arbeitsplätzen). Was als Problem wahrgenommen wird, regt auch dazu an, Fragen nach den Ursachen zu stellen.
Zweiter Schritt: Formulierung von Vermutungen/ Annahmen [/S. 131:]
Die Schülerinnen äußern ihr Vorverständnis zum Problem, z. B. Vermutungen, warum Frauen und Männer an verschiedenen Arbeitsplätzen zu finden sind. Dadurch werden ihre Vorannahmen bzw. Vorurteile bewusst und überprüfbar. Diese aus dem Vorverständnis gewonnenen Annahmen können ergänzt werden durch allgemeine Informationen über den zu erkundenden Aspekt, die zu einer weiteren Annahmenbildung im Hinblick auf die Situation im Betrieb anregen, z. B. Informationen über die unterschiedlichen Berufsbildungen und Arbeitssituationen von Frauen und Männern.
Dritter Schritt: Umsetzung in Fragestellungen und Beobachtungsaufgaben:
Nicht alle Annahmen lassen sich im Betrieb durch Beobachtung überprüfen, nicht jede Frage ist geeignet, die Annahmen wirklich zu bestätigen oder zu widerlegen. Deshalb müssen SchülerInnen genau überlegen, was beobachtet werden kann, welche Fragen gestellt werden müssen und wem sie sinnvollerweise gestellt werden.
Vierter Schritt: Überprüfung der Annahmen
Die Annahmen selbst werden bei der Erkundung im Betrieb durch Beobachtung, Kommunikation vor allem auch mit älteren Arbeitnehmerlnnen, die auch Entwicklungen miterlebt haben, durch eigene Arbeit im Praktikum und durch Zusatzinformationen überprüft. Zugleich wirft die Erkundung bzw. die Mitarbeit im Praktikum neue Fragen und Probleme auf, die wieder Anlass zur Annahmenbildung sind.
Fünfter Schritt: Auswertung und Erarbeitung verallgemeinerbarer Erkenntnisse
Die über Erkundungen und Praktika gewonnenen Antworten werden diskutiert, mit den Ergebnissen anderer Erkundungen verglichen, mit empirischen Daten und Fakten konfrontiert und/ oder mit ExpertInnen besprochen. Auch damit lässt sich nicht "die Wahrheit" über die Arbeitswelt oder die "Wirklichkeit" von Berufen [/S. 132:] erkennen, wohl aber eine realistische Einschätzung gewinnen, an der anders lautende Informationen überprüft werden können.
Derartig vorbereitete und ausgewertete Erkundungen und Praktika garantieren zwar nicht, ermöglichen aber eine angemessene Einschätzung der Arbeitswelt und eine realistischere Berufsfindung.
Wir haben im Projekt das didaktische Konzept und die Themeneinheiten nicht nur entwickelt, sondern auch in verschiedenen Schulformen erprobt. Trotz gleicher Vorbereitung und überwiegend gleicher Materialien verlief die Umsetzung in jeder Klasse anders. Je nach Lerngruppe und Lernsituation wurde gekürzt, erweitert, geändert, umgestellt. Was an einer Schule möglich war - die Durchführung von Projektwochen, die Arbeit in geschlechtshomogenen Gruppen, die Verlagerung von Unterricht in außerschulische Bildungsstätten -, war in anderen Schulen nur reduziert, in Dritten überhaupt nicht möglich. Während an einigen Schulen männliche Kollegen - angeregt durch das "Mädchenprojekt" - über antisexistische Jungenarbeit nachzudenken begannen, mussten sich an anderen Schulen die Lehrerinnen gegen Ausgrenzung ob der von ihnen eingebrachten provozierenden Perspektiven und Organisationsformen von Unterricht wehren.
Möglicherweise waren diese Schulen Ausnahmen. Wodurch die Unterstützung der Mädchen im Berufsfindungsprozess konkret begrenzt wurde, zeigte sich deutlich bei Schul- und Fachkonferenzen, bei Fortbildungen und in Gesprächen in einzelnen Klassen. [/S. 133:]
Angesichts der hier aufgezeigten Probleme zeigt sich, dass die Entwicklung eines didaktischen Konzepts und thematischer Einheiten zur Berufsorientierung allenfalls ein Schritt auf dem Weg zu einer Veränderung des Unterrichts ist. Der Möglichkeit nach könnte Unterricht durchaus ein Ort kritischer weiblicher Selbstreflexion und Selbstbewusstwerdung sein (vgl. Rabe-Kleberg 1990) und die Schülerinnen bei ihrer Suche nach neuen, eigenen Wegen jenseits der traditionellen weiblichen oder männlichen Biografien [/S. 135:] unterstützen. Damit aber schulische Berufsorientierung zu diesem Ort wird, bedarf es vor allem organisatorischer Veränderungen und einer gezielten und systematischen Fort- und Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern.
1) Vgl. hierzu ausführlicher: Lemmermöhle-Thüsing, Doris (1990): "Meine Zukunft? Naja, heiraten, Kinder haben und trotzdem berufstätig bleiben, aber das ist fast unmöglich." Über die Notwendigkeit, die Geschlechterverhältnisse in der Schule zu thematisieren: das Beispiel Berufsorientierung. In Rabe-Kleberg, U. (Hg.): Besser gebildet und doch nicht gleich! Frauen und Bildung in der Arbeitsgesellschaft. Bielefeld 1990.
2) Vgl. hierzu ausführlicher: Lemmermöhle-Thüsing, Doris (1990): "Meine Zukunft? Naja, heiraten, Kinder haben und trotzdem berufstätig bleiben, aber das ist fast unmöglich." Über die Notwendigkeit, die Geschlechterverhältnisse in der Schule zu thematisieren: das Beispiel Berufsorientierung. In Rabe-Kleberg, U. (Hg.): Besser gebildet und doch nicht gleich! Frauen und Bildung in der Arbeitsgesellschaft. Bielefeld 1990.
3) Zu Ambivalenzen als kritisches Lernpotenzial siehe Becker-Schmidt/ Knapp 1987, S. 8 und 68 ff.
Ahlheit, P./ Körber, K. / Rabe-Kleberg, U. (Hrsg.) (1990): Abschied von der Lohnarbeit? Diskussionsbeiträge zu einem erweiterten Arbeitsbegriff, Bremen.
Becker-Schmidt, R./ Knapp, G.-A. (1987): Geschlechtertrennung - Geschlechterdifferenz. Suchbewegungen sozialen Lernens, Bonn.
Feldhoff, J./ Otto, K. A. u. a. (1985): Projekt Betriebspraktikum. Berufsorientierung im Problemzusammenhang von Rationalisierung und Humanisierung der Arbeit, Düsseldorf.
Lemmermöhle-Thüsing, D. (1990): "Meine Zukunft? Naja, heiraten, Kinder haben und trotzdem berufstätig bleiben, aber das ist ja fast unmöglich." Über die Notwendigkeit, die Geschlechterverhältnisse in der Schule zu thematisieren: das Beispiel Berufsorientierung. In: Rabe-Kleberg, U. (Hrsg.): Besser gebildet und doch nicht gleich! Frauen und Bildung in der Arbeitsgesellschaft, Bielefeld.
Lemmermöhle-Thüsing, D. (1993): "Wir werden, was wir wollen". Schulische Berufsorientierung (nicht nur) für Mädchen. Schriftenreihe des Ministeriums für die Gleichstellung von Frau und Mann Nordrhein-Westfalen, 6 Bde., Düsseldorf.
Rabe-Kleberg, U. (Hrsg.) (1990): Besser gebildet und doch nicht gleich! Frauen und Bildung in der Arbeitsgesellschaft, Bielefeld.
In: Schudy, J. (Hrsg.): Berufsorientierung in der Schule. Grundlagen und Praxisbeispiele. Bad Heilbrunn/ Obb. 2002, S. 51 - 68.
[/S. 107:] Wir leben in einer dynamischen Zeit. Die Veränderungen im Bereich der Berufs- und Arbeitswelt in den letzten Jahren sind mit Begriffen wie z. B. Kundenorientierung, Reorganisation der Wertschöpfungsprozesse und Globalisierung vielfältig beschrieben worden. Organisationsentwicklung und Veränderungen der Arbeitsabläufe, die Einführung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien haben das Arbeitsleben verändert, aus Arbeitnehmern sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit erweiterten Kompetenzen und neuer Verantwortung geworden. Unternehmen werden zu lernenden Unternehmen, schnelles Lernen aus Veränderungen ist Voraussetzung für erfolgreiche Unternehmenskonzepte und die Gestaltung der Märkte und - falls erforderlich - schnelle Anpassung an die Märkte.
Mit der Veränderung der Berufs- und Arbeitswelt verändern sich auch die Fragestellungen und Problemlagen jungen Menschen am Übergang von der Schule in die Berufs- und Arbeitswelt. Die Schulen antworten auf die veränderten Bedingungen und erweitern ihre Berufsorientierungskonzepte. Sie antworten auf Veränderungen und nutzen die mit den neuen Möglichkeiten gegebenen Chancen für die Bildungsprozesse der Schülerinnen und Schüler.
Die Bundesanstalt für Arbeit [1] identifiziert sieben dominante Trends für die Zukunft der Erwerbsarbeit (vgl. Schober 2001). Mit diesen Trends wird ein Bezugssystem beschrieben, das meines Erachtens für die Weiterentwicklung der curricularen Rahmenbedingungen einer schulischen Berufsorientierung richtungsweisend ist. Diese Trends sollen hier kurz benannt werden.
Informatisierung: Bereits heute benutzen mehr als die Hälfte aller Erwerbstätigen programmgesteuerte Arbeitsmittel und erstellen, sammeln und verarbeiten Informationen mit Computern. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen. Für immer mehr Arbeitsplätze werden Kenntnisse und Fähigkeiten im [/S. 108:] Einsatz der modernen Kommunikationsmittel erforderlich. Berufsorientierung wird künftig noch mehr als heute auch einen Beitrag dafür leisten müssen, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Medienkompetenz weiterentwickeln.
Globalisierung: Arbeitsorte und Arbeitsbedingungen sind nicht mehr regional bestimmt. Mit der Globalisierung verändern sich die Konkurrenzsituationen und die Zumutbarkeiten an regionale Mobilität. Fremdsprachenkompetenzen, kulturelle Kompetenzen und Mobilität gewinnen im Berufsleben an Bedeutung. Berufsorientierung wird auch dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen entwickeln können, um unter den Bedingungen der Globalisierung ihre beruflichen Wege gestalten zu können.
Entkoppelung: Erwerbsarbeit und Normalarbeitsverhältnisse, Berufsausbildung sowie soziale Sicherung werden entkoppelt. Die Wirtschaft wird die Berufsausbildung und Weiterbildung zunehmend vor allem für die Kernbelegschaft übernehmen. Die Aus- und Weiterbildung der Randbelegschaften oder der im Rahmen von Projekten eingebundenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird für viele Unternehmen nicht mehr erforderlich sein, wenn am Arbeitsmarkt qualifizierte Kräfte zur Verfügung stehen. Die künftig Beschäftigten müssen zunehmend bereit sein, ihre Weiterbildung eigenverantwortlich zu gestalten. Der Auftrag der Berufsorientierung umfasst damit auch die Entwicklung der Fähigkeit, die individuelle Bildungsbiografie zu gestalten.
Erwerbsformen: Verbunden mit der Entkoppelung entstehen neue Erwerbsformen. Selbstständigkeit, Projektarbeit, Telearbeit, Leiharbeit kennzeichnen die neuen Erwerbsformen, deren Verbreitung mit weiteren Deregulierungen am Arbeitsmarkt zunehmen wird. Die Erwerbstätigen müssen in größerem Maße zu Unternehmern der eigenen Arbeitskraft, zu den Managern der eigenen Potenziale werden. Berufsorientierung hat damit auch die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, die eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale bewusst wahrzunehmen, zu überprüfen und weiter zu entwickeln. Sie muss dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler ihren Fähigkeiten und Kompetenzen entsprechende Berufswege zielorientiert gestalten können.
Entstandardisierung von Berufsbiografien: Berufsnormalbiografien, d. h. die früher typischen Wege von der Schule in eine Berufsausbildung und anschließende Berufstätigkeit in diesem Beruf bis zur Rente, werden seltener. Unterschiedliche Tätigkeiten und unterschiedlich lange Zeitabschnitte der einzelnen Phasen werden die Berufsbiografie bestimmen. Nicht immer frei gewählt werden Arbeiten, Lernen, Freizeit und Eigenarbeit sich abwechseln. Veränderungen werden nicht automatisch als Scheitern interpretiert, Um- und Quereinsteigen werden Teile der neuen "Normalbiografien" [/S. 109:] werden. Bereits am Eintritt in die Berufswelt verläuft der Weg nicht mehr typisch geradlinig. Der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung erweist sich als zunehmend verzweigter: vorher noch eine weitere schulische Ausbildung oder erst mal jobben, ein Praktikum oder ein Auslandsaufenthalt, dann vielleicht erst studieren. Berufsorientierung muss Schülerinnen und Schüler unterstützen, auch angesichts der verschiedenen Möglichkeiten schon beim Einstieg in die Berufswelt entscheidungsfähig zu sein, berufliche Orientierung als permanente Aufgabe wahrzunehmen und Veränderungen nicht zwangsläufig als Brüche zu verstehen. Berufsorientierung trägt zur Stärkung der Persönlichkeit bei.
Entberuflichung: In Anzeigen am Arbeitsmarkt wird der Trend deutlich sichtbar. Die Anzeigen nicht nur für neue Berufe oder besonders außerordentliche Beschäftigungen enthalten heute oftmals wenig Hinweise auf formale Qualifikationen und Abschlüsse. Der Beruf behält nur für einen Teil der Erwerbstätigen und einen Teil der Arbeitsplätze seine Bedeutung. Für die Berufsorientierung verändert sich damit das Zentrum der Orientierung.
Qualifizierung: Die Anforderungen in der Berufsausbildung sind in den letzten Jahren quer durch alle Berufe gestiegen, der Trend zur Höherqualifizierung, verbunden mit der Bereitschaft und Fähigkeit, das fachliche Wissen ständig zu aktualisieren, ist nach wie vor zu beobachten und schließt extrafunktionale Qualifikationen wie die Bereitschaft und Fähigkeit zum lebenslangen Lernen ein. Berufsorientierung muss dazu beitragen, dass sich die Schülerinnen und Schüler auf diese Aufgaben vorbereiten und das eigene Lernen in unterschiedlichen Kontexten organisieren und professionalisieren können.
Die Trends beschreiben Veränderungen in der Arbeitswelt und kennzeichnen, was Berufsorientierung leisten muss. Sie verdeutlichen, dass die Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler beim Übergang von der Schule in die Berufswelt differenzierter werden. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich heute beim Übergang von der Schule in die Berufs- und Arbeitswelt angesichts der Unvorhersehbarkeiten und Unübersichtlichkeiten orientieren und stabilisieren. Die meisten Jugendlichen, die heute eine Ausbildung beginnen, werden im Laufe ihrer Erwerbstätigkeit den Beruf wechseln und in verschiedenen Beschäftigungsformen tätig sein.
Welche Kompetenzen müssen die Jugendlichen erwerben, damit sie sich unter diesen Bedingungen in der Berufswelt orientieren und ihre Potenziale und Fähigkeiten entfalten können? Welche Kompetenzen müssen sie bereits in der Schule erwerben bzw. welche Fähigkeiten müssen sie als Voraussetzungen für das Weiterlernen außerhalb und nach der Schule erwerben, damit sie die eigene Berufsbiografie erfolgreich aufbauen und gestalten können? [/S. 110:]
Im Kontext dieser Veränderungen und Herausforderungen werden Ziele und Aufgaben der schulischen Berufsorientierung neu bestimmt. Ziele und Aufgaben gehen weit über Berufsorientierung als "Berufswahlhilfe und Bewerbungstraining" hinaus. Weil Lernen in der Schule nicht nur eine Frage der Inhalte ist, muss auch gefragt werden, ob die Arbeitsformen noch den Möglichkeiten entsprechen, die z. B. mit den neuen Medien gegeben sind. In den Lernorganisationen einer zeitgemäßen Berufsorientierung müssen Aufgabenverteilung, die Steuerung der Lernprozesse und die entsprechenden Erwartungen und Verpflichtungen auf Seiten der Lernenden und Lehrenden neu bestimmt werden. Eine zeitgemäße schulische Berufsorientierung sollte deshalb insbesondere folgende vier Grundsätze berücksichtigen:
Wenn Handlungspraktiken, Funktionen und Strukturen schulischen Lernens auf ein möglichst gutes Abschlusszeugnis ausgerichtet sind, werden Maßnahmen getroffen und Konzepte umgesetzt, die den Abschluss in den Blick nehmen und darauf bezogen zu bestmöglichen Ergebnissen führen. Die Lehrerinnen und Lehrer werden ihre Kreativität und Energien diesem Ziel entsprechend einsetzen. Die Schülerinnen und Schüler bereiten sich vor allem auf den Abschluss vor. Dabei werden sie zweifelsohne Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben. Von der Abschlussorientierung zur Anschlussorientierung heißt nicht, diese Qualität aufzugeben. Die Entwicklung der Qualifikationsanforderungen zeigt, dass ein hohes Niveau dieser Abschlussleistungen unabdingbar ist. Aber der Abschluss allein reicht nicht aus.
Für den Anschluss stärken ist mehr als auf den Abschluss hinarbeiten. Lernen in der Perspektive der Anschlussfähigkeit heißt den Schwerpunkt verlagern und im Abschluss einen Zwischenschritt zu sehen. Der Abschluss ist ein Meilenstein, aber kein Schlusspunkt. Der Anschluss ist das Ziel und muss gelingen. Damit wird die Wahrnehmung umfassender. Die Vorbereitung der nächsten an die Schule anschließenden Schritte, der erfolgreiche Einstieg und die Bewährung in Ausbildung und Beruf wird handlungsleitend. Rückmeldungen über den erfolgreichen Anschluss der Absolventen werden bei der Arbeit für den Abschluss einbezogen. Berufsorientierung in der Perspektive der Anschlussorientierung unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei der Steuerung und Planung des ersten Übergangs (Grundlage für die folgenden Übergänge) und des Weiterlernens. Sie nimmt die Organisation des Übergangs explizit als ihre Aufgabe wahr. [/S. 111:]
Berufsorientierung in der Perspektive der Anschlussorientierung fördert selbst gesteuertes Weiterlernen. Weiterlernen und Integration des an verschiedenen Orten erworbenen Wissens werden entscheidende Grundlagen für die individuelle Berufsbiografie. Bereits heute werden im Rahmen personalorientierter Unternehmensentwicklung neue Arbeitszeitmodelle und Lernzeitkonzepte erprobt. Lernen und Arbeiten gehen neue Verbindungen ein. Qualifizierungsvorteile erzielt, wer auch den Arbeitsplatz als Lernort nutzen kann. Berufsorientierung muss die Schülerinnen und Schüler deshalb mit der Aufgabe konfrontieren, die alltägliche Berufswelt auch als Lernort zu nutzen und Alltagserfahrungen systematisch auszuwerten.
Anschlussorientierung umfasst Anschlussplanung und -steuerung. Ein Anschluss ergibt sich zwar auch deshalb, weil es irgendwie immer weitergeht. Dies ist mit Anschlussplanung und -steuerung jedoch nicht gemeint. Es geht vielmehr darum, die nächsten Schritte bewusst zu planen und deren Realisierung zu sichern. Die Förderung und Entwicklung dieser Planungskompetenz ist explizit Aufgabe einer zeitgemäßen Berufsorientierung. Anschlussplanung und -steuerung werden explizit Lerngegenstand.
Berufsorientierung in der Perspektive der Anschlussorientierung bietet Lernsituationen, in denen die Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer Potenziale und Ziele Umsetzungsschritte planen und den Erfolg auswerten. Sie werden unterstützt, ihr Selbstbild zu klären und ihre Persönlichkeit zu stärken: Was will ich? Was kann ich? Was sind meine Stärken? Wie entwickle ich mein Qualifizierungsprofil? Wie plane ich meine Kompetenzentwicklung?
Die Schülerinnen und Schüler führen in ihrem Berufsorientierungsprozess selbst Regie. Dies muss ermöglicht und immer wieder verdeutlicht werden. Sie werden dabei jedoch nicht alleine gelassen, sondern von den Lehrerinnen und Lehrern in vielerlei Hinsicht unterstützt und begleitet. Aber sie übernehmen zunehmend mehr Verantwortung für ihren Lernweg und ihr Orientierungssystem. Sie werden als individuell und aktiv Lernende ernst genommen und mit der eigenen bewussten und unbewussten Lernorganisation konfrontiert. Die individuelle Lernorganisation wird zum Gegenstand des Lernens.
Wer Selbstverantwortung übernimmt, muss sich selbst kennen. Berufsorientierung unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei der Klärung ihres Selbstbildes, ihrer Interessen, Potenziale und Ziele. In entsprechenden Lernsituationen vergleichen die Schülerinnen und Schüler ihre Selbstwahrnehmung mit der Wahrnehmung der eigenen Person durch andere (Mitschüler, Lehrende, Eltern) und werten den Unterschied aus. Sie reflektieren und korrigieren ihr Selbstbild. Dieser Prozess wird im Rahmen der [/S. 112:] Berufsorientierung mehrmals wiederholt und die Veränderungen werden wahrgenommen. Das Zur-Kenntnis-Nehmen verdeutlicht Entwicklungen. Die Veränderungen und die Wahrnehmung der Veränderung sind wichtige Informationen und Motivation für die Entwicklung der Orientierungskompetenz.
Schülerinnen und Schüler müssen Eigeninitiative entwickeln. Die Lernsituationen müssen dafür Freiraum bieten. Eigeninitiative entwickeln und Lernprozesse selbst steuern bedeutet nicht, unabhängig von den Lehrenden über Inhalte und Lernwege zu entscheiden. Auch für selbst gesteuertes Lernen gelten Rahmenbedingungen, die die Lehrenden setzen und verantworten (vgl. Schiersmann 2001). Diese Rahmenbedingungen sind es aber, die den Unterschied zum traditionellen Lernen ausmachen. Sie werden von den Lehrenden bestimmt und definieren den Raum, in dem die Lernenden ihren Lernprozess selbst planen und realisieren und schließlich Prozess und Ergebnisse auswerten.
Es reicht heute angesichts der dominanten Trends für die Zukunft der Erwerbsarbeit nicht aus, nur lebenslang zu lernen. Das wäre weder neu noch eine Antwort auf die Herausforderungen. Neu an der Forderung nach lebenslangem Lernen ist die Professionalität, mit der der Einzelne sein Lernen organisieren muss und die Verantwortung für die Initiierung des Lernens - beides wird durch selbst gesteuertes Lernen gefördert und gilt für formales wie auch informelles Lernen gleichermaßen. Vorteile im Wettbewerb um Ausbildung und Arbeitsplätze wird erzielen, wer gelernt hat, das eigene Lernen zu optimieren und Lernanlässe, egal an welchen Orten, für sich zu nutzen, d. h. wer
Im Rahmen der Berufsorientierung kann in verschiedener Weise selbst gesteuertes Lernen ermöglicht werden, von der selbst geplanten Betriebserkundung mit Präsentation der Ergebnisse bis hin zur Bearbeitung einer besonderen (betrieblichen) Lernaufgabe, die die Schülerinnen und Schüler selbst konzipieren, mit den Lehrenden vereinbaren und am außerschulischen Lernort erstellen. Derartige "besondere Lernaufgaben" werden im Hamburger Schulversuch "Lernen und Arbeiten in Schule und Betrieb" seit dem Schuljahr 2000/01 entwickelt und erprobt (vgl. BSJB 2001a). An zwei Tagen in der Woche lernen und arbeiten die Schülerinnen und Schüler der letzten [S. 113:] beiden Schuljahre der Hauptschule bzw. im letzten Jahr der Realschule an außerschulischen Lernorten. Sie arbeiten jeweils ein halbes Jahr an einem Lernort, erkunden also vier bzw. zwei verschiedene Ausschnitte betrieblicher Wirklichkeit. Innerhalb der ersten vier Wochen im Betrieb entwickeln die Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer besonderen Interessen und Fähigkeiten eine Lernaufgabe, die mit dem Betrieb in einem Zusammenhang stehen muss. Die besondere Lernaufgabe wird mit den Lehrenden und den betrieblichen Anleitern abgestimmt und schriftlich vereinbart. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Lernaufgabe eigenverantwortlich und selbstständig. Dabei werden sie durch die betrieblichen Anleiter und die Lehrkräfte beraten und unterstützt. Die Lernaufgabe wird während der Praktikumszeit angefertigt, schriftlich dokumentiert und präsentiert. Die Lernleistung wird bewertet und geht als eigenständige Note in das Zeugnis ein. Lernaufgaben wie z. B. "Beschreibung des Baus unterschiedlicher Koffer (Cases) für spezifische Anforderungen der Kunden und Fertigung eines eigenen Cases" oder "Eigenständiges Einrichten eines Systems zum Sortieren von Normteilen in einer kleinen Metallwerkstatt" wurden erstellt. Die Schülerinnen und Schüler haben die Erwartungen übererfüllt. Auch leistungsschwache Schülerinnen und Schüler arbeiteten intensiv und erfolgreich an ihren Lernaufgaben. Die erste Auswertung zeigt, dass die Leistungen der Schülerinnen und Schüler insgesamt deutlich gestiegen sind. Selbst gesteuertes Lernen, eingebunden in einen dem jeweiligen Grad der Selbstständigkeit entsprechenden Rahmen, durch den die Anforderungen und Verpflichtungen klar geregelt sind und Bearbeitungsschritte vereinbart werden, motiviert zum Lernen und ermöglicht Erfolg. Die Schülerinnen und Schüler nehmen ihre erbrachte Leistung mit Stolz zur Kenntnis. Diese Erfahrungen unterstützen die Entwicklung der Lernfähigkeit und fördern individuelle Bildungsplanung. Eigeninitiative und Erfolg schaffen Lust auf Zukunft.
Zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler auf diesem Weg haben Hamburg und sechs weitere Bundesländer im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung [16] gemeinsam mit den Bundesländern gestalteten Programms "Schule - Wirtschaft/Arbeitsleben" [10]den Berufswahlpass (vgl. Lumpe 2002) entwickelt. Der Berufswahlpass ist ein DIN A4-Ordner und wird den Schülerinnen und Schülern im Jahrgang 7 überreicht. Jeder Schüler und jede Schülerin verwendet den Berufswahlpass eigenverantwortlich zur Gestaltung des Orientierungsprozesses. Der Berufswahlpass unterstützt sie dabei in dreifacher [/S. 114:] Hinsicht: Im ersten Teil stellt die jeweilige Schule ihr Programm zur Berufsorientierung dar und erhöht damit die Transparenz der berufsorientierenden Angebote. Selbstverständlich werden auch Informationen über die Berufsberatung der Arbeitsverwaltung und über die mit der Schule kooperierenden Partner aufgenommen. Die Schülerinnen und Schüler wissen rechtzeitig, was ihre Schule anbietet, wer weitere Angebote zur Verfügung stellen kann und welche Schritte sie individuell planen können. Mit dem ersten Teil des Berufswahlpasses erhalten die Schülerinnen und Schüler Informationen zur eigenverantwortlichen Planung ihrer beruflichen Orientierung. Im zweiten Teil bietet der Berufswahlpass Hinweise und Vorschläge zur Organisation des Lernens. Mit den Hinweisen wird der Berufsorientierungsprozess strukturiert und überschaubar. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Anregungen, wann sie welche Schritte planen sollten, wo sie Unterstützung erhalten und wie sie Ergebnisse auswerten können. Erst der dritte Teil ist ein Pass im eigentlichen Sinne und dient der Dokumentation der Leistungen, die für den Übergang in die Berufswelt von besonderer Relevanz sind. Auch hier wird den Schülerinnen und Schülern nur vorgeschlagen, welche erbrachten Leistungen sie selbst beschreiben und dokumentieren sollten und welche Leistungen sie sich bestätigen lassen sollten. Unter anderem wird angeregt, Beschreibungen von besonderen Arbeiten im berufsorientierenden Unterricht oder in Projekten einzuheften. Damit wird Schülerinnen und Schülern auch empfohlen, darüber nachzudenken, mit welchen schulischen Lernereignissen sie die eigene Qualifikation für einen Ausbildungsplatz in besonderer Weise nachweisen können. Darüber hinaus wird empfohlen, Bescheinigungen über ehrenamtliche Tätigkeiten, Jugendgruppenleitungstätigkeiten, über die Teilnahme an Volkshochschulkursen, Auslandsaufenthalten, Zertifikate über Kenntnisse im Bereich der neuen Medien und Bescheinigungen über Jobs aller Art und geleistete Betriebspraktika einzuheften. Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine Übersicht, was bedeutsam sein kann und entscheiden selbst, welche Anregung sie aufnehmen oder nicht. Der Berufswahlpass ist noch in der Entwicklungsphase. Die ersten Rückmeldungen bestätigen die Annahme, dass mit diesem Instrument der Berufswahlprozess strukturiert und die Selbstverantwortung der Schülerinnen und Schüler gefördert werden kann.
Berufsorientierung nutzt die vorhandenen Potenziale innerhalb und außerhalb der Schule für die Optimierung des Übergangs in den Beruf. Dies gelingt um so mehr, wenn die Ziele allen Beteiligten transparent sind, die einzelnen Aufgaben benannt sind, die Zusammenarbeit geregelt ist, die Erwartungen und Verpflichtungen der Beteiligten klar sind und die Verantwortung für die Aufgabenerfüllung abgesprochen ist. [/S. 115:]
Grundlage einer zeitgemäßen Berufsorientierung ist eine Vernetzung nach innen, d. h. entsprechende Kommunikations- und Kooperationsstrukturen innerhalb der Schule müssen vorhanden sein. Die Beteiligten sind nicht nur die Klassenlehrerinnen und -lehrer und die für Berufsorientierung zuständige Lehrerin bzw. der zuständige Lehrer. Eingebunden sind alle Lehrenden, die Schulleitung und auch die Lernenden selbst. Die für die Berufsorientierung verantwortlichen Personen sichern den Informationsfluss und sind Ansprechpartner für die außerschulischen Kooperationspartner. Sie unterstützen Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler, sie koordinieren einzelne Projekte und übernehmen Verantwortung für die Weiterentwicklung der schuleigenen Konzepte, einschließlich der Planung geeigneter Fortbildungsbedarfe. Die Vernetzung nach innen ist Voraussetzung dafür, dass Berufsorientierung nicht als Aufgabe des Klassenlehrers oder der Klassenlehrerin oder einzelner Fachlehrkräfte missverstanden, sondern als gemeinsame Bildungs- und Erziehungsaufgabe der Schule wahrgenommen werden kann.
Die Vernetzung nach außen ist Grundlage für die Einbeziehung der außerschulischen Partner in die schulische Arbeit. Dabei ist zu bedenken, dass Kooperationen mit Schulen bei vielen Partnern nicht zum Kerngeschäft gehören. Dennoch sind sie bereit, einen Beitrag zu leisten, wenn die Zusammenarbeit erleichtert wird.
Schulen und Unternehmen sind sich näher gekommen und arbeiten in Hamburg in vielfältiger Weise erfolgreich zusammen. Die Zusammenarbeit reicht von gemeinsam vorbereiteten Betriebserkundungen, Angeboten von Praktikumsplätzen für Schülerinnen und Schüler und auch für Lehrerinnen und Lehrer, der Einbeziehung betrieblicher Expertinnen und Experten in den Unterricht, gemeinsamen Arbeitsprojekten, Patenschaften zwischen Auszubildenden und Schülerinnen und Schülern, alljährlich wiederkehrenden Aktionen wie Ausbildungs- und Berufebörsen bis hin zu systematisch organisierter und langfristig angelegter Zusammenarbeit mit Zielvereinbarung und Ergebniskontrolle.
Von besonderer Bedeutung sind in Hamburg kontinuierlich arbeitende Kooperationspartnerschaften. In diesen Kooperationspartnerschaften schließen sich Schulen und Unternehmen zusammen und erarbeiten gemeinsam ein ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen entsprechendes Konzept. In Schule und Betrieb sind die für die Kooperation verantwortlichen Personen benannt und Unternehmensleitung und Schulleitung unterstützen die Partnerschaft. Die unterschiedlichen Bedingungen der Schulen und Betriebe gehen in die Kooperationsvereinbarung ein. Die abgesprochenen Vorhaben werden zu Beginn des Schuljahres vereinbart und am Ende ausgewertet. Dies führt zu Verlässlichkeit und zielgerichtetem Handeln. Die [/S. 116:] Kooperationsvereinbarungen unterscheiden sich. Das ist jedoch kein Nachteil, sondern Ausdruck des flexiblen Verfahrens.
Hamburger Schulen haben sich für die Mitwirkung des schulischen Umfelds an der Bildungs- und Erziehungsarbeit geöffnet. Sie werben dafür, dass neben den Betrieben Vereine und Organisationen im Stadtteil an der Gestaltung und Entwicklung des Lernens in der Schule teilhaben (vgl. BSJB 2001b). Die Öffnung ist eine Herausforderung an alle Beteiligten, ihr Verhältnis und ihr Selbstverständnis gegenüber der Schule neu zu bestimmen. In der Kooperation lernen alle Beteiligten von- und miteinander. Die Schulen und ihre Partner werden dabei von vielen Seiten unterstützt: einzelne Unternehmen, Unternehmensverbände, die Landesarbeitsgemeinschaft Schule-Wirtschaft, [31] das Institut für Lehrerfortbildung [32], die Handelskammer und die Handwerkskammer, die Wirtschaftsbehörde und auch die Eltern-, SchülerInnen- und Lehrerkammer.
In mehreren Netzwerken arbeiten Unternehmen mit Schulen zusammen. Mit dem Verband "Deutscher Maschinen und Anlagenbau e.V." (VDMA) [33] wurden Kooperationspartnerschaften zwischen Schulen, Unternehmen und Hochschulen gegründet, mit dem "Hamburger Industriebverband e.V." wurde das "Netzwerk Schule-Industrie" [34] gegründet, in dem 20 Kooperationspartnerschaften vernetzt sind und die "Initiative für Beschäftigung - Netzwerk Hamburg" betreut seit Sommer 2000 das jüngste Netzwerk mit zehn Kooperationspartnerschaften zwischen Unternehmen und Haupt-, Real- und Gesamtschulen zur Stärkung der Hauptschülerinnen und Hauptschüler. In jedem Netzwerk arbeiten die Kooperationsgemeinschaften unter einem bestimmten Schwerpunktthema zusammen (vgl. BSJB 2001a).
Im Netzwerk Schule-Industrie arbeiten jeweils eine Schule und ein Unternehmen zusammen und entwickeln gemeinsam das schulische Berufsorientierungskonzept weiter. Einbezogen sind dabei Patenschaften zwischen Schülerinnen und Schülern und Auszubildenden, die Vermittlung spezifischer Praktika für Lernende und Lehrende bis hin zum gegenseitigen Angebot der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen.
Im Netzwerk Hamburg der Initiative für Beschäftigung arbeiten Schulen, Berufsberatung und Personalverantwortliche sowie Fachkräfte der Unternehmen nach einem gemeinsam entwickelten Konzept zusammen, das die jeweiligen Kompetenzen der Partner verlässlich in den Berufsorientierungsprozess einbezieht. In dem 3-Säulen-Modell übernimmt jeder Partner Aufgaben entsprechend seiner Kompetenz. Die Schule trägt insbesondere zur Klärung der Interessen und Stärken der Schülerinnen und Schüler bei, die Berufsberatung sorgt für die Beratung und eine den Stärken entsprechende Vermittlung und die Personalfachleute der Partnerunternehmen beraten die [/S. 117:] Schülerinnen und Schüler, geben ihr Feedback zum Stand der Ausbildungsfähigkeit und bescheinigen aus Sicht der Personalfachkraft Chancen und Eignung für den gewünschten Ausbildungsberuf. Die einzelnen Schritte der drei Partner sind abgestimmt, jeder übernimmt einen Part auf dem Weg in die Berufsausbildung. Sie werden dabei unterstützt durch eine Koordinierungsstelle, die die einzelnen Beratungsschritte koordiniert, den Informationsaustausch sicherstellt und über ein Controllingsystem die Anschlussprozesse steuert. Die Schülerinnen und Schüler werden bei der Suche eines Ausbildungsplatzes von den Partnern unterstützt und je nach individuellem Betreuungsbedarf begleitet und gefördert. Die beteiligten Unternehmen haben sich öffentlich verpflichtet, jährlich mindestens 200 Ausbildungsplätze für die Hauptschulabsolventinnen und Absolventen der Partnerschulen zur Verfügung zu stellen. Nach der erfolgreichen Erprobungsphase wird das Modell im Schuljahr 2001/02 auf 30 Partnerschaften und - so die Planung - in den folgenden beiden Jahren um weitere 30 Partnerschaften erweitert.
Im Netzwerk TRANS-JOB [35] (vgl. BSJB 2001a, S. 6 ff.) arbeiten Schulen und Unternehmen ebenfalls langfristig und kontinuierlich zusammen. Auch hier vereinbaren die Schulen und das Partnerunternehmen konkrete Schritte und werten den Erfolg aus. TRANS-JOB ist bundesweit vernetzt und Teil des Programms des Bundesministeriums für Bildung und Forschung [16] "Schule - Wirtschaft/Arbeitsleben" [10] und wird von der Stiftung der deutschen Wirtschaft [36] durchgeführt. In diesem Netzwerk kooperieren Schulen und Unternehmen vor allem mit dem Ziel, Konzepte zur ökonomischen Allgemeinbildung zu entwickeln und zu erproben.
Im "Service-Netzwerk-Beratung" (vgl. BSJB 2001a, S. 22 f.), ein Netzwerk, in das auch die Hochschulen eingebunden sind, arbeiten Teams, bestehend aus jeweils einer Schule, einer Hochschule und einem Unternehmen, bildungsbereichsübergreifend und kontinuierlich zusammen. Die Teams entwickeln Lernarrangements zur Förderung selbst gesteuerten Lernens. Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende bearbeiten gemeinsam komplexe Aufgabenstellungen, lernen dabei die jeweils andere Arbeitsumgebung und das Berufsfeld kennen und optimieren in der Zusammenarbeit die eigenen Lernstrategien. Das Projekt ist in das BLK-Programm "Lebenslanges Lernen" [37] eingebunden und beginnt im Schuljahr 2001/02 mit der Umsetzungsphase.
Die beschriebenen Partnerschaften sind Beispiele für Vernetzungen und verdeutlichen den an eine Vernetzung gestellten Anspruch. Grundlage der Vernetzung sind die jeweils verfügbaren Leistungen der Partner. Diese werden nicht als einmalige Aktionen in das schulische Curriculum einbezogen, sondern systematisch und langfristig. Die konkreten Handlungsschritte werden gemeinsam geplant, vereinbart und ausgewertet. [/S. 118:]
Die Erfahrungen der Kooperationspartnerschaften bestätigen das Konzept der Kontinuität und Verlässlichkeit. Die Verantwortlichen im Unternehmen und in der Schule treffen sich rechtzeitig. Die Schule trägt vor, wobei sie Unterstützung durch das Unternehmen benötigt. Das Unternehmen berichtet über die bestehenden Möglichkeiten. Oft ergeben sich schon bei diesem Gespräch Kooperationsmöglichkeiten, die keiner der Partner vorhergesehen hatte. Die vorgetragenen Wünsche werden zu konkreten Vereinbarungen mit festen Zeitplänen. Mit der Vereinbarung verpflichten sich die Partner nicht im rechtlichen Sinne, sondern dokumentieren und kommunizieren den jeweiligen Einsatz und die Erwartungen. Mit ihr wird die Ernsthaftigkeit ausgewiesen und sie dient als Maßstab für die Bewertung der Zielerreichung am Ende des Schuljahres. Erfolgreiche Kooperationen werten den Erfolg aus. Sie überprüfen die Planung, nehmen die Ergebnisse ihrer Arbeit zur Kenntnis und freuen sich auch über den gemeinsamen Erfolg.
In den verschiedenen Netzwerken ist die Berufsberatung der Arbeitsverwaltung in unterschiedlichen Formen Kooperationspartner. Berufsorientierung in der Schule ist ohne Kooperation mit den Berufsberaterinnen und Berufsberatern nicht denkbar. Ihre Arbeit an den Schulen ist unentbehrlich (vgl. Strijewski 2002a, 2002b). Im Rahmen der Berufsorientierung übernimmt die Berufsberatung die zentrale Aufgabe der allgemeinen Berufsorientierung und der individuellen Beratung.
Die wichtigsten Partner der Jugendlichen bei ihrer beruflichen Orientierung sind die Eltern. Untersuchungen zeigen, dass die Berufswahl der Jugendlichen zu einem großen Teil auf dem Einfluss der Eltern und des häuslichen Umfeldes beruht (vgl. Hoose/ Vorholt 1996). Eine Schule, die ihr Angebot zur beruflichen Orientierung optimieren möchte, widmet daher der Zusammenarbeit mit den Eltern ganz besondere Aufmerksamkeit (vgl. Buck/ Nastaly 2002). Die Entwicklung neuer Konzepte zur Zusammenarbeit mit den Eltern und dem häuslichen Umfeld unterstützt die Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung [38] mit besonderen Projekten. Einzelne Schulen erarbeiten und erproben gemeinsam mit den Eltern verschiedene Modelle von Elterntreffen zu berufsorientierenden Themen über besondere Elternabende, Fortbildung für Elternvertreter und -vertreterinnen, Mitwirkung der Eltern im Unterricht oder bei besonderen Veranstaltungen bis hin zum Aufbau einer Datenbank durch Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler zu Fragen der Berufsorientierung.
Weiterentwicklung beginnt meist mit der Bilanzierung der Praxis, mit der Auswertung der Ergebnisse. Was weiß eine Schule aber systematisch über [/S. 119:] das Ergebnis, d. h. den Verbleib ihrer Schülerinnen und Schüler? Mit welchen systematisch erhobenen Informationen verschaffen sich die Lehrerinnen und Lehrer ein Bild über den Stand der Anschlussplanung ihres Schülers oder ihrer Schülerin? Sind die Informationen für alle Lehrerinnen und Lehrer des Schülers bzw. der Schülerin zugänglich? Welche Informationen haben die Schulen über Ausbildungsabbrüche und deren Gründe und welche Informationen haben die Schulen über die Entwicklung dieser Größen? Diese Fragen führen zur dahinter liegenden Frage nach den Chancen der Lehrerinnen und Lehrer, aus diesen Informationen lernen und Konsequenzen für die Weiterentwicklung der Lernsituationen ziehen zu können. Fehlende Informationen verhindern Lernmöglichkeiten. Solange die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer einer Lerngruppe über keine Informationen zum Stand der Anschlussplanung der einzelnen Schülerinnen und Schüler verfügen, können sie nicht zur Optimierung des Anschlusses beitragen. Der Schüler oder die Schülerin entwickelt in diesem Falle seine bzw. ihre Orientierungskompetenz in Lernkontexten, die nicht auf die Entwicklung der Orientierungskompetenz abgestimmt sind.
Damit die Schule ihr Konzept an der Realität orientiert weiterentwickeln kann, muss sie Informationen über den Verbleib ihrer Schülerinnen und Schüler erheben und die Lehrerinnen und Lehrer einer Klasse müssen über den jeweiligen Stand der individuellen Anschlussplanung ihrer Schülerinnen und Schüler informiert sein. Dies ist Voraussetzung, um den Schüler bzw. die Schülerin zielgerichtet und abgestimmt auf den individuellen Bedarf beraten und ihn bzw. sie bei der Entwicklung der Orientierungskompetenz unterstützen zu können.
Über den Stand der jeweiligen Anschlussplanung können sich die Lehrerinnen und Lehrer durch verschiedene Instrumente, vom einfachen Planungsbogen über ein individuell mit dem Schüler oder der Schülerin aufgestelltes Lernprogramm mit Lernvereinbarung bis hin zu einem speziellen Lerntagebuch, in dem der Prozess der Berufsorientierung vorstrukturiert sein kann, informieren. Gemeinsam ist den verschiedenen Instrumenten, dass mit ihrer Hilfe die Anschlussplanung zum Thema des Unterrichts wird. Mit den Instrumenten kann auf die konkreten individuellen Bedürfnisse des einzelnen Schülers bzw. der einzelnen Schülerin bezogen die Anschlussplanung strukturiert und je nach dem Grad der Selbstständigkeit von den Lehrenden gesteuert und kontrolliert werden. Der Berufswahlpass unterstützt diese Anschlussplanung. Die Lehrenden können darin ihr Begleitkonzept (systematisierte Ablaufplanung mit definierten Meilensteinen, Hinweise auf schulische und außerschulische Unterstützungssysteme, Angebote besonderer Lernbausteine zum Abbau individueller Lerndefizite, Anschlussplanung unter Einbeziehung der Eltern, Lernvereinbarung zur Anschlusssteuerung u. a. m.) [/S. 120:] vorstellen und gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern geeignete Wege entwickeln.
Im "Hamburgischen Schulgesetz" vom 16. April 1997 ist in § 2 Absatz 3 der Bezug des schulischen Lernens zur Arbeits- und Berufswelt ausgeweitet: "Auf allen Schulstufen und in allen Schulformen der allgemein bildenden Schulen ist in altersgemäßer Form in die Arbeits- und Berufswelt einzuführen und eine umfassende berufliche Orientierung zu gewährleisten. Dabei sind den Schülerinnen und Schülern grundlegende Kenntnisse über die Struktur der Berufs- und Arbeitswelt und die Bedingungen ihres Wandels zu vermitteln." Berufsorientierung ist für alle Schülerinnen und Schüler Gegenstand des schulischen Lernens.
Im Hamburgischen Schulgesetz werden besondere Bildungs- und Erziehungsaufgaben zu Aufgabengebieten zusammengefasst, die im Rahmen des Unterrichts in verschiedenen Fächern und Jahrgangsstufen, in fächerverbindenden Lernsituationen, in Projekten und im Schulalltag Gegenstand des Lernens werden. Berufsorientierung ist ein Aufgabengebiet (vgl. HambSG, § 5 Absatz 3) und damit Auftrag aller Lehrerinnen und Lehrer einer Schule. Mit der "Verordnung über die Stundentafeln für die Sekundarstufe I" vom 1. August 1999 wird Berufsorientierung darüber hinaus in allen Schulformen als Unterrichtsinhalt in einem Fach im Pflichtbereich aufgenommen. Das Fach Arbeitslehre wird zu Arbeitslehre/ Berufsorientierung (Haupt-, Real- und Gesamtschulen) und das Fach Sozialkunde zu Sozialkunde/ Berufsorientierung (Gymnasien) erweitert. Darüber hinaus haben die Schulen die Möglichkeit, Berufsorientierung im Wahlpflichtbereich anzubieten.
Mit der "Verordnung über die Stundentafeln für die Sekundarstufe I" wurden für jede Schulform so genannte Flexibilisierungsstundentafeln eingeführt. Jede Schule kann innerhalb festgelegter Grenzen die Stundenverteilung entsprechend ihres besonderen Schwerpunkts in der Bildungs- und Erziehungsarbeit selbst bestimmen und das Stundenvolumen z. B. für das Fach Arbeitslehre/ Berufsorientierung erhöhen. Eine Schule kann vor dem Hintergrund der besonderen Situation der Schülerinnen und Schüler die Unterrichtsverteilung gestalten. Sie hat z. B. den Spielraum, einen Tag je Woche als Projekt- bzw. Praktikumstag anzubieten, an dem die Schülerinnen und Schüler entweder in der Schule oder an außerschulischen Lernorten arbeiten und lernen können. [/S. 121:]
Jede Hamburger Schule legt in ihrem Schulprogramm die besonderen Ziele, Schwerpunkte und Organisationsformen ihrer pädagogischen Arbeit sowie Kriterien für die Zielerreichung fest (vgl. HamSG, § 51). Sie konkretisiert darin den allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauftrag im Hinblick auf die spezifischen Voraussetzungen und Merkmale ihrer Schülerschaft und die spezifischen Gegebenheiten der Schule und ihres regionalen Umfelds. Viele Hamburger Schulen haben Berufsorientierung als Schwerpunkt ihrer Schulentwicklung ausgewiesen.
Der inhaltliche Rahmen für die Bildungs- und Erziehungsaufgaben ist in Bildungsplänen für die einzelnen Schulformen festgelegt. Die Bildungspläne werden derzeit entwickelt. Die Lehrpläne der Fächer werden überarbeitet und im Bildungsplan der jeweiligen Schulform zusammengefasst. Die Bildungsplanentwürfe für die Sekundarstufe I liegen zum Teil bereits vor, sie enthalten jeweils einen allgemeinen Teil und die Rahmenpläne der Fächer und Aufgabengebiete. In den Rahmenplänen der Fächer wird Berufsorientierung als Aufgabe des jeweiligen Faches ausgewiesen. Darüber hinaus wird erstmals für das Aufgabengebiet Berufsorientierung ein eigener Rahmenplan erstellt. Darin wird der Auftrag des berufsorientierenden Unterrichts beschrieben und es werden Ziele, Grundsätze für die Gestaltung der Lernsituationen, verpflichtende Themen und Anforderungen festgelegt. Die Bildungspläne für die Sekundarstufe I werden ab dem Schuljahr 2002/03 an den Schulen erprobt.
Die Schulen erhalten mit den Rahmenplänen einerseits einen festen curricularen Rahmen, andererseits erhalten sie die Möglichkeit, ein spezifisches Lernangebot umzusetzen, das den Anforderungen ihrer Schülerschaft und ihres Umfeldes gerecht wird. Der mit den Bildungsplänen gesetzte Rahmen wird von den Schulen durch schulinterne Planungen gefüllt. Die Bildungspläne erfordern somit eine gemeinsame Absprache innerhalb des Kollegiums. Durch die gemeinsame Festlegung wird die Zusammenarbeit im Schuljahr erleichtert und das Unterrichtsgeschehen für alle Beteiligten, für die Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und für die externen Partner, transparent.
Jede Schule geht den eigenen Weg, entscheidet über Konzept und konkrete Ausgestaltung der Angebote zur beruflichen Orientierung. Die schulischen Konzepte zur Berufsorientierung sind deshalb nicht nur schulformbezogen unterschiedlich. Sie unterscheiden sich auch innerhalb der Schulformen und berücksichtigen regionale Besonderheiten. Dennoch hat sich in der Praxis ein alle Schulformen umfassender Konsens über zentrale Elemente der Berufsorientierung entwickelt. An allen Hamburger Schulen ist Berufsorientierung Gegenstand des Fachunterrichts und vielfältiger Veranstaltungen im Schulleben, alle Schulen führen ein bis zwei Betriebspraktika durch, binden [/S. 122:] die Angebote der Berufsberatung der Arbeitsämter [1] und des Berufsinformationszentrums [30] ein, kooperieren mit Betrieben und Eltern. Darüber hinaus bieten die Schulen verschiedene Bausteine zur Berufsorientierung von Betriebsbesichtigungen, Projektwochen zu bestimmten Themen, Sprechstunden für Kolleginnen und Kollegen zu berufsorientierenden Fragen, Bewerbungstraining und Lebensplanungsseminare über Uni-Tage und Berufemessen bis hin zur Bearbeitung von Realaufträgen, die die Schülerinnen und Schüler oft gemeinsam mit Auszubildenden bearbeiten (vgl. BSJB 2001a).
Mit den Rahmenbedingungen wird ein Kerncurriculum Berufsorientierung gesichert und der erforderliche Freiraum für spezifische Gestaltungserfordernisse gegeben.
Berufswahl ist subjektiv, ist rational und arbeitsmarktorientiert, ist aber auch emotional bestimmt und den Betroffenen sind die Entscheidungsgrundlagen oft auch nicht bewusst. Viele Faktoren außerhalb der Schule, insbesondere das familiäre Umfeld und der Freundeskreis beeinflussen die Berufsorientierung und die Berufswahl. Der Einfluss der schulischen Berufsorientierung ist nicht eindeutig bestimmbar. Dies im Blick zu behalten schützt vor Überschätzung, fordert aber auch heraus, durch neues Lernen im Rahmen der schulischen Berufsorientierung die Schülerinnen und Schülern bei der Gestaltung ihres Übergangs in die Berufs- und Arbeitswelt bestmöglich zu unterstützen.
Das neue Lernen in einer zeitgemäßen Berufsorientierung kann durch folgende Aufgaben bzw. Forderungen zusammengefasst werden:
BSJB (Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung) (2001a): Berufsorientierung in Hamburg. Projekte, Beispiele und Ideen zum neuen Lernen in der Berufsorientierung, Hamburg
BSJB (Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung) (2001b): Schule und Stadtteil (Handreichung), Hamburg
Buck, A.; Nastaly, R. (2002): "Manche Dinge gehen nur gemeinsam". Integrative Mitarbeit der Eltern im Prozess der Berufswahlvorbereitung, in Schudy, J.: Berufsorientierung in der Schule, Grundlagen und Praxisbeispiele, Bad Heilbronn, S. 261 - 268
Hoose, D.; Vorholt, D. (1996): Sicher sind wir wichtig - irgendwie!? Der Einfluss von Eltern auf das Berufswahlverhalten von Mädchen", Eine Untersuchung im Auftrag des Senatsamtes für die Gleichstellung, Hamburg
Lumpe, A. (2002): Der Berufswahlpass. Ein Instrument zum selbstorganisierten und eigenverantwortlichen Lernen, in: Schudy, J. (Hrsg.): Berufsorientierung in der Schule. Grundlagen und Praxisbeispiele, Bad Heilbrunn/ Obb., S. 253 - 260
Schiersmann, C. (2001): Selbststeuerung als Leitbild für die Weiterbildung, in: Forum Bildung: Bildungs- und Qualifikationsziele von morgen. Vorläufige Leitsätze und Expertenbericht, Band 5
Schober, K. (2001): Berufsorientierung -
Vorbereitung auf eine veränderte Arbeitswelt, in:
Wissenschaftliche Begleitung des Programms "Schule - Wirtschaft/
Arbeitsleben" (Hrsg.): "Schule - Wirtschaft/ Arbeitsleben".
Dokumentation 2. Fachtagung Bielefeld 30.05.2001 - 31.05.2001. SWA-Materialien
Nr. 7, Bielefeld 2001, S. 7 - 38
Strijewski, C. (2002a): Berufsorientierung in der Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung. Der Beitrag der Arbeitsämter, in: Schudy, J.: Berufsorientierung in der Schule, Grundlagen und Praxisbeispiele, Bad Heilbronn, S. 85 - 106
Strijewski, C. (2002b): Medien der Bundesanstalt für Arbeit zur Berufsorientierung und zur Selbstinformation, in: Schudy, J.: Berufsorientierung in der Schule, Grundlagen und Praxisbeispiele, Bad Heilbronn, S. 323 - 327
Professor am Fachbereich Berufsbildungs-, Sozial- und Rechtswissenschaften der Universität Kassel mit dem Fachgebiet "Arbeitslehre und Pädagogik der Arbeitswelt".
Professor (em.) am Institut für Politik und Wirtschaft und ihre Didaktik der Universität Flensburg.
Privatdozent am Fachbereich Sozialwissenschaften und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut Arbeit und Wirtschaft an der Universität Bremen mit dem Forschungsschwerpunkt "Arbeitsbeziehungen und Arbeitssoziologie".
Leiter des Arbeitsbereichs "Berufs- und Qualifikationsforschung" am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit.
Professor und Direktor am Institut für Politik und Wirtschaft und ihre Didaktik der Universität Flensburg, Fachgebiet "Wirtschaftswissenschaften und ihre Didaktik" sowie Leiter der wissenschaftlichen Begleitung des Programms "Schule - Wirtschaft/ Arbeitsleben".
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Arbeitsbereich "Bildungsverhalten, Berufsverläufe, Zielgruppenanalyse" am Bundesinstitut für Berufsbildung.
Ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin im Arbeitsbereich "Bildungsverhalten, Berufsverläufe, Zielgruppenanalyse" am Bundesinstitut für Berufsbildung.
Leiter des Praktikumsbüros am Zentrum für Lehrerbildung an der Universität Bielefeld und Mitherausgeber von "sowi-online".
Professorin am Pädagogischen Seminar der Universität Göttingen mit dem Forschungsschwerpunkt "Erziehungs- und sozialwissenschaftliche Geschlechterforschung".
Oberschulrat und Leiter des Referats "Entwicklung und Gestaltung von Unterricht und Erziehung" am Amt für Schule der Behörde für Bildung und Sport der Freien und Hansestadt Hamburg.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik
(BIAT)
der Universität Flensburg.
Professor (em.) am Institut für Berufs- und Wirtschaftspädagogik am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Universität Hamburg.
Leiterin des Referats "Berufsberatung und Berufsorientierung" der Bundesanstalt für Arbeit.
Professorin am Institut für Soziologie der Universität Siegen.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Programms "Schule - Wirtschaft/ Arbeitsleben" am Institut für Politik und Wirtschaft und ihre Didaktik an der Universität Flensburg.
Ehemaliger Referatsleiter im Arbeitsbereich "Berufs- und Qualifikationsforschung" am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit.
Berufsforscher im Arbeitsbereich "Berufs- und Qualifikationsforschung" am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit.
Links
[1] http://www.arbeitsamt.de/
[2] http://www.iab.de/
[3] http://www.destatis.de/
[4] http://www.arbeitsamt.de/laa_sat/
[5] http://www.arbeitsamt.de/hst/services/veroeffentl/berufskunde.html
[6] http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/
[7] http://www.bma.de/
[8] https://sowi-online.de/images/dostal-ueb6.gif
[9] http://www.iab.de/iab/default.htm
[10] http://www.swa-programm.de/
[11] http://www.kmk.org/
[12] http://www.arbeitsamt.de/hst/index.html
[13] http://www.hrk.de/
[14] http://www.bmfsfj.de/
[15] http://cgi.dji.de/cgi-bin/inklude.php?inklude=dasdji/welcome_inc.htm
[16] http://www.bmbf.de/
[17] http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index-de.htm
[18] http://www.bibb.de/
[19] http://www.tns-emnid.com/index1.html
[20] http://www.swa-programm.de
[21] http://www.bibb.de/redaktion/erste_schwelle/6_2001/meldung6_2001.htm
[22] http://www.bibb.de/redaktion/erste_schwelle/11_2001/meldung11_2001.htm
[23] http://www.iris-egris.de/projekte/sackgassen/tserkurz.phtml
[24] http://www.bawue.gew.de/sondpaed/
[25] http://www.bibb.de/ibqm/
[26] http://www.bibb.de/forum/fram_fo1.htm
[27] http://www.bmbf.de/677_3707.html
[28] mailto:pr@bibb.de
[29] http://www.bundesregierung.de/
[30] http://www.arbeitsamt.de/hst/services/bsw/biz/
[31] http://www.schule-wirtschaft-hamburg.de/
[32] http://www.ifl-hamburg.de/
[33] http://www.vdma.de/
[34] http://www.schule-wirtschaft-hamburg.de/netzwerk-si/
[35] http://www.sdw.org/SDW/SDWCMS.nsf/pagesde/Einstiegsseite%20TRANS%20-%20JOB
[36] http://www.sdw.org/SDW/SDWCMS.nsf/framesets/Start
[37] http://www.blk-lll.de/LLL/programm.htm
[38] http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/soziales-familie/jugend-und-familie/start.html