Historische und politische Bildung
Sie können den gesamten Reader als ZIP Datei hier herunterladen. In der ZIP Datei finden Sie HTML Dateien zur Ansicht.
Einführung
Reinhold Hedtke, Dietmar von Reeken (Hg.): Historische und politische Bildung. Ein sowi-online-Reader.
Bielefeld 2005, ISSN 1617-1985
In diesem Reader dokumentiert sowi-online grundlegende Beiträge zum Problem des Verhältnisses von historischer und politischer Bildung seit den 1970er Jahren. Dieses Verhältnis ist nicht nur ein theoretisches oder ein wissenschaftliches Problem, das Fachdidaktiker beider Seiten beschäftigt, sondern es spielt auch eine große Rolle in der Unterrichtsrealität an unterschiedlichen Schulformen: Vor allem in den nicht-gymnasialen Schulformen werden in zahlreichen Bundesländern Integrationsfächer unterrichtet ("Geschichtlich-soziale Weltkunde", "Geschichte-Politik" usw.), ohne dass das Integrationsproblem (vgl. sowi-onlinereader "Das Integrationsproblem der sozialwissenschaftlichen Fächer") bislang gelöst worden wäre. Aber auch wenn beide Schulfächer getrennt angeboten werden, stellt sich die Frage nach der "Einheit der Sozialwissenschaften" und den Konsequenzen, den eine solche – nicht unumstrittene – Einheit für das Verhältnis der beiden Fächer haben könnte oder sollte; neuere Entwicklungen in der Geschichtswissenschaft, durch die sich die Disziplin zum Teil stärker als Kultur- denn als Sozialwissenschaft versteht, verschärfen diese Frage noch.
sowi-onlinereader möchte vor diesem Hintergrund mit dieser Dokumentation die fachdidaktische Diskussion durch die Bereitstellung zentraler "klassischer" Texte sowie einiger neuer Originalbeiträge befruchten und darüber hinaus diese Beiträge auch für fachdidaktische Lehrveranstaltungen an den Hochschulen und für die fachdidaktische Ausbildung in den Fachseminaren des Referendariats leichter zugänglich machen.
Beiträge 1970-1979
Behrmann, Günter C., Jeismann, Karl Ernst, Süssmuth, Hans (1978): Geschichte und Politik. Didaktische Grundlegung eines kooperativen Unterrichts
1. Einleitung
1.1 Zur Situation der Didaktik des historischen und politischen Unterrichts
Seit einigen Jahren kündigt sich der Beginn einer neuen Epoche in der Geschichte der deutschen Schule an. Das gilt sowohl für ihre Organisationsformen und ihre Einpassung in die sozialen Veränderungen, für den gesamten Lehrplan wie für den Fachunterricht; es gilt in besonderer Weise für den geschichtlichen und politischen Unterricht.
Den Vorzug, Geschichtsunterricht genießen zu dürfen und politische Aufklärung intentional zu erhalten, hatten in der Geschichte lange Zeit nur die unmittelbar oder mittelbar an der Herrschaft beteiligten Gruppen. Geschichtsunterricht war zunächst der Fürstenerziehung vorbehalten, wurde an den Ritterakademien eingeführt und drang schließlich am Ende des 18. Jahrhunderts in die gelehrten bürgerlichen Schulen ein. Erst spät, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wurde der historisch-biblische Unterricht der Volksschulen nach und nach durch weltlichen Geschichtsunterricht ergänzt. Ein, nicht nur historisch angeleiteter, die je bestehende politische Ordnung wie die Rechte und Pflichten der Bürger behandelnder politischer Unterricht wurde schließlich in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts in den Fächerkanon der Schulen aufgenommen. Zumal im deutschen Schulwesen hielt sich bis in unsere Tage – deutlicher noch im Geschichtsunterricht als im sozialkundlich-politischen Unterricht – eine Zweischichtung: dem "Gebildeten" wurde ein anderes Geschichtsbild in der Schule zuteil als dem "Volk". Der historische Unterricht in den Volksschulen orientierte sich in der Praxis an einem anderen Verständnis der Bürgerrolle als an den Gymnasien. Die Aufhebung dieses Unterschiedes, die der Ausweitung der politischen Grundrechte auf alle Bürger, nunmehr auch die jungen Bürger, nachfolgt, würde allein schon genügen, um die Didaktik des Geschichtsunterrichts, teilweise auch des politischen Unterrichts vor eine neue und notwendige Aufgabe zu stellen. Der politische Unterricht im eigentlichen Sinne beginnt überhaupt erst auf der Basis potentieller demokratischer Teilhabe aller an der politischen Willensbildung. Deshalb wird hier eine didaktische Grundlegung nicht für bestimmte Schularten, sondern für den Geschichts- und Politikunterricht aller Schulen versucht.
In einem ersten Arbeitsvorhaben werden Unterrichtseinheiten für die Sekundarstufe I (einschließlich der Förderstufe) vorgelegt. Sie richten sich gleicherweise an alle Schüler – auch wenn in der Schulorganisation der Länder nach wie vor große äußerliche und innerliche Unterschiede zwischen den Schularten dieser Stufe bestehen. Sie überwinden zu helfen und damit eine breite Fundierung historisch-politischer Bildung aller Heranwachsender ohne schul- oder schichtenspezifische Differenzierung durch den Unterricht voranzutreiben – dies aber auf einem Anspruchsniveau zu versuchen, das der Bedeutung dieser Fundierung entspricht – ist das erste Anliegen dieses Vorhabens. Ein differenzierteres Angebot für die Sekundarstufe II (Leistungs- und Grundkurse) wird folgen. Für Leistungskurse der Sekundarstufe II und für den akademischen Unterricht ist eine Reihe dieses Werkes mit dem Untertitel "Quellen und Forschungen" vorgesehen.(1) [/S. 12:]
Die Herausforderung der Didaktik der Geschichte wie einer von ihr nur um den Preis einer fachwidrigen Verengung der Problemstellung zu trennenden Didaktik der Politik wird verschärft durch die schon oft dargestellten und in ihrer Bedeutung für Wissenschaft und Unterricht gewürdigten besonderen Tatsachen der deutschen Geschichte einerseits, der weltpolitischen Verschiebungen andererseits. Darum muß hier nicht mehr ausgeführt werden, wie der Schock des Verlustes des nationalen Geschichtsbildes nach 1945, wie die schon über die Ereignisse von 1933 und 1918 zurückreichenden Erschütterungen des Vergangenheitsverständnisses dem geschichtlichen und politischen Unterricht in deutschen Schulen die selbstverständlich und unbefragt geltende Basis der geschichtlichen Identität entzogen; es muß nicht mehr dargelegt werden, wie die deutsche Teilung als Symptom einer universalen weltpolitischen Frontenbildung, wie das ständig sich neu Herausbilden unerwarteter und noch schwer faßbarer politisch-geschichtlicher Entwicklungen in einer immer mehr auf Verflechtung und Wechselwirkung entfernter Faktoren tendierenden Welt auch den alten, europäischen Rahmen des nationalen Geschichtsbildes sprengt. Schließlich muß nicht mehr nachgewiesen werden, daß sowohl mit der Entwicklung der Sozialwissenschaften und der Metamorphose der Geschichtswissenschaft in den letzten Jahren, wie auch mit der erst jüngst wieder erkannten und unmittelbaren Bedeutung historischer Analysen, jene Urteile und Wertungen, welche die politische Gegenwart und die Zukunft mitbetreffen, neu und kontrovers diskutiert werden. Die "Reideologisierung" der politischen Auseinandersetzung macht nicht nur den politischen Unterricht, sondern in gleichem Maße auch den Geschichtsunterricht zu einer Stätte der Auseinandersetzung unterschiedlicher politischer Tendenzen.(2)
Längst ist unter dem Eindruck dieser Vorgänge die Tatsache wieder anerkannt, daß didaktische Konzeptionen des historischen und politischen Unterrichts keine bloß pädagogischen, nur didaktischen Angelegenheiten sind, sondern politische Positionen bezeichnen. Das war auch in der Vergangenheit so, wenngleich eine durch die Erfahrungen nach 1933 nicht ohne Grund den politischen Zugriff abwehrende Didaktik diese enge Verbindung von Politik und Pädagogik leugnen mochte. Indessen ist die bloße Wiederholung der Feststellung des Zusammenhangs zwischen Unterricht und Politik in dieser Allgemeinheit doch schon wieder ein Zeichen der Unschärfe des Denkens geworden. Sie bleibt in ihrer Allgemeinheit entweder leer oder dient der Rechtfertigung unmittelbarer politischer Instrumentalisierung des Unterrichts. Sie kann soweit führen, daß die bloße Konstatierung des Zusammenhangs von Unterricht und Politik – eine Binsenwahrheit – die eigentliche Aufgabe der Didaktik verschleiert: Die Analyse der möglichen und die Begründung der jeweils für richtig und verantwortbar gehaltenen Arten dieses [/S. 13:] Zusammenhangs. Denn nicht der immer existierende Zusammenhang zwischen Pädagogik und Politik an sich, sondern nur die spezifische Art, in der er sich herstellt, ist für die Substanz und für das Profil einer didaktischen Konzeption relevant.(3)
Das mit diesem Band eröffnete Unterrichtswerk versteht sich als ein Versuch, die Konzeption des Geschichtsunterrichts und des politischen Unterrichts auf eine bestimmte Art der Definition des Zusammenhangs zwischen der Didaktik der Fächer und der politischen Funktion des Unterrichts zu gründen; eine Art, das sei vorab bemerkt, die weder die Didaktik zum Instrument einer politischen Tendenz degradiert noch die Pädagogik als "Meisterin" der Politik oder als Ersatz für sie versteht. Bei Wahrung der Eigenständigkeit und relativen Besonderheit jeder der Bereiche von Politik und Pädagogik gilt es, beide – hier im Bereich des historisch-politischen Unterrichts – so zu vermitteln, daß der Unterricht auch im Blick auf die politische Reflexion und das politische Verhalten substantiell und relevant wird, daß zugleich die politische Sphäre pädagogisch unter der Frage erschlossen wird, ob und wie sie offen, also kritisierbar und human, also verantwortbar vor der heranwachsenden Generation erfahren und gehalten werden kann.
Das hier geplante und sukzessiv zu entwickelnde Unterrichtswerk folgt einem flexiblen Konzept, das sehr unterschiedliche didaktische Akzentuierungen und methodische Zugriffe nicht nur erlaubt, sondern für wünschenswert hält. In den einzelnen Unterrichtseinheiten werden die Herausgeber den spezifischen didaktischen Ansatz jeder Einheit genauer ausweisen. In diesem Band wird das Konzept des Werkes als ein Rahmenkonzept vorgestellt, das sowohl die Grenzen, innerhalb deren es sich bewegt, wie die Strukturen, die es in diesem Bewegungsraum für fundamental hält, deutlich erkennbar macht.
Es wird weder ein theoretischer noch ein praktischer Vollständigkeitsanspruch erhoben. Systematische Lücken sind angesichts der Situation der Unterrichtswissenschaften unvermeidbar; es war den Herausgebern sehr bewußt, daß darüber hinaus der gegenwärtige geschichtliche Prozeß selbst die Erarbeitung eines abgerundeten, vollständigen, in toto "gültigen" didaktischen Systems und eines daraus abgeleiteten erschöpfenden Unterrichtswerkes nicht nur fragwürdig, sondern auch unmöglich macht. Herausgeber und Verfasser behalten sich vor, aus der Erfahrung mit den Unterrichtsmodellen ihre didaktische Konzeption zu korrigieren wie umgekehrt aus weiterer theoretischer Bemühung die praktischen Ansätze der Unterrichtseinheiten zu verändern. Sie sind deshalb für Anregungen, Einsprüche, Kritik nicht nur dankbar, sondern darauf angewiesen. [/S. 14:]
1.2 Der fachdidaktische Ausgangspunkt
Versucht man, den generellen, fachunspezifischen Ansatz didaktischer Bemühungen nach den wichtigsten Sektoren zu unterscheiden, findet man, das komplexe Faktorenbündel sehr abstrakt zusammenfassend, drei Hauptbereiche:
- Die Lernsituation im weitesten Sinne, angefangen von der Besonderheit der Individuen über die sozialen Strukturen einer Schulklasse und einer Schulorganisation bis hin zu den gesamtgesellschaftlichen Verflechtungen, in denen der einzelne lebt und die mehr oder weniger seine Lernsituation mitbestimmen. Dies ist das empirisch zu erforschende Feld der Voraussetzungen, in dem jeder Unterricht steht, das ihm Möglichkeiten und Grenzen setzt, zu dessen Faktoren aber auch der Unterricht selbst gehört.
- Die Zielrichtung und Zwecksetzung des Unterrichts, also die Vorstellung davon, was durch den Lernprozeß als positiv gesehene Veränderung bewirkt werden soll: Steigerung des Wissens, Entwicklung des Könnens, Wandel oder Verbesserung des Verhaltens der einzelnen, dadurch aber – als Hoffnung – auch der sozialen Gruppe, in denen sie sich befinden. Dies ist eine letztlich normativ zu setzende Richtung des erzieherischen Handelns. Vielfältig gebrochen, in unterschiedlichem Bewusstseins grad beim Lehrenden ist diese Setzung nicht wegzudenken; sie bestimmt die Gesamtplanung und die einzelnen Schritte des Unterrichts.
- Die Mannigfaltigkeit der Mittel und Verfahren unmittelbaren unterrichtlichen Handelns, die Fülle der Aktionen und Reaktionen während der Durchführung und direkten Organisationen der Lernvorgänge. Dies ist die pragmatische Ebene des Unterrichts, das unmittelbare, mit seinen unverschiebbaren Forderungen sich aufdrängende, den Lehrer in Handlungszwang setzende tägliche Aktionsfeld. Hier kann nicht gewartet werden, bis über die empirischen Voraussetzungen und die normativen Entscheidungen "endgültige" Klarheit herrscht; in einem immer vorläufigen Bewußtseinsgrad muß der Lehrer darum improvisieren, intuitiv aus dem Augenblick entscheiden. Hier liegt die notwendig bleibende Lücke und Grenze rationaler didaktischer Vorbereitung. Sie fordert von jedem Lehrer persönlich pädagogisches Einfühlungsvermögen, menschlichen Takt, methodische Phantasie, kurz: nicht vorher einplanbare Spontaneität. So bleibt dem Lehrer ein breiter und tiefer Entfaltungsraum, den keine Didaktik ausloten und durch Planung ersetzen kann, in dem gleichwohl die wichtigste und nachhaltigste Wirkung des Unterrichts gegründet ist. Das Vermögen des Lehrers, in spontaner Reaktion und intuitivem Einfall zweckentsprechend unterrichtlich und erzieherisch zu handeln, wächst erfahrungsgemäß in dem Maße, wie die Didaktik ihm den breiten Raum des empirisch, normativ und pragmatisch rational zu Erschließenden verdeutlicht und damit dem persönlichen erzieherischen und unterrichtlichen Handeln erst den klaren und bewußten Rahmen gibt, in dem es sich entfalten kann.
Die allgemeine Didaktik und Unterrichtsforschung hat die Erschließung dieses didaktischen Feldes von verschiedenen Seiten her versucht. Dabei hat sich gezeigt, daß die Wahl des Ansatzes das spezifische Profil des didaktischen Vorstellungsmodells bestimmte, so daß man – ohne Rücksicht auf das Fach, auf den spezifischen Gegenstand des Unterrichts – bestimmte Modelle und Typen von Didaktik beschreiben konnte.(4) [/S. 15:]
Sieht man die allgemeinen didaktischen Modelle bis hin zu den Konstruktionen der Curriculumtheorie genauer an, fällt auf, daß sie, obgleich je nach Ansatz dieser oder jener Art von Fachwissenschaft näher verbunden als der anderen, doch eigentümlich leer bleiben. Die Verallgemeinerung des Zugriffs auf Unterricht schlechthin läßt, ungeachtet der Versuche, hier und da das Modell zu exemplifizieren, den Gegenstand des Unterrichts selbst gleichsam durch die Löcher eines Siebes fallen. Da nun aber der Lerngegenstand, die Sache, um die es im Unterricht gehen soll, nicht auswechselbare und zufällige Zutat, sondern ein das gesamte Bedingungsfeld des Unterrichts mitbestimmendes und spezifisch einrichtendes Element ist, erweist es sich als unmöglich, der allgemeinen Didaktik nur ein fachspezifisches Additum anzufügen, um den didaktischen Zugriff zu komplettieren. Vielmehr strukturiert der Gegenstand des Unterrichts die drei oben skizzierten Sektoren didaktischer Bemühungen in je besonderer Weise. Die individuellen und sozialen Voraussetzungen des Unterrichts, seine Ziel- und Zwecksetzung ebenso wie seine pragmatische Durchführung lassen sich nicht untersuchen, planend oder handelnd angehen, ohne daß von vornherein der Inhalt des Unterrichts mitbedacht wird. Das gilt gerade auch im Hinblick auf die außerschulischen Bedingungen individueller und sozialer Art, die zu bestimmten Lerngegenständen nicht nur mehr oder weniger Affinitäten oder Aversionen, sondern auch ganz deutlich unterscheidbare von Fach zu Fach unterschiedlich zu gewichtende Voraussetzungen darstellen. Gerade für den historisch-politischen Unterricht hat die Art, in der sich in der Gesellschaft auf unterschiedliche Weise Geschichtsvorstellungen, politische Überzeugungen und Einschätzungen politischer Handlungsmöglichkeiten zu bilden pflegen, eine wesentliche Bedeutung.
So wird der Ruf nach der "Fachdidaktik" als Ergänzung der Curriculumentwicklung um so lauter, je mehr es darum geht, konkreten Unterricht zu planen, Lehrpläne inhaltlich zu begründen und praktisch umzusetzen. Die Entwicklung der Curriculumplanung hat die Forderung nach der Entwicklung der Fachdidaktik aus sich selbst hervorgetrieben.(5)
An diesem Punkte setzt der Versuch dieses Unterrichtswerks an. Der Gegenstand des Lernens wird hier zum Ausgangspunkt der didaktischen Reflexion und Planung genommen. Indem er dem Gegenstand des Unterrichts wieder die Aufmerksamkeit zuwendet, die ihm – nicht zum Nutzen der didaktischen Forschung und Planung – in den letzten Jahren häufig entzogen wurde, wendet sich dieser Versuch jedoch nicht ab von den wichtigen und nicht mehr zu übergehenden Ergebnissen und Problemstellungen der Curriculumforschung. Was auf diesem Felde an Gespreiztheiten und Anmaßungen, an Irrtümern und bisweilen grotesken Einseitigkeiten ins Kraut geschossen ist, darf nicht zum Anlaß werden, die nicht zu leugnenden Einsichten und Bewusstseinsschärfungen mit über Bord zu werfen, welche die curriculare Forschung der letzten 10 Jahre gebracht hat. Deshalb sei gleich zu Anfang betont, daß der Ausgang vom Gegenstand des Unterrichts hier nicht einen Rückfall in didaktische Konzeptionen meint, die der frohen Hoffnung waren, daß die Beherrschung des Faches – was immer damit gemeint sei – die beste, ja die einzig [/S. 16:] richtige Didaktik darstelle. Das rem tene, verba sequuntur, in dem ja ein Wahrheitskern steckt, führt sich, zur herrschenden didaktischen Maxime erklärt, selbst ad absurdum.
Besteht man auf der Eigenständigkeit eines fachdidaktischen Ansatzes, will man dem Gegenstand des Lernens, und damit dem Lernen selbst eine Bedeutung und Dignität zurückgeben, zeigt sich allerdings sogleich, daß der Begriff des "Faches", mit dem der Gegenstand des Lernens in einen Lernplan transponiert wird, in einen sehr viel weiteren Horizont gestellt werden muß, als es der des Lehrplans, als es der der Schule überhaupt ist (s. dazu unten S. 55 ff.). Es zeigt sich, daß der Begriff "Fach" ein schulisch verkürzter Ausdruck für eine bestimmte Dimension persönlichen wie allgemeinen Daseins ist, daß eine Fachdidaktik also ihre Grundlage in dieser, die Schule weit übergreifenden gegenwärtigen Wirklichkeit zu suchen hat, wenn sie ihrem eigenen Anspruch gerecht werden will.
1.3 Zum Zusammenhang zwischen historischem und politischem Unterricht
1.3.1 Allgemeine didaktische Überschneidungen und Ergänzungen
Versucht man in Kürze, die Aufgaben des Geschichtsunterrichts von denen des Politikunterrichts abzugrenzen und zugleich die Berührungs- oder Überschneidungsflächen zu bezeichnen, läßt sich etwa folgendes sagen:
Das Sachgebiet des Politikunterrichts liegt in der Gegenwart im weitesten Sinne, in ihren staatlichen, regionalen, kommunalen Strukturen, sozialen, wirtschaftlichen Zuständen, theoretischen Deutungsmustern ihres Selbstverständnisses und praktischen Verhaltensweisen der Menschen – jenseits der "res privatae" – in ihren Umweltverhältnissen. Sein Ziel muß es sein, eine zugleich kritische und qualifizierte Befähigung zu vermitteln, diese Gegenwartsverhältnisse zu erkennen, anzuleiten zum Finden und Bestimmen eines eigenen Standortes, zu helfen bei der Entwicklung von Verhaltensweisen, die sowohl den Gegebenheiten wie den Herausforderungen der Gegenwart adäquat sind und soweit wie möglich auf verantwortbaren Entscheidungsprozessen beruhen. Da sowohl die Verhältnisse wie deren Interpretation, die Kategorien des Erkennens und die Muster des Verhaltens nicht statisch ein für allemal gegeben sind, sondern sich unter wechselnden Bedingungen im historischen Prozeß herausgebildet haben und sich in ihm weiter verändern, kann ein seinen eigenen Ansatz begreifender Politikunterricht nicht ohne historische Standortbestimmung der eigenen Möglichkeiten und des eigenen Wollens auskommen; er kann die gewünschten Qualifikationen nicht unter Verzicht auf die Erkenntnis ihrer Historizität vermitteln. Er ist keine normative "Ewigkeitskunde", sondern historische Gegenwartskunde. Deshalb ist die Geschichtlichkeit eine der unumgehbaren Kategorien des politischen Unterrichts – als eine Bedingung der Erkenntnis gegenwärtiger Verhältnisse und der Möglichkeit, sich in ihnen zu orientieren und selbst zu bestimmen, nicht aber um der historischen Erkenntnis vergangenen Lebens an sich gehört die geschichtliche Dimension zum politischen Unterricht.(6) [/S. 17:]
Der Geschichtsunterricht hingegen hat eine sowohl durch die zeitliche Tiefe wie durch die umfassendere, nicht durch das Politische allein zu erschöpfende Thematik menschlichen Lebens eine potentiell sehr viel weitere Gegenständlichkeit. Eine Auswahl dessen als Kenntnis und sekundäre Erfahrung zu überliefern, was menschliches Leben im Läufe der Zeit individuell und kollektiv sein konnte und was es an Spuren hinterließ, die Möglichkeiten und Perspektiven in der Folge der Veränderung, in Vielfalt, Unterschiedlichkeit und Gegensätzlichkeit zur Anschauung zu bringen und in die Reflexion zu heben, ist eine Aufgabe, die dem Geschichtsunterricht kein anderes Fach ungeachtet der historischen Dimension, die im zugeordnet sein mag, abnehmen kann. Die Fähigkeit, Vergangenes als etwas anderes, an sich selbst Interessantes und durch Verwandtschaft oder Gegensätzlichkeit das eigene Dasein Bereicherndes anzuerkennen, ist nun schon im weitesten Sinne eine Qualifikation sowohl humaner wie auch politischer Bildung. Der Gefahr des Sich-Verlierens im Unendlichen des geschichtlichen Daseins und des Verlustes an Fähigkeit zur Gewichtung muß der Geschichtsunterricht innerhalb der begrenzten Zeit, die ihm zur Verfügung steht, dadurch begegnen, daß er neben der Vermittlung des Vielfältigen und Fremden im energischen Zugriff die Genese unserer eigenen Gegenwart und ihrer im weitesten Sinne politischen Verhältnisse aufzeigt, mit denen es der Politikunterricht unmittelbar zu tun hat. Im Ernstnehmen der "Vorgeschichte der Gegenwart" werden die Gegenwartsverhältnisse nicht nur besser verstanden; sie werden auch als ein in Kontroversen Gewordenes aufgefaßt und in ihrem gegenwärtigen Spannungszustand begriffen, so daß die Vorstellung nicht Raum greifen kann, es mit festen und unveränderlichen Gegebenheiten in der Gegenwart zu tun zu haben.
Daß die Zustände der Gegenwart Übergangszustände sind, daß sie sich nicht nur ändern, sondern daß sie auch veränderbar, d. h. menschlichem Planen und Handeln unterworfen sind, ist eine Einsicht, die politisches Grundverhalten beeinflussen kann. Aber die nicht minder wichtige Kehrseite dieser Erkenntnis ist die, daß die gewordenen Zustände eben nicht beliebig veränderbar sind, daß in Vergangenheit und Gegenwart gründende Bedingungen vielfältigster Art nicht nur das Handeln, auch schon das Planen und Denken eingrenzen, vor Hindernisse oder auch in Antinomien führen; daß geschichtliches Handeln immer im Prozeß – d. h. unter wechselnden und nicht sicher vorhersehbaren Bedingungen – vor sich geht und unter Umständen in seinen Ergebnissen weit von den Zielen und Motiven der Handelnden oder Fordernden abweicht; daß unkalkulierbare Nebenwirkungen sich in den Vordergrund drängen können.
Beides, die Möglichkeiten und die Bedingungen wie Grenzen des politischen Handelns, müssen und können im Geschichtsunterricht deshalb besonders einsichtig gemacht werden, weil uns die Geschichte abgelaufene Vorgänge und Handlungsstränge vor Augen stellt und es möglich macht, Motive und Begründungen für das Handeln, Bedingungen und Begrenzungen, Strategien und Wirkungen oder Ergebnisse politischen Handelns im Zusammenhang zu sehen. Insofern wäre ein auf diesen Blickpunkt hin angesetzter Geschichtsunterricht auch am entferntesten Beispiel eine politische Fallstudie.
Aber auch insofern, als der Geschichtsunterricht die nicht realisierten Alternativen, gescheitertes Denken und Handeln innerhalb der Vorgeschichte der Gegenwart aufzeigt, [/S. 18:] kann er die Möglichkeit und Bedingtheit politischen Handelns verdeutlichen, zu Vergleich und Urteil anregen und so dem politischen Verständnis eine tiefere und differenziertere Perspektive geben, als es ohne die historische Dimension einem rein präsentistischen Politikunterricht möglich wäre. In dieser Weise können sich gerade durch die Verbindung mit dem geschichtlichen Unterricht die Möglichkeiten, Befürchtungen und Hoffnungen der Gegenwart im Horizont der vergangenen wie der "kommenden Geschichte" (Wittram) begreifen.
Jenseits der unpolitischen Verhaltensweisen des Aktionismus oder der frustrierten Abstinenz kann in der Verbindung von politischem und historischem Unterricht besonnenes, auf Kenntnis, Urteil, Entscheidung gegründetes, illusionsloses politisches Verhalten vorbereitet werden.
Zu bestimmten, in konkreten Situationen zu realisierenden, inhaltlich umschriebenen Verhaltensweisen oder gar Handlungen kann der Geschichtsunterricht weder generelle noch spezielle Anleitungen geben, wenn er nicht das preisgeben will, was er in die politische Bildung mit gedecktem Wechsel einbringen kann: er kann für politische Verhaltensweisen und Entscheidungen einen Horizont von Kenntnis und historischer Perspektive bereitstellen, breitere Grundlagen und besseres Verständnis der unterschiedlichen oder gegensätzlichen Entscheidungen und Verhaltensweisen in der Gegenwart liefern, er soll "konditionieren" zum Begreifen der spannungsreichen politischen Positionen der eigenen Zeit, ihres relativen Rechts, ihrer jeweiligen historischen und gesellschaftlichen Bedingtheiten. Indem er die Möglichkeit, selbstbewußt und begründet Positionen zu beziehen mit dem Vermögen vermittelt, andere Positionen zu begreifen, wird er selbst unmittelbar zum politischen Unterricht. Er kann diese Funktion aber nur wahrnehmen, wenn ihm die erkennende Distanz, die Besonnenheit als didaktische Grundkategorie gewahrt bleibt, die es .erlaubt, unmittelbare Gegenwart in den historischen Zusammenhang zu rücken. Das Engagement des Geschichtsunterrichts ist eben diese Besonnenheit, und nichts wäre falscher und würde die politische Bildung mehr reduzieren, als wenn diese Besonnenheit als Mangel an Engagement verketzert oder aufgegeben würde.
So bedarf der politische Unterricht in seinem direkteren Zugriff der Ergänzung durch den Geschichtsunterricht – der Geschichtsunterricht seinerseits des zielgerichteten, schärferen Zugriffs des politischen Unterrichts auf die Gegenwart. Indem sich beide ergänzen, halten sie auch ihre möglichen Fehlentwicklungen in Schranken.
Diese Skizze des Gegenstandes und der Berührungspunkte von Geschichtsunterricht und politischem Unterricht entbehrt zweifellos der Trennschärfe. Es scheint so zu sein, daß der Zusammenhang zwischen historischem und politischem Unterricht im allgemeinen unbestritten ist, daß aber Versuche, aus dieser allgemeinen Ansicht eindeutige curriculare Konsequenzen zu ziehen, theoretisch willkürlich und unbefriedigend geblieben sind. War es in der Vergangenheit über lange Strecken so, daß vornehmlich dem Geschichtsunterricht zugleich die politische Bildung zugewiesen wurde, so gibt es in der Gegenwart Versuche, den Geschichtsunterricht einem didaktisch strukturell gegitterten Feld der Gesellschaftslehre einzugliedern. Die scharfe Kontroverse um diese Umkehrung des Verhältnisses zwischen geschichtlichem und politischem Unterricht hat zweifellos die Diskussionen beflügelt und die Positionen klarer hervortreten lassen. Sie hat aber auch gezeigt, daß ein ohne theoretische Vorentscheidungen und ohne Willkür aufzustellendes systematisches Schema einer Integration von Geschichts- und Politikunterricht nicht in [/S. 19:] Sicht ist.(7) Der unbewußt schon resignative Versuch andererseits, unter der Ausblendung von Geschichte zunächst einmal einen Politikunterricht für sich zu begründen und zu exemplifizieren, zeigt immer mehr die Schwächen, die im historischen Defizit dieses Ansatzes begründet sind.
Es ist wiederholt dargelegt worden, daß die Beziehungen zwischen Gegenstand und Methoden der Politikwissenschaft einerseits, der Geschichtswissenschaft andererseits so komplex, zugleich so gegenstands-, aspekt- und methodenabhängig sind, daß die Zeit für eine theoretisch haltbare Fundierung wissenschaftlicher und didaktischer Integrationsvorhaben zwischen historischem und politischem wissenschaftlichen Zugriff keineswegs erreicht ist. Die alte, vorübergehend anerkannte Scheidung zwischen "idiographischem", individuellen Prozeß beschreibendem und systematischem, generelle Formationen analysierendem Verfahren, das erste der Geschichtswissenschaft, das zweite der politischen und Sozialwissenschaft zugeordnet, ist längst aufgegeben. Auch der chronologische Ort ist kein verläßlicher Gradmesser dafür, ob wir es mit einem politischen oder historischen Gegenstand zu tun haben. Der Zeitgeschichte ist Gegenwärtiges zugewiesen; die Geschichte älterer Epochen bezieht sich virtuell in Frageanlaß und Problematisierung auf den Horizont unserer Zeit; selbst die Zukunft – als zweifellos "historische Dimension" – ist zwar nicht als Erforschbares gegeben, aber als Gewolltes und Eingeschätztes ein Regulativ der Historie. Auf der anderen Seite kennt die Politikwissenschaft längst nicht mehr die Begrenzung auf ein punktuell Gegenwärtiges, sie greift zum Vergleich wie zur Genese auf Vergangenes zurück und hat, nach vorübergehender Ausblendung historischer Kategorien, die Geschichte wieder als Politik im Prozeß entdeckt. Wie Geschichte sich in einer zweifellos nicht allgemein gültigen, aber wichtigen Auffassung als "historische Sozialwissenschaft" verstehen kann, so kann auch die Politikwissenschaft je nach Gegenstand, Methode und Erkenntniswillen – und nicht nur im Hinblick auf die Zeitgeschichte – zu einer politischen Geschichtswissenschaft werden.
1.3.2 Variable Kombination als pragmatischer Weg der Verbindung von historischem und politischem Unterricht
Aus dieser multiperspektivischen und flexiblen Verbindung zwischen Politikwissenschaft und Geschichtswissenschaft, deren Zusammenhang sich je nach Gegenstand und Methode immer neu konstituiert, müssen für den Zusammenhang zwischen Geschichtsunterricht und politischem Unterricht Konsequenzen gezogen werden. Ohne eine theoretisch umfassende Basis der curricularen Verbindung ein einheitliches Konzept der Integration zu liefern und sich der Gefahr auszusetzen, gewaltsam wissenschaftstheoretische und didaktische Dekrete zu erlassen, schlägt das vorliegende Werk einen pragmatischen, gegenstands- und methodenbezogenen Weg ein: Die Akzentuierung des Unterrichts erfolgt im Hinblick auf Thema und Fragestellung so, daß entweder im Sinne eines Politikunterrichts gegenwärtig Politisches unmittelbar aufgegriffen oder im historischen Ansatz die Vergegenwärtigung des Vergangenen in Zustand und Prozeß zum Schwerpunkt wird; im ersten Fall wird die historische Dimension, im zweiten Fall die aufs gegenwärtig Politische zielende Bedeutung des Themas mit erarbeitet. In jedem Fall aber sind die methodischen Denkansätze oder die den Transfer ermöglichenden kategorialen Denkformen [/S. 20:] in den Unterrichtsbeispielen angelegt und entwickelt, die es erlauben, Geschichte und Gegenwart, Politisches und Historisches unterscheidend und urteilend miteinander in Beziehung zu setzen.
Es ist in diesem Band versucht worden, sowohl für den Geschichtsunterricht wie für den politischen Unterricht einen selbständig ansetzenden, aber jeweils auf den anderen verweisenden didaktischen Begründungs- und Handlungsrahmen zu entwickeln; innerhalb dieses didaktischen Rahmens werden die Themen aufeinander bezogen oder miteinander verbunden. Diese Beziehung ergibt sich je nach dem Gegenstand in unterschiedlicher Weise:
- Historische und politische Unterrichtsbeispiele stehen in relativer Selbständigkeit nebeneinander. Eine direkte Verbindung wird nicht intendiert – lediglich über die Entwicklung von Denkformen und methodischen Zugriffen stellt sich eine mittelbare Beziehung her. Diese Selbständigkeit ist als Möglichkeit deshalb notwendig, weil der Zwang, bei jedem Thema im Unterricht die zwar latent vorhandene, aber nicht immer im Mittelpunkt des Zielrahmens stehende und oft sehr vermittelte Verbindung zwischen Politik und Geschichte herzustellen, zur Verkrampfung führen muß. (Beispiel: Völkerwanderungen, Entdeckungen, Kolonisationen – Probleme der Entwicklungsländer).
- Historische und politische Themen sind vom Gegenstand her eng aufeinander bezogen: Eine geschichtliche Unterrichtsreihe bietet die Gelegenheit, ein politisches Phänomen in der Gegenwart genauer zu analysieren oder umgekehrt. Diese Verbindung ist die eines curricularen Nacheinanders, in dem ein Fach den Gegenstand des anderen aufgreift und auf seine Weise vertieft. (Beispiel: "Industrielle Revolution" – "Kapitalismus")
- Historischer und politischer Zugriff sind in einem Thema verbunden. Die "Integration" erfolgt durch das Zusammentreffen der gleichermaßen politisch gegenwärtigen wie historischen Bedeutung und Auffassung des Themas; das Erkennen gegenwärtiger Verhältnisse und das Begreifen historischer Prozesse sind unlösbar miteinander verbunden. Eine solche Unterrichtsreihe geht genetisch von der Vergangenheit auf die Gegenwart zu ("Kinderarbeit und Kinderschutz in Deutschland seit dem 18. Jahrhundert"), setzt regressiv an einer gegenwärtigen Erscheinung an und sucht ihre historischen Bedingungen auf ("Marxistische Revolutionen in der dritten Welt") oder versucht komparativ am historischen Anderen das gegenwärtig Eigene begreiflich zu machen und umgekehrt. ("Grenzen in der Geschichte")
Auf diese Weise erscheint es am ehesten möglich, ohne Zwang, bei breitester Mitentscheidung über Thema und Methode durch den Lehrer wie durch die Lerngruppe im Unterricht den Zusammenhang zwischen Geschichte und Politik herzustellen, den beide in der Realität haben. Kein "Fach" braucht sich hier dem anderen zu unterwerfen, keins sich vom anderen zu isolieren. Auch das unterrichtstechnisch schwierige Problem der Stundenzumessung läßt sich durch dieses Konzept der relativ variablen Unterrichtsreihen, die unterschiedliche Formen der Kooperation herstellen, am ehesten lösen. Diese Aufbereitung der Gegenstände des politischen und historischen Unterrichts und die Verschränkung der Ziele läßt abwechselnd getrennten Fachunterricht ebenso zu wie Epochenunterricht oder einen kombinierten und konzentrierten Gesamtunterricht im gesellschaftswissenschaftlichen Unterrichtsfeld. [/S. 21:]
Der Explikation des didaktischen Ansatzes folgt in diesem Band eine Zusammenstellung der Themen des politischen und historischen Unterrichts. (4) Dabei werden in Rückbeziehung auf die Begründungen sowohl die Inhalte, die unterschiedlichen methodischen Zugangsformen und die Verbindungsmöglichkeiten der Themen kenntlich gemacht – im Rahmen des Versuchs, durch eine den Jahrgängen – wenngleich nicht streng – zugeordnete Folge von Unterrichtseinheiten ein Curriculum des geschichtlichen und politischen Unterrichts zu erstellen.
Erfolgt die Zusammenstellung eines Curriculums des historischen und politischen Unterrichts in pragmatischer Weise nach unterschiedlich eng dem Geschichtsunterricht bzw. dem politischen Unterricht zuzuordnenden Themen, so darf diese praktisch notwendige Form der Anordnung doch nicht ein vordergründiges Bild vom Zusammenhang zwischen geschichtlicher und politischer Bildung erzeugen: es sind letztlich nicht die Themen selbst, die diesen Zusammenhang konstituieren – oder sie sind es doch nicht vornehmlich. Ob im Geschichtsunterricht politische Bildung mitgeprägt wird, ist nicht so sehr eine Frage des behandelten Gegenstandes – etwa seiner Zeitnähe – sondern eine Frage des geistigen Zugriffs, der didaktischen Grundkategorien. Das gleiche gilt umgekehrt. Darum wird in diesem Werk der tiefere, über die Kenntnis- und Wissensvermittlung in die Sphäre der Denk- und Urteilsfähigkeiten wie der Wertsetzungen reichende Zusammenhang zwischen historischer und politischer Bildung nicht zuerst im Thematischen gesehen und gesucht; vielmehr findet er sich jenseits der Zuordnung von Themen im spezifischen, dem Gegenstand des historischen und politischen Unterrichts angemessenen Grundgefüge didaktischer Kategorien. Ist es – wie unten näher ausgeführt wird – der enge Zusammenhang zwischen Vergangenheitsbewußtsein, Gegenwartsverständnis und Zukunftsperspektive, welcher sowohl das reflektierte historische wie das aus bloßer Reaktion erlöste politische Denken und Urteilen bezeichnet, so ist darin der – unterrichtlich zu explizierende – Zusammenhang von Wissen und Erkennen, Beurteilen, Bewerten und Sich-Verhalten mit gesetzt. In der Einübung dieses Denk- und Orientierungsverhaltens an Themen, welche durch die Fragenotwendigkeiten unserer Zeit ebenso wie durch die historisch auf uns gekommenen staunenswerten und weiterwirkenden Phänomene vergangenen Daseins "pro-voziert" werden, liegt ungeachtet unterschiedlicher Akzentsetzungen und wissenschaftsystematischer Zugriffe die eigentliche Verbindung zwischen historischem und politischem Unterricht.(8) Sie realisiert sich durch didaktische Strukturierung und Methode in einem permanenten, grundlegenden und nicht nach Stunden oder Unterrichtseinheiten abzuzirkelnden Prozeß. Die thematische Zuordnung ist nur das curricular beschreibbare, organisatorisch aufweisbare Mittel, diese Verbindung in unterschiedlicher Inhaltsbezogenheit zu konkretisieren. (vgl. unter 4.1.5)
Anmerkungen
(1) Zur Unterschiedlichkeit des vermittelten Geschichtsbildes vgl. die in ihren Deutungen und Wertungen der Motive zweifellos dogmatisch einseitige, in der Bestandsaufnahme aber nicht zu übergehende Untersuchung von Karla Fohrbeck, Andreas J. Wiesand, Renate Zahar (1971).
(2) Zur Diskussion dieser Problematik vgl. Gerd-Klaus Kaltenbrunner (1975); Gerhard Schulz (1973); Géza Alföldy, Ferdinand Seibt, Albrecht Timm (1973); Jochen Huhn (1975); Rolf Schörken (1974); Arnold Sywottek (1974); Werner Conze (1972).
(3) Vgl. dazu insbesondere die durch die Hessischen Rahmenrichtlinien für Gesellschaftslehre ausgelöste intensive Diskussion: Gerd Köhler, Ernst Reuter (1973); Bernhard Vogel (1974); Wolfgang Hilligen (1973).
(4) Herwig Blankertz (1975). Vgl. auch die instruktive Auseinandersetzung mit didaktischen Ansätzen unterschiedlicher Art bei Wolfgang Hilligen (1975); vgl. auch Joachim Rohlfes (1971).
(5) Vgl. Herwig Blankertz (1973a). Darin ders. (1973b)
(6) Vgl. Joachim Rohlfes, Hermann Körner (1970), S. 36 ff.; Hermann Giesecke (1972), S. 151 ff.; Bernhard Sutor (1973), S. 36 ff., 99-106, 331 f. Interessanterweise finden sich bei Wolfgang Hilligen (1975) und Rolf Schörken (1974) keine expliziten Ausführungen über die Frage des Zusammenhangs zwischen dem historischen und politischen Unterricht. In den didaktischen Begründungsteilen dieses Bandes gehen die Verfasser detaillierter auf die gegenseitigen politischen bzw. historischen Implikationen des Geschichts- und Politikunterrichts ein, wie sie in der Konzeption dieses Ansatzes erscheinen.
(7) Vgl. Maek-Gérard, Eva; Muhlack, Ulrich; Zitzlaff, Dietrich (1974)
(8) Immer noch unübertroffen ist der Aufsatz von Friedrich J. Lucas (1966). Das folgende didaktische Konzept des Geschichtsunterrichts verdankt diesem Aufsatz Anregungen und wichtige Hinweise.
Literatur
Alföldy, Géza; Seibt, Ferdinand; Timm, Albrecht, Hg. (1973): Probleme der Geschichtswissenschaft. Düsseldorf.
Blankertz, Herwig (1973a): Fachdidaktische Curriculumforschung – Strukturansätze für Geschichte, Deutsch, Biologie, Bochum.
Blankertz, Herwig (1973b): Die fachdidaktisch orientierte Curriculumforschung und die Entwicklung von Strukturgittern. In: Blankertz, Herwig, Fachdidaktische Curriculumforschung – Strukturansätze für Geschichte, Deutsch, Biologie, Bochum
Blankertz, Herwig (1975): Theorien und Modelle der Didaktik. 10. Auflage. München.
Conze, Werner, Hg. (1972): Theorie der Geschichtswissenschaft und Praxis des Geschichtsunterrichts. Stuttgart.
Fohrbeck, Karla; Wiesand, Andreas J.; Zahar, Renate (1971): Heile Welt und Dritte Welt, Medien und politischer Unterricht. Opladen.
Giesecke, Hermann (1972): Didaktik der politischen Bildung. 7. Auflage. München.
Hilligen, Wolfgang (1973): Dreimal Emanzipation. Ansätze für einen Vergleich der neuen Richtlinien für den politischen Unterricht in Hessen und Nordrhein-Westfalen sowie in Rheinland-Pfalz. In: Gegenwartskunde, 22 (1973) 3, S. 271 ff.
Hilligen, Wolfgang (1975): Zur Didaktik des politischen Unterrichts 1. Wissenschaftliche Voraussetzungen, Didaktische Konzeptionen, Praxisbezug. Ein Studienbuch. Opladen.
Huhn, Jochen (1975): Politische Geschichtsdidaktik. Untersuchungen über politische Implikationen der Geschichtsdidaktik in der Weimarer Republik und in der Bundesrepublik. Kronberg/Ts.
Kaltenbrunner, Gerd-Klaus, Hg. (1975): Die Zukunft der Vergangenheit. Lebendige Geschichte – Klagende Historiker. München.
Köhler, Gerd; Reuter, Ernst, Hg. (1973): Was sollen Schüler lernen? Die Kontroverse um die hessischen Rahmenrichtlinien für die Unterrichtsfächer Deutsch und Gesellschaftslehre. Dokumentation einer Tagung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Frankfurt.
Lucas, Friedrich J. (1966): Der Beitrag des Geschichtsunterrichts zur politischen Bildung. In: Gesellschaft, Staat, Erziehung, Jg. 5, 1966, S. 381-395. Wieder abgedruckt in: Süssmuth, Hans, (Hg.): Anmerkungen und Argumente zur historischen und politischen Bildung, 1.2, Stuttgart 1972. S.147-170.
Maek-Gérard, Eva; Muhlack, Ulrich; Zitzlaff, Dietrich (1974): Zur Rolle der Geschichte in der Gesellschaftslehre: Das Beispiel der hessischen Rahmenrichtlinien. Stuttgart.
Minssen, Friedrich (1973): Legitimationsprobleme in der Gesellschaftslehre. – Zum Streit um die hessischen Rahmenrichtlinien. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung "Das Parlament". B 41/73 (13.10.73)
Rohlfes, Joachim; Körner, Hermann, Hg. (1970): Historische Gegenwartskunde. Göttingen.
Rohlfes, Joachim (1971): Umrisse einer Didaktik der Geschichte, Göttingen.
Schörken, Rolf, Hg. (1974): Curriculum "Politik". Von der Curriculumtheorie zur Unterrichtspraxis. Opladen.
Schulz, Gerhard, Hg. (1973): Geschichte heute. Positionen, Tendenzen, Probleme. Göttingen.
Sutor, Bernhard (1973): Didaktik des politischen Unterrichts. 2. Auflage. Paderborn.
Sywottek, Arnold (1974): Geschichtswissenschaft in der Legitimationskrise. Archiv für Sozialgeschichte, Beiheft 1, Bonn-Bad Godesberg.
Vogel, Bernhard (1974): Schule am Scheideweg. Die hessischen Rahmenrichtlinien der Diskussion. München.
Giesecke, Hermann (1978): Skizzen zu einer politisch begründeten historischen Didaktik
1. Zur politischen Begründung des Geschichtsunterrichts in einem demokratischen Gemeinwesen
1. Im Vergleich zum politischen Unterricht ist die didaktische Diskussion und Theoriebildung für den Geschichtsunterricht sehr viel weniger weit entwickelt. Es gibt z. B. noch keine zusammenfassenden Darstellungen sowie historisch-kritische Aufarbeitungen bisheriger Entwürfe (1). Das kann auch ein Vorteil sein, insofern vielleicht die nun notwendigen Überlegungen unbefangener geführt werden können; denn es ist keineswegs sicher, dass der z. T. gewaltige fachdidaktische Aufwand dem politischen Unterricht auch immer genützt hat, teilweise scheint er sich auch ihm gegenüber verselbständigt zu haben. Längst nämlich hat sich die didaktische Diskussion des politischen Unterrichts gelöst von der Aufgabe, Erkenntnisfortschritte zu leisten, indem der jeweils vorliegende Problemstand Zug um Zug verbessert wird. Statt dessen stehen sich "Richtungen" und "ideologische Parteiungen" gegenüber, die einander nicht mehr zum Zwecke des Erkenntnisfortschritts befragen, sondern eher an Abgrenzung interessiert sind. Das hängt keineswegs nur mit der inzwischen eingetretenen politischen Polarisierung zusammen, sondern auch mit der fachdidaktischen Professionalisierung und Spezialisierung, die offenbar notwendigerweise ein gewisses Maß der Energie in die eigene Profilierung und Abgrenzung investieren muss. Vielleicht erklärt sich daraus auch die Tendenz, für die didaktische Grundlegung relativ beliebige "erkenntnisleitende Interessen" anzusetzen, wobei die Beliebigkeit gerade im Verzicht auf historische Reflexion begründest ist; die bisher vorliegende Diskussion wird nicht aufgegriffen, sondern durch schlichte Neusetzungen einfach außer Kraft gesetzt (2).
2. Es erscheint mir also schon aus methodischen Gründen sinnvoll, die Überlegungen zu einer historischen Didaktik noch einmal dort beginnen zu lassen, wo sie zum erstenmal systematisch entwickelt wurden: bei Erich Weniger (3). Seine Überlegungen zum Geschichtsunterricht stehen im größeren Zusammenhang seiner Bemühungen, eine Theorie für den Lehrplan der Schule überhaupt zu entwickeln. Warum gibt es in den Schulen eigentlich bestimmte Fächer und andere nicht? Und aus welchen Gründen werden irgendwann neue Fächer eingeführt? Weniger suchte die Antwort auf diese Fragen, indem er die Entstehung der Fächer historisch zurückverfolgte. Und dabei zeigte sich ihm, dass neue Schulfächer immer dann eingeführt werden, wenn eine sogenannte "Bildungsmacht" im politisch-gesellschaftlichen Leben so mächtig geworden ist, dass sie vor den Heranwachsenden in der Schule repräsentiert sein wollte. Zu diesen Bildungsmächten gehörten unter anderem der Staat, die Kirchen und die Wirtschaft. Im Geschichtsunterricht nun wende sich der Staat mit seinen Ansprüchen an die junge Generation, und zwar unter dem Gesichtspunkt, dass die nachwachsende Generation ja künftig die Verantwortung für diesen Staat werde übernehmen müssen. "Der Gegenstand des Geschichtsunterrichts war immer auf den Bereich der künftigen Verantwortung bezogen und eingegrenzt. Der Geschichtsunterricht sollte die geschichtlichen Voraussetzungen erarbeiten, unter denen die jeweilige Verantwortung stand, und damit der heranwachsenden Generation das Rüstzeug mitgeben, dass sie zur Bewältigung der vor ihr liegenden Aufgaben braucht" (4). Im Geschichtsunterricht komme also der Selbsterhaltungswille des Staates gegenüber der heranwachsenden Generation zum Ausdruck, er ist für Weniger die eigentliche Einführung der jungen Generation in die Politik; seine Aufgabe ist, die "Lebensgeschichte" des Staates produktiv, aber eben nicht historisch beliebig fortzuschreiben.
3. Wenn man bei diesem Gedanken heute noch einmal ansetzt, darf man sich nicht beirren lassen von zeitbedingten bzw. personbedingten Irrtümern und Einseitigkeiten, son- [/ S. 150:] dern muss zwischen dem Prinzipiellen und dem historisch zu Modifizierenden unterscheiden. Ich halte Wenigers prinzipielle These nicht nur nach wie vor für richtig, sondern auch für die einzige Möglichkeit, die Notwendigkeit des Geschichtsunterrichts in den Schulen überzeugend zu begründen; dieser Argumentation kann man jedoch nur dann folgen, wenn man Wenigers Konzept konsequent, und d. h. auch: in der historischen Verlängerung, zu Ende führt.
4. Weniger hatte bereits einige andere Begründungsversuche für den Geschichtsunterricht überzeugend zurückgewiesen, die gleichwohl später immer wieder eine Rolle spielen sollten. Das betraf zunächst die Rolle der Geschichtswissenschaft. Sie könne als solche den historischen Unterricht nicht begründen, sie sei nicht selbst das, was sich im Geschichtsunterricht repräsentiert, weil sie ausschließlich der historischen Wahrheitsfindung verpflichtet sei und nicht dem Selbsterhaltungswillen des Staates; sie sei für den Geschichtsunterricht nur Mittel zum Zweck, also methodologisches und materiales Repertoire. Auch psychologisch-anthropologische Begründungen könnten nicht überzeugen, wie, dass man in der Begegnung mit der Geschichte notwendige Aspekte der Bildung (heute würde man eher sagen: der Identität) erfahre. Es lasse sich nämlich zeigen, dass alle solche Bildungsmomente bzw. Tugenden oder menschlichen Grunderfahrungen auch in anderen Fächern bzw. in der Begegnung mit anderen kulturellen Objektivationen entstehen könnten (z. B. Literatur, Theater, Kino) und jedenfalls nicht spezifisch aus dem Geschichtsunterricht erwüchsen. Darauf hatte Theodor Litt schon in seinem Buch "Geschichte und Leben" (Leipzig 1918) hingewiesen.
Diese Kritik trifft - so scheint mir - auch manche gegenwärtigen Versuche, historischen Unterricht als notwendig für die Identitätsbildung des Schülers zu verstehen - jedenfalls dann und insofern, als solche Begründungen lediglich von der Anthropologie des Schülers ausgehen und nicht auch von seinen politischen Pflichten und Aufgaben. Dieser Einwand gilt übrigens über den Geschichtsunterricht hinaus für alle gegenwärtigen didaktischen Konzepte, die kultu- [/ S. 151:] rellen, beruflichen und politischen Lernziele einseitig aus den subjektiven Dimensionen der Bedürfnisse, Motivationen und Interessen herleiten wollen - was oft nur eine naive Fortsetzung der alten "Pädagogik vom Kinde aus" ist - und dabei übersehen, dass solche Lernziele auch von den objektiven Ansprüchen her, die diesen Bedürfnissen usw. zunächst einmal gleichgültig gegenüberstehen, formuliert werden müssen. Kommunikationstheoretische, identitätstheoretische und auch psychoanalytisch orientierte didaktisch-methodische Konzepte drohen die Einsicht zum Verschwinden zu bringen, dass realitätsbezogene und deshalb lohnende Lernprozesse die grundsätzliche Spannung zwischen subjektiven Bedürfnissen und den Ansprüchen der diesen gegenüber prinzipiell gleichgültigen objektiven Realitäten aushalten und produktiv bearbeiten müssen (5).
5. Die prinzipielle Zustimmung zum Ansatz von Weniger macht zugleich seine Weiterentwicklung nötig. Die Grenzen seiner Argumentation müssen überschritten werden. Da ist zunächst zu klären, warum der Geschichtsunterricht die ihm von Weniger gesetzte Aufgabe von einem bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr hat wahrnehmen können, sondern durch einen zusätzlichen politischen Unterricht ergänzt bzw. seit Ende der 50er Jahre teilweise fast ersetzt worden ist. Weniger hat sich schwer damit getan, nach 1945 den politischen Unterricht in seinen Begründungszusammenhang des Geschichtsunterrichts einzubeziehen. Grund dafür war seine Überlegung, dass die Jugend noch nicht im Ernst der politischen Kämpfe und Entscheidungen stehe, weshalb es auch keinen Sinn habe, sie in der Schule mit aktuellen politischen Kontroversen zu befassen. Deshalb könne der historisch-politische Unterricht nur propädeutische Funktion haben, auf künftige Verantwortung vorbereiten, indem er gerade in Distanz zur Aktualität das Repertoire für die politische Besinnung aus der Geschichte nehme; dabei ging es Weniger keineswegs um einseitige historische Informationen im Sinne etwa der "staatstragenden Mächte", sondern durchaus um die Darlegung der staatlichen und gesellschaftlichen Widersprüche -aber eben nicht mit dem Ziel jeweils [/ S. 152:] aktueller politischer Stellungnahmen der Schüler. Angesichts mancher Entwicklungen an Schulen und Hochschulen in den letzten Jahren, angesichts leichtfüßiger politischer Stellungnahmen mit wenig Distanz und noch weniger Nachdenken mag Wenigers Auffassung nachträglich gerechtfertigt erscheinen. Dennoch beruhte sie auf Voraussetzungen, die nicht mehr gültig sind.
6. Politische Verantwortung war für Weniger unmittelbar staatsbezogen (aktives und passives Wahlrecht; Wehrdienst), nicht auch gesellschaftsbezogen, wobei die traditionelle Trennung von Staat und Gesellschaft vorausgesetzt wurde. Unabhängig nun von der Frage, wie das Verhältnis von Staat und Gesellschaft zu definieren sei - worüber es auch heute noch keineswegs Konsens gibt - , dürfte Einigkeit darüber herrschen, dass im politisch-historischen Unterricht auch die nichtstaatlichen politisch-relevanten Mächte angemessen präsentiert sein müssen; das ergibt sich allein schon aus ihrer objektiven Bedeutung für das Gemeinwesen. Gesellschaftlichen Verantwortlichkeiten sind aber auch Jugendliche schon ausgesetzt - z. B. im Beruf und in Schulen und Hochschulen. Das heißt: In dem Augenblick, wo man den Blick vom Staatswesen auf das demokratische Gemeinwesen im ganzen richtet, entfällt Wenigers Voraussetzung, dass der historische Unterricht als ein politischer nur propädeutische Bedeutung haben könne. Aber noch eine weitere Konsequenz wird sichtbar. Für die Ausdehnung des Begriffs Verantwortung auf die gesellschaftlichen Bezüge der Jugendlichen reicht der Geschichtsunterricht nicht mehr aus. Selbst wenn er stärker sozialgeschichtlich (statt einseitig staatsgeschichtlich) orientiert wäre, könnte er den komplexen Zusammenhang der gegenwärtigen politisch-gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen nicht hinreichend erschließen. Wäre dies möglich, so wären Wissenschaften wie Politikwissenschaft und Soziologie überflüssig, und ihre Aufgaben könnten von der Historie mit erledigt werden. Die von Weniger formulierte Funktion des historischen Unterrichts muss also ergänzt werden durch kognitive Modelle der aktuell-bezogenen Politikwissenschaft und Soziologie, [/ S. 153:] die Gleichzeitigkeit der gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse und Beziehungen zum Ausdruck bringen (6).
7. Wenigers Vorstellung von der politischen Exterritorialität des Jugendalters wurde ferner in dem Maße hinfällig, wie die soziale Funktion der Familie und ihre Sozialisationsfunktion sich änderten. Je mehr die soziale und ökonomische Autonomie der bürgerlichen Familie durch vielfältige bürokratisierte Verflechtungen mit der Gesamtgesellschaft beschnitten wurde, und je weniger der Vater noch als Garant bzw. Vertreter der politischen und gesellschaftlichen Interessen der Familie gelten konnte, um so mehr wurden die jugendlichen Mitglieder der Familie selbst auch politisch-gesellschaftliche Subjekte. (Ein vielleicht extremes, aber anschauliches Beispiel: Durch die Stipendienvorschriften mehr oder weniger aufgezwungene Unterhaltsprozesse von - wenn auch erwachsenen - Kindern gegen ihre Eltern). Weniger sah im Jugendlichen nicht das politisch isolierte Individuum, den isolierten einzelnen Pflichten- und Rechtenträger, wie es sich heute etwa im Bild des "Rollen-Ensembles" ausdrückt, er sah ihn vielmehr als Teil eines Sozialverbandes, nämlich der Familie. Die ökonomische und soziale Emanzipation der Jugendlichen von ihren Familien machte sie nun notwendig auch - relativ unabhängig von ihrem Alter - zu politisch-gesellschaftlichen Subjekten, also zu Menschen, die selbst für ihre gesellschaftlichen Interessen eintreten müssen und nicht mehr damit rechnen können, dass dies irgend jemand sozusagen "naturwüchsig" für sie tut (7).
8. Die Bedeutung, die Weniger allein dem Geschichtsunterricht beimaß, hatte ferner zur Voraussetzung, dass es so etwas wie Geschichtsbewusstsein überhaupt in nennenswertem Ausmaß in der Bevölkerung gab, dass das alltägliche, private und öffentliche Leben auch in einem historischen Kontinuum gelebt, erlebt und interpretiert wurde; dass Zukunft als verantwortliche Fortschreibung von Vergangenheit und Gegenwart angesehen wurde. Eine wesentliche Bedingung der Möglichkeit für ein derartiges Geschichtsbewusstsein ist offenbar wiederum eine bestimmte Familienkonstellation. [/ S. 154:] Es hängt nämlich davon ab, inwieweit die Menschen sich selbst biographisch, oder besser: in der Sequenz von Generationen in ihrer Familie erleben. Die zunehmende Vergesellschaftung der Familie, die zunehmende Aushöhlung ihrer "naturwüchsigen" Funktionen, die Aufsaugung vieler ihrer Aufgaben durch gesamtgesellschaftliche Rechts- und Fürsorgemaßnahmen zerstören auch notwendigerweise die unmittelbare Erfahrungsbasis für historische Prozesse. Wo es keine biographische Verbindlichkeit gibt, kann es auch kein historisches Bewusstsein geben - es sei denn als professionell und artifiziell konstruiertes.
9. Diese Tendenz wird noch dadurch unterstützt, dass die grundlegenden Prinzipien der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, die ihrer Natur nach ahistorisch sind, sich inzwischen radikal durchgesetzt haben gegen anderwertige - z. B. religiöse - Prinzipien. Die Prinzipien der technologischen Effizienz, des wirtschaftlichen Wachstums und des maximalen Profits sind ahistorisch in dem Sinne, dass ihr jeweils fortgeschrittener Stand den zurückliegenden, aus dem er hervorgegangen ist, nicht nur überflüssig macht und zum "Wegwerfen" verurteilt, er bedarf des voraufgegangenen nicht einmal zu seiner Rechtfertigung oder auch nur Erklärung. Eine neue Produktionsmethode macht die alte überflüssig, die Umkehrung kommt nicht in Frage: dass etwa frühere Methoden besser sein könnten als neuere. Die Annahme, das Frühere könne auch das Bessere sein, kann nur dann erwogen werden, wenn andere Prinzipien für "Fortschritt" eingeführt werden, z. B. solche der Lebensqualität oder der Humanisierung der Arbeit, die den eben genannten Prinzipien entgegengesetzt werden müssen und von daher nicht zu legitimieren sind, sondern ihrer eigenen Legitimation bedürfen.
Ähnlich verhält es sich mit den für die herrschenden gesellschaftlichen Prinzipien benötigten humanen Dispositionen: Die Kategorien der individuellen Leistung, des individuellen Wettbewerbs, der sozialen Mobilität, des Rollenhandelns, ja sogar der "balancierenden Identität" (Krappmann) sind gegenüber biographisch-familiären wie auch historischen Prozessen prinzipiell gleichgültig (8).
[/ S. 155:] Weder die anthropologischen noch die technologisch-ökonomischen Prinzipien unseres gesellschaftlichen Lebens benötigen historisches Bewusstsein, vermögen dieses allenfalls als eine Art von Luxus zu dulden oder lieber noch als funktionalen "Reibungsverlust" zu verhindern. Wenn man also die Herausarbeitung von historischem Bewusstsein in den Schulen fordert, muss man dafür andere Kategorien und Kriterien ins Feld führen als die eben genannten. Einen derartigen Versuch hat z. B. die "kritische Theorie" unternommen, indem sie die realen Lebensverhältnisse - und damit auch jene obengenannten Prinzipien - kritisch konfrontiert mit den Prinzipien und Versprechungen, die am Beginn der bürgerlichen Gesellschaft formuliert wurden (z. B. höchstmögliche Individuation und Entfaltung des Individuums; Mündigkeit).
10. Wenn es nach Weniger darum geht, im Geschichtsunterricht die "Lebensgeschichte" des Staates zu präsentieren mit dem Ziel, sein weiteres Schicksal der nachkommenden Generation zu überantworten, dann muss der Begriff des Staates als eines demokratischen präzisiert werden: Weniger hatte seine Thesen nur formal begründet, das heißt ohne nähere Ausführung zu den Besonderheiten des demokratischen Staates. Ob dieser nämlich historisch verstanden werden muss, hängt davon ab, wie man seine Aufgabe definiert. Wenn der Staat z. B. lediglich als "Krisenmanager" fungieren soll, als oberste Ordnungsmacht für die Regelung widersprüchlicher gesellschaftlicher Interessen, benötigt man zu seinem Verständnis und zur verantwortlichen Partizipation an ihm kein historisches Bewusstsein, sondern eher "zeitlose" funktionale Verständnismodelle, wie das Modell der "demokratischen Spielregeln" oder das "Rollen-Modell". In diesem Falle genügt es; wenn sich der Staat nach jenen technologisch-ökonomischen ahistorischen Prinzipien konstituiert.
Nur wenn man unterstellt, dass der demokratische Staat sich gerade dadurch auszeichnet, dass er für sein Handeln anderen normativen Bedingungen unterliegt, die einerseits ganz bestimmte Qualitäten im Umgang mit und in der Für- [/ S. 156:] sorge für die Bürger zur Folge haben, andererseits aber auch ganz bestimmte qualitative Anforderungen an das Bewusstsein der Bürger voraussetzen (z. B. Mündigkeit), wird historisches Bewusstsein nötig, allerdings dann eben ein solches, das die ahistorischen technologisch-ökonomischen Prinzipien transzendiert, sich von ihnen kritisch distanziert. Im Grunde müsste über dieses letztere Verständnis des Staates als eines demokratischen in unserem Lande Konsens sein. Allerdings hätte dies unter anderem zur Folge, dass eine Theorie des Geschichtsunterrichts ohne Aufarbeitung der kritischen Theorie nicht möglich ist, weil und insofern diese eine ausformulierte Theorie zur Kritik der bloß technologisch-ökonomischen Effizienz-Rationalität angeboten hat.
Das bedeutet nicht, dass man die "kritische Theorie" im ganzen, sozusagen als "ideologischen Überbau" übernehmen muss, aber wohl, dass man sie in ihren grundsätzlichen Frageansätzen ernst nehmen muß. Insofern sind alle wissenschaftstheoretischen Polarisierungen, die kritische Theorie als Nicht-Wissenschaft, als Ideologie, als parteiliche Einseitigkeit denunzieren - wenngleich derlei Vorwürfe auch immer wieder im Detail überprüft werden müssen - nicht nur unsinnig. Sie zerstören auch die einzig überzeugende Möglichkeit der Neubegründung eines historischen Unterrichts; denn um es noch einmal zu betonen: Weder aus den herrschenden aktuellen gesellschaftlichen Prinzipien, noch aus herrschenden funktionalen Verhaltensmodellen für die Bürger (z. B. Rollen-Theorie), noch aus den vorherrschenden wissenschaftstheoretischen Richtungen wie Positivismus, kritischer Rationalismus und Systemtheorie lässt sich auch nur die Vernünftigkeit eines historischen Bewusstseins, geschweige denn seine Notwendigkeit ableiten. Dies geht vielmehr nur, wenn man die grundlegenden normativen Prinzipien des demokratischen Staates und der demokratischen Gesellschaft (Grundrechte; Menschenrechte; soziale Solidarität; Mitbestimmung; Mündigkeit; Freiheit; Gleichberechtigung, Sozialpflichtigkeit des Eigentums usw.), die er für sich in Anspruch nimmt, nicht als solche versteht, die ein für allemal realisiert seien, sondern als solche, deren Sinn angesichts sich wandelnder Realitäten und Handlungs- [/ S. 157:] zwänge immer neu gefunden werden muss. Und diese Reflexion auf den praktischen Sinn jener Prinzipien ist nur möglich mit der Durchbrechung des "Schleiers" der Aktualität, durch historische Transzendierung und Vergewisserung.
11. Historischer Unterricht kann nicht mehr wie früher die Reproduktion des "Zeitgeistes" sein, er könnte nur gegen ihn betrieben werden, als dessen Kritik und Aufklärung. Insofern hat sich - etwa im Vergleich zu den 50er Jahren - die öffentliche Einschätzung des politischen Unterrichts einerseits und des historischen Unterrichts andererseits gründlich verändert. Galt nämlich früher der politische Unterricht als kritischer Störenfried des auf Identifizierung mit den konservativen Mächten und Traditionen bedachten historischen Unterrichts (9), so scheint heute der politische Unterricht sehr viel selbstverständlicher gesellschaftlich integriert und anerkannt zu sein als der Geschichtsunterricht. In dem Maße jedoch, wie der politische Unterricht sich von der historischen Dimension getrennt hat - und diese Tendenz scheint sich zu verstärken - , müssen sich auch die Zweifel an seiner kritisch-emanzipatorischen Tendenz und Wirkung melden (10).
Notwendig ist der historische Unterricht jedoch als Kritik der gegenwärtigen Gesellschaft, ihrer Leitbilder, Normen und Programme - als ständiger Hinweis auf Alternativen; auf die Gemachtheit der gesellschaftlichen Realität und damit auf ihre Veränderbarkeit; auf die Kontinuität und zugleich Wandelbarkeit herrschender Ideologien; auf die gleichbleibenden und sich verändernden Formen menschlicher Unterdrückung und Ausbeutung; auf die Nicht-Selbstverständlichkeit des scheinbar Selbstverständlichen usw.
12. Für Weniger kam es im Geschichtsunterricht darauf an, die Geschichte des Volkes den Heranwachsenden im Zusammenhang zu erzählen, im Sinne einer in sich kontingenten Präsentation der Tradition, in die neue Generation verantwortlich "einsteigen" soll. Nicht einmal für die Oberstufe des Gymnasiums wollte er ein kritisches Quellenstudium.
[/ S. 158:] Diese Vorstellung hatte jedoch zur Voraussetzung, dass es möglich und konsensfähig sei, durch den Geschichtsunterricht eine Art von "Geschichtsbild" zu präsentieren, das trotz aller Widersprüche - die Weniger durchaus sah - als Einheitliches der jungen Generation angeboten werden könne. Das ist jedoch nur in einer Gesellschaft möglich, die sich ihrer Traditionen noch ziemlich sicher ist bzw. die in der Lage ist, bestimmte dem widersprechende Traditionen (z. B. der Arbeiterbewegung) auszuklammern oder zu "kanalisieren" - z. B. dadurch, dass diese "störende" Tradition lediglich in Form der staatlichen "Sozialpolitik" aufgenommen wird.
Eine demokratische Staats- und Gesellschaftsverfassung darf jedoch unter Berücksichtigung der Pluralität von Traditionen, die in sie eingegangen sind, kein offizielles Geschichtsbild mehr vermitteln, muss vielmehr ihre "Lebensgeschichte" von Tabus freihalten und zur Disposition stellen, um auf diese Weise von jeder neuen Generation wieder eine demokratische Tradition erarbeiten zu lassen; denn es ist nicht einmal sicher, dass so, wie die Geschichte des demokratischen Gemeinwesens bisher verlaufen ist, sie im ganzen demokratisch-"fortschrittlich" verlaufen ist. Weniger nahm dies offensichtlich an, wenn er meinte, die Tradition als Einheit durch den Lehrer präsentieren zu können. Aber die kritische Theorie hat demgegenüber den begründeten Verdacht geweckt, dass es möglicherweise auch um die Wiederbelebung verschütteter Traditionen gehen müsse, nicht nur um die Fortschreibung dessen, was sich durchgesetzt hat.
13. Auch die Rolle der Geschichtswissenschaft im historischen Unterricht muss man heute anders sehen als Erich Weniger. Richtig bleibt zwar, dass sie den Geschichtsunterricht nicht konstituieren kann, aber die Frage ist, wie denn mit den historischen Stoffen im Unterricht verfahren werden soll, wenn ein einverständliches "Geschichtsbild" durch den Lehrer nicht mehr präsentiert werden kann. Die Antwort kann nur lauten, dass nun die Schüler selbst bzw. die Unterrichtsgemeinschaft von Lehrern und Schülern die Erarbeitung eines Geschichtsbildes vornehmen müssen, sie [/ S. 159:] müssen selbst die historische Rekonstruktion leisten mit der unausweichlichen Folge, dass dabei mehrdeutige "Geschichtsbilder" zustande kommen bzw. dass der Konsens über die "demokratische Lebensgeschichte" des Gemeinwesens nicht Ausgangspunkt, sondern allenfalls Ergebnis des Unterrichts sein kann. Die Interpretationen müssen gleichsam "freigegeben" werden für die unterrichtliche Bearbeitung.
In dieser Situation erhält die Geschichtswissenschaft eine neue Funktion. Ihre Methoden der Erkenntnisgewinnung werden nun in wenn auch elementarisierter Form für den Geschichtsunterricht benötigt, soll dieser nicht beliebig werden; denn alle Methoden sorgfältigen Nachdenkens über historische Entwicklungen sind auch historisch-wissenschaftliche Methoden, wobei allerdings die Umkehrung nicht gilt: Nicht alle historisch-wissenschaftlichen Methoden können auch in der Schule Verwendung finden, das ergibt sich aus dem spezifischen didaktischen Auftrag des schulischen Unterrichts, Komplexität zu reduzieren. Die Verpflichtung auf die wissenschaftsorientierten Methoden des Nachdenkens und Arbeitens ist nach der Unmöglichkeit, noch weiter komplette Geschichtsbilder zu lehren, die einzige konsensfähige Basis für den Geschichtsunterricht, also auch dafür, die in der Geschichtswissenschaft selbst vorliegenden unterschiedlichen Interpretationen der historischen Sachverhalte und Entwicklungen im Schulunterricht "auszuhalten".
Anders als in Wenigers Konzept ist eine öffentliche Legitimierung des Geschichtsunterrichts ohne Bezugnahme auf den wissenschaftlichen Standard nicht mehr möglich, und das gilt sowohl für die objektive Seite (Lebensgeschichte des demokratischen Gemeinwesens) wie auch für die subjektive Seite (historische Selbstaufklärung zum Zwecke der Mündigkeit). Sowohl für den politischen Unterricht wie auch für den Geschichtsunterricht ist der Weg zum Subjektivismus und zur Indoktrination sehr kurz geworden, er kann nur vermieden werden von der formalen Seite her, also von der Art und Weise, wie man zu einem Ergebnis gekommen ist. Das Lernergebnis selbst gibt keine Möglichkeit zur öffentlichen Rechtfertigung mehr ab. Angesichts [/ S. 160:] der auch im Geschichtsunterricht zunehmenden Tendenz, Lernziele zu setzen und zu realisieren, kann dieser Punkt nicht genügend ins Bewusstsein genommen werden: dass nämlich gerade dadurch die Legitimationsprobleme nicht gelöst, sondern nur verstärkt bzw. sogar hergestellt werden. Wahrscheinlich wird man sich in Zukunft daran gewöhnen müssen, dass es zwischen Wissenschaftsdidaktik und Schuldidaktik nur noch graduelle, keine prinzipiellen Unterschiede mehr geben kann (11).
Damit ist aber nur die kognitiv-unterrichtliche Seite des Problems angesprochen, wie man verhindern kann, dass die Freigabe pluralistischer Interpretationen der "Lebensgeschichte" des Staates nicht beliebig wird, dem Lehrer z. B. Tür und Tor öffnet, im Geschichtsunterricht seine eigenen politisch-historischen Urteile und Vorurteile unkontrolliert an die Schaler weiterzugeben. Der zweite Gesichtspunkt ist, dass die fachwissenschaftliche Qualifikation des Lehrers unter diesen neuen Bedingungen konstitutiv für den Legitimationszusammenhang wird. Und dies nicht nur in dem Sinne, dass die fachwissenschaftliche Qualifikation eine Funktion der fachdidaktischen Qualifikation ist und von dieser her zu begrenzen wäre. Vielmehr muss er zumindest auch in der Lage sein, die Gegenstände, die er unterrichtet, hinsichtlich der damit verbundenen wertenden Urteile für sich selbst argumentativ diskutieren zu können. Er muss also - prinzipiell unabhängig von seiner beruflichen Aufgabe - historisch-wissenschaftlich "gebildet" sein.
Eine dritte wichtige Bedingung, die Pluralität der Interpretation nicht beliebig werden zu lassen, sind bestimmte Möglichkeiten für die Kommunikationsstruktur des Unterrichts. Die Frage ist ja, ob und in welchem Maße die kommunikativen Bedingungen überhaupt zulassen, dass auch die Schüler von der Freigabe der Interpretation profitieren können und nicht nur ihre Lehrer. Es ist wohl kein Zweifel, dass kommunikations- und interaktionstheoretische Überlegungen und Konzepte in den letzten Jahren in der Erziehungswissenschaft ein so großes Interesse gefunden haben. Das hängt zweifellos auch mit dieser Legitimationsproblematik zusammen (12). Allerdings droht auch hier bereits die Ge- [/ S. 161:] fahr der Verabsolutierung eines wichtigen Gesichtspunktes. In dem Maße nämlich, wie sich solche Überlegungen von den anderen beiden hier genannten Bedingungen isolieren, führen sie auch nur wieder zu einem pädagogisch-provinziellen Rückzug auf die menschliche Unmittelbarkeit.
2. Aspekte einer historisch-didaktischen Theorie
1. Nach der grundsätzlichen Auseinandersetzung mit Wenigers Konzept sollen nun einige zwar immer noch allgemeine, aber doch wenigstens strategische Gesichtspunkte für eine historische Didaktik erörtert werden. Die zentrale Aufgabe des Geschichtsunterrichts, so hat sich gezeigt, ist die Rekonstruktion der "Biographie" des gegenwärtigen demokratischen Gemeinwesens. Es geht also um die Frage, wie dieser Staat und diese Gesellschaft, ihre verfassungsmäßigen Prinzipien, ihre charakteristischen Institutionen und Regelungen entstanden sind; welche Ursachen ihrer Entstehung und Entwicklung zugrunde liegen, welche Probleme sie gelöst haben und welche nicht, und welche sie neu geschaffen haben; wer aus welchen Gründen die Gegner des Demokratisierungsprozesses waren und welche entscheidenden Krisen das demokratische Gemeinwesen wie überstanden hat. Ein solcher historischer Unterricht, der an der "Biographie" der gegenwärtigen Gesellschaft orientiert ist und der damit seinen Gegenwartsbezug gleich mitsetzt und ihn nicht durch alle möglichen Spekulationen zusätzlich einführen muss, erklärt nicht nur positiv, "wie es gekommen ist" - was bereits wieder in die Nähe eines "Geschichtsbildes" gelangen würde - , sondern auch kritisch, "warum es nicht anders gekommen ist" bzw. warum und wodurch eine bestimmte Intention oder Bewegung nicht zum Erfolg gekommen ist.
Die letztere, kritische Erklärungsabsicht ergibt sich u. a. aus der Tatsache, dass der Demokratisierungsprozess, wie er etwa zur Formulierung des Grundgesetzes geführt hat, nicht linear-fortschrittlich verlaufen ist, sondern auch in Krisen und teilweise barbarischen Rückschritten, sowie aus der weiteren Tatsache, dass der Demokratisierungsprozess teil- [/ S. 162:] weise erheblich verzögert worden und auch heute noch nicht zu seinem Ende gekommen ist. Dabei steht die Leitvorstellung "Demokratisierung" durchaus selbst zur Diskussion. Wie aktuelle politische Auseinandersetzungen zeigen, z. B. die Diskussion um den Begriff "Emanzipation", gibt es darüber nicht ohne weiteres einen Konsens. Unterschiedliche klassen- und schichtspezifische Erfahrungen und Interpretationen müssen ernst genommen werden, eine bewusste Konvention kann nicht vorausgesetzt werden, sondern wäre gerade u. a. durch Geschichtsunterricht herzustellen und zu ermöglichen. Würde man die historischen Prozesse, die zur gegenwärtigen staatlich-gesellschaftlichen Verfassung geführt haben, unaufgeklärt auf sich beruhen lassen, so würden die spezifisch demokratischen Kriterien der Verfassung zusammenschrumpfen auf formale Regeln für die Bildung und Kontrolle von Macht und für die Austragung von Konflikten. Ohne historisches Bewusstsein müssen über kurz oder lang demokratische Normen und Prinzipien zum Verschwinden kommen.
2. Es geht aber auch um die historische Selbstaufklärung der Individuen zum Zwecke ihrer Mündigkeit, also um die Aufklärung ihrer aktuellen Wünsche, Bedürfnisse, Intentionen, Probleme und Konflikte. Über eine ganze Reihe von für die Gegenwart bedeutsamen historischen Zusammenhängen gibt es immer schon eine Vor-Einstellung oder ein mehr oder weniger diffuses Konglomerat von Vorstellungen. Ganz falsch wäre die Annahme, historisches Bewusstsein müsse vom Nullpunkt an erst aufgebaut und hergestellt werden. Historische Voreinstellungen sind vielmehr - sei es in verbalisierbarer Form, sei es in Form kollektiv-bewusster oder kollektiv-unbewusster Vorstellungen und Einstellungen - immer schon vorhanden und werden im Verlauf der Sozialisation mitgelernt.
Aufgabe der historisch-didaktischen Grundlagenforschung wäre u. a., solche vorhandenen Einstellungen und Vorstellungen genauer zu untersuchen, denn sie müssen ein wichtiger didaktischer Ausgangspunkt sein: Geschichtsunterricht besteht in der Konfrontation dieser Vor-einstellun- [/ S. 163:] gen mit wissenschaftlich-historischen Erkenntnissen und Methoden. Dazu jedoch reichen solche Untersuchungen nicht mehr aus, die sich mit verbalisierbaren historischen Kenntnissen und Vorstellungen befassen. Während es nämlich etwa in den 50er Jahren noch darum ging, durch den Nationalsozialismus geprägte, aber in hohem Maße verbalisierbare und deshalb auch argumentierbare falsche historische Vorstellungen zu korrigieren, hat es heute mehr und mehr den Anschein, als ob überhaupt keine historischen Vorstellungen, Interessen und Kenntnisse bei einem immer größeren Teil der Bevölkerung und vor allem der heranwachsenden Generation mehr vorhanden seien. Bis in die mittelständische Studentenschaft hinein ist dieser historische Bewusstseinsschwund festzustellen - nicht zuletzt in der weit verbreiteten Unfähigkeit unter sog. "linken" Theoretikern, im Rahmen der historisch-materialistischen Prämissen historisch konkret zu argumentieren.
Jedoch wäre es ein Irrtum anzunehmen, historisches Bewusstsein und historische Vorstellungen könnten einfach ersatzlos ausfallen. Wo früher verbalisierbares historisches Bewusstsein saß, ist nun keineswegs eine Leerstelle. Das Problem ist vielmehr gerade, dass diese scheinbare Leerstelle nun ausgefüllt ist durch der rationalen Argumentation nicht mehr ohne weiteres zugängliche "Selbstverständlichkeiten". Zu diesen gehört z. B. die Vorstellung vom eindimensionalen "Fortschritt", wonach das Frühere eben auch das Schlechtere ist - eine Vorstellung, die durch einen unhistorisch-technologischen Wissenschaftsbetrieb fleißig genährt und geradezu offiziös gemacht wird. Ferner gehören dazu eine Reihe kollektiver Ressentiments und Anteile der herrschenden Ideologien, die überhaupt nur als eine Art von abgesunkenem historischen Bewusstsein erklärt werden können, z. B. gerade für Deutschland typische anti-kommunistische, anti-gewerkschaftliche Komplexe, tiefsitzendes Misstrauen gegen die Arbeiterbewegung und deren Funktionäre sowie gegen die Fähigkeit und Ziele organisierter Arbeitnehmerinteressen; gegen Räteähnliche politische Organisationsmuster und die "Politik der Straße". Jede politische Kontroverse in der Gegenwart enthält solche und andere [/ S. 164:] Anteile von "abgesunkenen historischen Erfahrungen", die das Verhalten bestimmen und als unaufgeklärte der privaten und gesellschaftlichen Vernunft im Wege stehen. Sie haben eher die Qualität von kollektiven Ängsten angenommen, als dass sie sich wie früher in verbalisierbaren "Geschichtsbildern" artikulieren könnten. Interessant wäre in diesem Zusammenhang auch die Analyse von solchen Produkten der Unterhaltungsindustrie, die auf historischen Stoffen beruhen, und deren Beliebtheit ja nicht zuletzt darauf basiert, dass sie beim Publikum eine bestimmte Vorstellungswelt ansprechen.
3. Didaktische Ansatzpunkte für den historischen Unterricht sind also einerseits die wie auch immer konfusen, unaufgeklärten historischen Vorstellungen der im Unterricht agierenden Lehrer und Schüler, andererseits die Biographie der staatlich-gesellschaftlichen Verfassung selbst, soweit sie jedenfalls die gegenwärtigen politisch-ideologischen Auseinandersetzungen unausgesprochen oder ausgesprochen mit bestimmen. Solche Vorstellungen werden durch Konfrontation mit historisch-wissenschaftlichen Forschungen und Ergebnissen in wenn auch reduzierter und exemplarischer Form bearbeitet. Die Lernchancen sind also in der Differenz zwischen den subjektiven Vorannahmen und Voreinstellungen einerseits und den einschlägigen objektivierten wissenschaftlichen Verfahren und Produktionen andererseits angelegt. So früh wie möglich, d. h., wie es der Bildungsgang erlaubt, sollte dies sich auch durch die "Begegnung mit den Originalen" ausdrücken. In den unteren Bildungsstufen muss der Lehrer wie eh und je den objektiven Aspekt in geeigneter Weise repräsentieren und vermitteln. Systematische Lehre bleibt weiterhin nötig, aber die Notwendigkeit zur Reduktion der Komplexität muss sich rechtfertigen gegenüber der Forderung nach einer angemessenen Vermittlung von Subjektivität und Objektivität.
Nun reichen alle diese Vorüberlegungen nicht aus, eine unstreitige Stoffauswahl und einen eindeutigen Katalog von Lernzielen zu deduzieren. Derartige Hoffnungen haben sich auch für den politischen Unterricht in den letzten Jahren [/ S. 165:] zerschlagen. Die umfangreichen curricular orientierten Legitimationsversuche etwa in den neuen Hessischen und Nordrhein-westfälischen Richtlinien konnten sich zwar teilweise konkretisieren, aber zu deren Lernziel- und Stoffvorschlägen ließen sich auch unter Berücksichtigung der dafür gesetzten allgemeinen Prinzipien eine Reihe logisch gleichwertiger Alternativen finden. Mit anderen Worten: Das Problem der unterrichtlichen Konkretion ist nur dadurch zu lösen, dass man den offensichtlich nicht weiter einzugrenzenden Unbestimmbarkeitsspielraum zwischen den leitenden Prinzipien und der Konkretisierung durch pragmatische Konventionen ausfüllt.
Überhaupt ist ja die Erwartung, in unseren Schulen müsse überall in denselben Jahrgängen das gleiche gelernt werden, eine fixe Idee der Schulverwaltungen. Es ist jedenfalls nichts, was in einem erkennbaren Interesse der Selbstaufklärung der Schüler bzw. der Aufklärung des Gemeinwesens läge. Auch im Sinne einer notwendigen didaktischen Reihenfolge, dass man erst dieses lernen müsse, um dann jenes verstehen zu können, führen derartige Konkretisierungen nicht weiter. Auch die Psychologie der Altersstufen gibt dafür weniger her, als man lange angenommen hat, und auch die moderne Lernpsychologie kann dafür allenfalls allgemeine Hinweise geben. Selbst die Spekulation auf die Motivationen der Schüler und auf ihre jeweiligen Lerninteressen bringt nicht viel ein, weil erstens "Motivationen" und "Interessen" sehr plastische und daher anpassungsfähige Persönlichkeitsvariablen sind und weil zweitens die Aufgabe des Schulunterrichts nicht nur sein kann, vorhandene Motivationen und Interessen zu befriedigen, sondern auch, durch Konfrontation mit diesen neue bzw. präzisierte entstehen zu lassen. Ein Schulunterricht, der allzu naiv auf die vorhandenen Motivationen setzt, macht diese nur parasitär und verhindert ihre Herausarbeitung und Entfaltung. Nur in dem Maße, wie sie mit objektiven Ansprüchen konfrontiert werden, werden sie auch ernst genommen. Die für historische Bearbeitungen nötigen intellektuellen Fähigkeiten sind zumindest nicht größer, als sie für viele Fächer ganz selbstverständlich gefordert werden. Würde man sich [/ S. 166:] für den historischen Unterricht von der Vorstellung lösen, es komme dabei wesentlich auf "Gesinnungsbildung" oder "Gemütsbildung" oder auf ein bestimmtes "Verhalten" an, dann fiele es auch leichter, die kognitiven Chancen deutlicher zu machen und ungenierter zu nutzen.
Nur im Sinne einer zweckmäßigen pragmatischen Vereinbarung, und nicht als Deduktion aus einer unbestreitbaren Theorie, lässt sich die an und für sich unbegrenzte Vielfalt von Möglichkeiten und Variationen für den historischen Unterricht auf vier miteinander zusammenhängende didaktische Leitgesichtspunkte eingrenzen, die man vielleicht als ein allgemeines didaktisches Strukturmuster ansehen könnte:
- den wissenschaftlich -formalen Aspekt;
- den ereignisgeschichtlich-analytischen Aspekt;
- den strukturgeschichtlich-synthetischen und schließlich
- den aktuell genetischen Aspekt.
4. Von der Bedeutung der formalen Aspekte für die öffentliche Legitimierbarkeit des Geschichtsunterrichts war schon die Rede. Diese Aspekte lassen sich vielleicht folgendermaßen operationalisieren:
- Zwischen der Erkenntnis von Tatsachen und dem Spielraum der Interpretation dieser Tatsachen unterscheiden lernen;
- lernen, dass die Interpretation von historischen Tatsachen und Ereignissen zwar standort- und interessengebunden ist, sich aber gleichwohl dem Anspruch der Wahrheit aussetzen muss;
- die Bedeutung und unterschiedliche Aussagefähigkeit von Quellen erkennen lernen.
Dies wäre ein Minimalkatalog, der realisierbar ist, wenn man bedenkt, dass diese formalen Kriterien durchaus aus der unmittelbaren Lebenserfahrung der Schüler erklärt werden können. Nicht fremd ist ihnen die Erfahrung, dass es einen Unterschied zwischen Tatsachen und ihren Interpretationen gibt; dass man geneigt ist, Interpretationen so vorzunehmen, dass sie einem "in den Kram passen"; dass z. B. eine offizielle Erklärung des Schulleiters eine andere "Quell- [/ S. 167:] enqualität" hat als die Ansichten der Freunde über die Schule usw. Wahrscheinlich ist es sehr viel leichter, solche formalen Aspekte zu begreifen, als komplexe historische Ereignisse zu erfassen.
5. Im Hinblick auf die "Biographie" der staatlich-gesellschaftlichen Verfassung lässt sich eine Reihe von historischen "Schlüsselereignissen" als besonders relevant für die Bearbeitung im Unterricht vereinbaren, und zwar solche, die einerseits für die gegenwärtige historische Lage wichtig gewesen sind, und die andererseits deutlich die allgemeine Konfliktlage zwischen demokratischen und antidemokratischen Tendenzen und Interessen bzw. - falls diese Entgegensetzung zu problematisch erscheint - zwischen unterschiedlichen Interessenlagen und Konzeptionen überhaupt widerspiegeln. Zu einem solchen "Ereignis-Kanon" können etwa gehören: Die Französische Revolution; die Stein-Hardenbergschen Reformen; das Jahr 1848; das Sozialistengesetz; die Bismarcksche Sozialpolitik; der Erste Weltkrieg; die Russische Revolution; die Deutsche Revolution 1918/19 und die Entstehung der Weimarer Republik; die Weltwirtschaftskrise; die nationalsozialistische Machtergreifung; die Nürnberger Gesetze; der Zweite Weltkrieg; das Potsdamer Abkommen. Manches spräche dafür, auch noch Ereignisse vor der Französischen Revolution mit einzubeziehen, z. B. die Reformation, die Bauernkriege, den Dreißigjährigen Krieg usw. Auch solche Ereignisse könnten mit guten Gründen als wichtig für die "Biographie" der demokratischen Verfassung angesehen werden. Jedoch ist noch einmal zu betonen, dass es für die Auswahl einer solchen Ereignis-Kette kein hinreichend konkretisierbares Prinzip gibt.
Aber nicht nur die Zahl solcher Schlüsselereignisse ließe sich vermehren, sofern die begrenzte Zahl der dafür zur Verfügung stehenden Unterrichtsstunden dies zulässt; vielmehr wären auch andere "Klassen" von Ereignissen nicht weniger plausibel, z. B. schulpolitische, wie die preußischen Regulative und das preußische Volksschulunterhaltungsgesetz von 1906, sowie weitere Daten aus der Geschichte der Arbeiterbewegung. Je nachdem, welche Position jemand im histori- [/ S. 168:] schen Kontext des Demokratisierungsprozesses und in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen einnimmt, wird er auch eine bestimmte Ereignis-Reihe favorisieren.
Solche unterschiedlichen Konzeptionen lassen sich zwar rational diskutieren, spiegeln sie doch nur aktuelle ideologische Kontroversen wider, aber es hätte wenig Sinn, für den Schulunterricht auf Durchsetzung dieser oder jener Position zu setzen. Vielmehr muss der Schulunterricht der Pluralität einander widerstreitender, im Rahmen des Grundgesetzes zulässiger demokratischer Konzeptionen und Interessenlagen Rechnung tragen. Daraus folgt, dass durch Richtlinien nur ein Teil der Ereignisse zur Behandlung im Unterricht vorgeschrieben werden kann, dass weitere zur Disposition der "pädagogischen Basis" gestellt werden müssen. Mit anderen Worten: Staatliche Richtlinien können nur Kompromisse anbieten, und sie sollten sich davor hüten, sich darüber hinaus eine prinzipielle inhaltliche Legitimation zu geben.
6. Nun sind "Ereignisse" in der eben beschriebenen Form in zweierlei Hinsicht noch unscharf definiert. Erstens hinsichtlich ihres Umfanges, denn bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass es sich immer schon um einen Komplex bzw. um eine Sequenz von Ereignissen handelt. Diese Schwierigkeit gilt jedoch für die Bearbeitung politischer Konflikte im Unterricht genauso und kann nur im konkreten Unterricht selbst definitorisch gelöst werden, im Sinne einer genaueren Bestimmung der gemeinsamen Aufgabe. Zweitens ist noch unklar, was "Bearbeitung" dieser Ereignisse eigentlich heißen soll. "Bearbeiten" heißt, begründete Fragen stellen an einen Sachverhalt bzw. an seine Interpretation. Sind solche Fragen prinzipieller Art, d. h. können sie sinnvoll immer wieder an Gegenstände mit gemeinsamen Merkmalen, z. B. an historische Ereignisse, gestellt werden, so handelt es sich um Kategorien. Welche Fragen man stellen will, hängt von dem Interesse ab, das man einem bestimmten Gegenstand gegenüber hat. Insofern kann die Auswahl von Kategorien mit einer gewissen Beliebigkeit erfolgen. [/ S. 169:] Sehr viel weniger beliebig - weil auf dem Spielraum der formalen methodischen Regeln festgelegt - ist die Beziehung von Frage (Kategorie) und Antwort. Die Beliebigkeit der Kategorien-Wahl wird jedoch weiter eingeschränkt und zugleich genauer determiniert durch die für den historischen Unterricht angenommenen Leitvorstellungen (Bearbeitung der individuellen historischen Vorstellungen einerseits und Bearbeitung der historischen Biographie der demokratischen Verfassung mit dem Ziel ihrer weiteren Realisierung andererseits). Unter diesem Aspekt nämlich müssen im Prinzip die gleichen Kategorien auch für historische Ereignisse relevant sein, die für die Analyse gegenwärtiger politischer Konflikte Geltung beanspruchen können. Die Verwendung gleicher Kategorien gäbe zudem die Möglichkeit, den politischen Unterricht mit dem historischen strukturell zu verbinden.
Ich schlage also vor zu prüfen, ob die von mir für den politischen Unterricht entwickelten Kategorien (Macht; Recht; Solidarität; Ideologie; Konkretheit; Konflikt; Mitbestimmung; Funktionszusammenhang; Geschichtlichkeit; Menschenwürde) (13) nicht auch die grundlegenden analytischen Kategorien für die Bearbeitung der historischen "Schlüsselereignisse" sein könnten. Lediglich die Kategorie des subjektiven "Interesses" ließe sich nicht unmittelbar, sondern nur hypothetisch verwenden, etwa in dem Sinne: Welche Stellung hätte ich (der Schüler) damals eingenommen, und was wäre mein Interesse gewesen? Diese Kategorien - ihre mögliche Modifizierung schließe ich jetzt mit ein - scheinen mir auch den historisch-wissenschaftlichen Analysen zugrunde zu liegen, sind also insofern "eigenständige", keine unzulässig pädagogisierten Kategorien. Die Chance ihrer didaktischen Verwendung bestünde nicht nur darin, dass zwischen historischem und politischem Unterricht vermittelt werden könnte, sondern auch darin, dass einerseits zwischen der objektiven und subjektiven Aufgabe des Geschichtsunterrichts und andererseits zwischen Gegenwart und Geschichte vermittelt werden könnte. Diese Kategorien sind nämlich Leitfragen von heutigen Individuen, gerichtet an den objektiven Prozess der, staatlich-gesell- [/ S. 170:] schaftlichen Demokratisierung, und zwar so, dass sie nur vom Standpunkt des jeweiligen historischen "Schlüsselereignisses" her bearbeitet und beantwortet werden können. Wäre also eine solche Verwendung von Kategorien möglich und akzeptierbar, dann ergäbe sich die Aussicht, den Komplex des historischen und politischen Unterrichts einerseits für die Erkenntnisfähigkeit der Schüler reduziert genug, andererseits aber auch differenziert und "materialtreu" genug zu organisieren.
7. Für den historischen Unterricht stellt sich dasselbe Problem wie für den politischen Unterricht, nämlich wie man von einer Analyse politischer Konflikte bzw. von historischen Ereignissen zu einem Vorstellungszusammenhang über die Gesamtgesellschaft gelangen kann. Dies ist nicht einfach induktiv möglich, nämlich so, dass man die Konfliktanalysen nur genügend weit verlängert. Vielmehr muss die gesamtgesellschaftliche Struktur unmittelbar in den Blick genommen werden. Dafür bietet sich im Geschichtsunterricht die strukturgeschichtliche Betrachtungsweise an. Deren Modelle sind nicht nur nützlich für den Komplex "Gesamtgesellschaft" (z. B. Feudalismus; Frühkapitalismus; Spätkapitalismus), sondern auch für die Entwicklung gesellschaftlicher Teilbereiche (z. B. "Familie", vom "ganzen Haus" bis zur gegenwärtigen Kleinfamilie). Allerdings sind sie auch nicht unproblematisch, weil sie die Faszination des definitiv und knapp und bündig Erkannten auszustrahlen vermögen, während sie tatsächlich jedoch nur idealtypische Konstrukte und Abstraktionen sein und sich erst durch die Analyse von Ereignissen mit Leben füllen können. Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, wie verführerisch bis hin zum Verlust jeder Art von historischer Sensibilität solche Modelle wirken können, und schon aus diesem Grunde kann es nur um die Kombination und wechselseitige Ergänzung von ereignisgeschichtlichen und strukturgeschichtlichen Betrachtungen gehen.
8. Einen weiteren wichtigen Zugang zu historischen Prozessen bietet die politisch-didaktische Kategorie der "Ge [/ S. 171:] schichtlichkeit" bei der Analyse aktueller politischer Konflikte, die dadurch in ihrer historischen Genese rekonstruiert werden. Lange Zeit schien dieser aktuell-genetische Aspekt der einzig notwendige zu sein, weil er auf lange Sicht zu erweisen schien, welche historischen Fakten und Traditionen für die Einsicht in gegenwärtige und zukünftige Probleme benötigt würden. Jedoch hat sich nicht zuletzt in der Diskussion neuer Richtlinien gezeigt, dass allein von diesem Zugang her die historischen Rekonstruktionen keine Tiefe gewinnen, keinen eigenständigen Argumentationszusammenhang abgeben können. Historische Informationen würden einseitig in Dienst genommen für aktuelle Erkenntniszwecke, ohne dass sie auch zu deren kritischer Gegen-Instanz werden könnten. Bewiesen würde sozusagen immer nur noch einmal, was vorher schon klar ist.
9. Die hier vorgeschlagene Mehrdimensionalität des Geschichtsunterrichts macht auch den Weg frei für neue unterrichtsmethodische Varianten. Die von Erich Weniger vertretene Konzeption bot da wenig Variationsmöglichkeiten, kaum mehr als den Frontalunterricht des Lehrers. Nun geht es aber nicht mehr nur um die optimale Vermittlung historischer Stoffe, sondern auch um die Bearbeitung individueller und kollektiver, d. h. ideologisch gewordener gegenwärtiger Vorstellungen über historische Ereignisse und Zusammenhänge sowie um den Umgang mit Originalmaterial. Nicht nur steht z. B. zur Debatte, wie die nationalistische Machtergreifung wirklich gewesen ist, sondern auch, wie sie in der nicht-professionellen öffentlichen Diskussion, in programmatischen politischen Erklärungen etwa oder in aktuellen politischen Begründungszusammenhängen erscheint. Unter diesen Umständen bieten sich auch neue unterrichtsmethodische Variationen an, ohne dass sie krampfhaft inszeniert werden müssten, z. B. für recherchierende Kleingruppen, so dass sich der historische Unterricht auch methodisch dem politischen Unterricht weitgehend annähern könnte (14).
[/ S. 172:]
10. Die hier vorgeschlagene Mehrdimensionalität von ereignisgeschichtlich-analytischen,
strukturgeschichtlich-synthetischen, und aktuell-genetischen Aspekten einerseits und von individuellen bzw. kollektiven
gegenwärtigen Vorstellungszusammenhängen andererseits mag zunächst deshalb unbefriedigend erscheinen, weil sie
nicht zu einer überzeugenden "Theorie des Geschichtsunterrichts" integriert ist. Ähnliche Vorwürfe sind
auch immer schon gegen meine didaktische Konzeption des politischen Unterrichts erhoben worden, ohne dass es bisher gelungen
wäre, das Bemühen nach einheitlicher und systematischer didaktischer Theorie entscheidend weiterzutreiben.
Meine Ansicht ist, dass didaktische Theoriebildung unter den gegenwärtigen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen von einem bestimmten Punkt der Perfektion an ins Gegenteil umschlägt, nämlich entweder zu blutleeren technologischen Unterrichtsprojekten führt, oder aber das verbaut, was da vermittelt werden soll. Didaktische Theorien müssen sich deshalb wohl bescheiden, mehr oder weniger pragmatische Konstrukte mit "mittlerer Reichweite" zu bleiben. Für den Geschichtsunterricht heißt das, dass ein in sich zusammenhängendes Geschichtsbild im staatlich monopolisierten Schulwesen nicht mehr verbindlich gemacht werden kann. Lediglich gesellschaftliche Partikularitäten wie Kirchen oder Gewerkschaften können ihren Anhängern noch eine solche Gesamtinterpretation in ihren eigenen außerschulischen Bildungsveranstaltungen anbieten. Die Schule jedoch hat es mit parteilich-konkurrierenden Interpretationen zu tun, nicht nur mit politischen, sondern auch mit wissenschaftlichen. Daraus folgt, dass sich die didaktischen Überlegungen auf die Modalitäten der intellektuellen Bearbeitung, also auf die subjektive Seite der Lern- und Studierprozesse, verlagern müssen. Die Organisation der intellektuellen Arbeitsprozesse hat Vorrang vor der Planung der Endergebnisse, das Geschichtsbild als Inbegriff der in sich plausibel strukturierten historischen Vorstellungen kann nur das Ergebnis des je subjektiven Lern- und Studierprozesses selbst sein. Es kann und darf nicht curricular antizipiert werden. Ein moderner Geschichtsunterricht kann [/ S. 173:] nicht "einheitlicher" sein, als es die moderne internationale Geschichtswissenschaft selbst ist, und man sollte sich endlich - und nicht nur im Fach Geschichte - von der Vorstellung befreien, in die Schule dürfe nur das Unumstrittene Einzug halten. Das Umstrittene als eben dieses im Unterricht zu behandeln und es auf eine konsensfähige Weise zu behandeln, ist eines demokratischen Staates und einer staatlich monopolisierten Schule durchaus nicht unwürdig.
11. Die bisherigen Überlegungen bezogen sich auf einen politisch begründeten Geschichtsunterricht, der als solcher kaum hinter die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft zeitlich zurückgehen kann. Darin liegt eine Einseitigkeit, die zum Schluss wenigstens noch angedeutet werden soll. Historischer Unterricht ließe sich nämlich nicht nur begründen aus der politischen Partizipation - wovon in diesem Artikel die Rede war - , sondern auch aus der kulturellen Partizipation. Historische Tradition begegnet uns ja auf mannigfaltige Weise: Der Tourismus z. B. schafft Begegnungen mit den Zeugnissen verschiedener Kulturen und gesellschaftlicher Formationen und mit Lebensauffassungen, die sich von den unseren unterscheiden. Das Fernsehen berichtet über Minderheiten, die früheren und uns auf Anhieb völlig unverständlichen Kulturen angehören. Und das Verständnis für Gastarbeiter in unserem Lande wäre sicher größer, wenn wir wenigstens eine Ahnung von deren spezifischen gesellschaftlichen und kulturellen Traditionen hätten. Aber vielleicht wäre dies eher eine Aufgabe für die historischen Dimensionen anderer kultureller Fächer in der Schule.
Anmerkungen
(1) Vgl. Berger, Th., Geschichtsdidaktik, in: b:e 8/1977, S. 53 ff. - Süssmuth, H. (Hrsg.), Geschichtsunterricht ohne Zukunft? 2 Bände, Stuttgart 1972 - Herbst, K., Didaktik des Geschichtsunterrichts zwischen Traditionalismus und Reformismus, Hannover 1977.
(2) Dieses Verfahren wurde "modisch" Ende der sechziger Jahre durch solche "anti-kapitalistischen" Positionen, die Kritik [/ S. 174:] an ihren sogenannten "bürgerlichen" Gegenpositionen antithetisch-alternativ und undialektisch im Sinne einer Abgrenzung und nicht einer ständig notwendig bleibenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung formulierten, wobei das Ausgegrenzte dann auch für die eigene Argumentation überflüssig gemacht wurde. Inzwischen haben auch konservative Positionen diese Mode übernommen, wie z. B. an der pauschalen Diffamierung der "kritischen Theorie" zu erkennen ist. Allerdings gab es auch Versuche, unterschiedliche Positionen wissenschaftlich-argumentativ auszutragen, um auf diese Weise zum wenigstens praktischen Konsens zu kommen. Vgl. etwa die Arbeit der nordrhein-westfälischen Richtlinienkommission: Schörken, R. (Hrsg.), Curriculum "Politik", Opladen 1974.
(3) Ich stütze mich hier vor allem auf: Weniger, E., Neue Wege im Geschichtsunterricht (1949), 3. Aufl. 1965, Frankfurt 1965 sowie auf die gründliche Darstellung und Interpretation bei: Blankertz, H., Hoffmann, D., Geschichtsunterricht und politische Bildung, in: Dahmer, I./Klafki, W., Geisteswissenschaftliche Pädagogik am Ausgang ihrer Epoche - Erich Weniger, Weinheim o. J., S. 175 ff.
(4) Weniger, E., Neue Wege..., S. 28
(5) Diese Kritik ist ausführlicher begründet in einer Diskussion mit den Autoren der NRW-Richtlinien Politik. Giesecke, H., u. a.: Pädagogische und politische Funktionen von Richtlinien, in: Neue Sammlung, 2/1974, S. 84 ff.
(6) Von heute aus gesehen ist vielleicht nicht unwichtig daran zu erinnern dass die Frage, ob zum traditionellen Geschichtsunterricht nicht ein eigenständiger politischer Unterricht hinzutreten müsse, seinerzeit allein unter "Konservativen" ausgetragen wurde. Jedenfalls unterschieden sich die politisch-ideologischen Grundpositionen von F. Messerschmid und A. Bergsträsser, die damals den politischen Unterricht favorisierten, nicht erkennbar von der Erich Wenigers. "Linke" Positionen kamen erst etwa Mitte der sechziger Jahre zur Geltung.
(7) Der Zusammenhang der hier skizzierten Veränderungen - insbesondere die neue Rolle des Jugendlichen in Familie und Öffentlichkeit - erklärt im übrigen auch noch einmal die Notwendigkeit und die didaktische Fruchtbarkeit konfliktorientierter Ansätze in der Politischen Bildung. Unter anderen Bedingungen - z. B. Anfang der fünfziger Jahre - hätten diese nicht einmal bei den Schülern eine nennenswerte Chance gehabt.
(8) Als Beispiel für diesen Zusammenhang mag die Doppeldeutigkeit des Postulats nach "lebenslangem Lernen" dienen. Einerseits soll es der Souveränität der Menschen nützen, insofern [/ S. 175:] diese sich gewandelten gesellschaftlichen Verhältnissen anpassen können. Andererseits aber ist der leitende Maßstab für diese Anpassung der Wandel der Verhältnisse und z. B. nicht auch die biographische Integrationsfähigkeit der geforderten Anpassung, im Gegenteil: Wenn die subjektiven Möglichkeiten den objektiven Erwartungen nicht entsprechen, wirkt dies diskriminierend - wenn z. B. Arbeitnehmer mit Rücksicht auf ihre familiäre und persönliche Kontinuität sich weigern, ihren Wohnsitz immer dorthin zu verlegen, wo sich zufällig gerade ein Arbeitsplatz anbietet. Insofern das Postulat des "lebenslangen Lernens" der biographischen Kontinuität gleichgültig gegenübersteht, macht es das bisher Gelernte und Gelebte zu etwas, das der Person bloß äußerlich bleibt und jederzeit zum "Wegwerfen" verurteilt sein kann. In diesem Sinne sind die herrschenden technologisch-ökonomischen Prinzipien der gesellschaftlichen Entwicklung inzwischen weitgehend durchgeschlagen auf Sozialisations-Karrieren, die sie nach ihrem Bilde präformieren.
(9) Die tatsächliche Geschichte des historischen Unterrichts in Deutschland muss hier aus Raumgründen ausgeblendet bleiben, die Rede ist hier nur von Wenigers didaktischem Konzept. Aber der "konservative" Charakter der deutschen Geschichtswissenschaft nach der Reichsgründung und auch des Geschichtsunterrichts zumindest bis Mitte der sechziger Jahre dürfte heute kaum mehr strittig sein. Auch dies war für manche "konservative" Autoren ein Argument für die Einführung eines eigenständigen politischen Unterrichts. Vgl. etwa Besson, W., Zur gegenwärtigen Krise der deutschen Geschichtswissenschaft, in: Gesellschaft-Staat-Erziehung, 3/1963, S. 302 ff.
(10) Solche Bedenken entzündeten sich z. B. an der Diskussion der Hessischen Rahmenrichtlinien "Gesellschaftslehre". Vgl. dazu Giesecke, H., Neue Hessische Rahmenrichtlinien für den Lernbereich "Gesellschaftslehre, Sekundarstufe I", in: Neue Sammlung, 2/1973, S. 130 ff.
(11) Auch dieses Problem gilt keineswegs nur für den Geschichtsunterricht, sondern zumindest für alle diejenigen Schulfächer, für die normative Inhalte konstitutiv sind, die innerhalb eines gesellschaftlich zugelassenen Rahmens entschieden werden dürfen. Ausführlicher dazu: Giesecke, H., Die Schule als pluralistische Dienstleistung. und das Konsensproblem in der politischen Bildung, in: Schiele, S./Schneider, H. (Hrsg.), Das Konsensproblem in der politischen Bildung, Stuttgart 1977, S. 56 ff.
(12) Vgl. u. a.: Mollenhauer, K., Theorien zum Erziehungsprozess, München 1972. Ulich, D., Pädagogische Interaktion, Weinheim 1976.
[/ S. 176:]
(13) Vgl. Giesecke, H., Didaktik der politischen Bildung, 10. Aufl. München 1976.
(14) Vgl. Giesecke, H., Methodik des politischen Unterrichts. München: Juventa, 3. Aufl. 1975 - Auch methodische Variationen wie Rollenspiel, Planspiel, Tribunal, Produktion lassen sich - vom Standpunkt des jeweiligen historischen Ereignisses aus - verwenden.Literatur
Berger, Thomas (1977): Geschichtsdidaktik. In: b:e. 1977 (8), Seite: 53 ff.
Besson, W. (1963): Zur gegenwärtigen Krise der deutschen Geschichtswissenschaft. In: Gesellschaft-Staat-Erziehung. Jg. 8 (3), Seite: 302 ff.
Blankertz, Herwig, Hoffmann, Dietrich (1968): Geschichtsunterricht und politische Bildung. In: Dahmer, Illse; Klafki, Wolfgang (Hg.): Geisteswissenschaftliche Pädagogik am Ausgang ihrer Epoche - Erich Weniger. Weinheim [u.a.]: Beltz, Seite: 175 ff.
Giesecke, Hermann (1973): Neue Hessische Rahmenrichtlinien für den Lernbereich "Gesellschaftslehre, Sekundarstufe I". In: Neue Sammlung. Jg. 13 (2), Seite:130 ff.
Giesecke, Hermann u. a. (1974): Pädagogische und politische Funktionen von Richtlinien. In: Neue Sammlung. 1974 (2), Seite: 84 ff.
Giesecke, Hermann (1975): Methodik des politischen Unterrichts, 3. Aufl. München: Juventa.
Giesecke, Hermann (1976): Didaktik der politischen Bildung, 10. Aufl. München: Juventa.
Giesecke, Hermann (1977): Die Schule als pluralistische Dienstleistung. und das Konsensproblem in der politischen Bildung. In: Schiele, Siegfried; Schneider, H. (Hg.): Das Konsensproblem in der politischen Bildung. Stuttgart, Seite: 56 ff.
Herbst, Karin (1977): Didaktik des Geschichtsunterrichts zwischen Traditionalismus und Reformismus. Hannover: Schroedel.
Mollenhauer, Klaus (1972): Theorien zum Erziehungsprozess. München: Juventa.
Schörken, Rolf (Hg.) (1974): Curriculum "Politik". Opladen: Leske.
Süssmuth, Hans (Hg.) (1972): Geschichtsunterricht ohne Zukunft? 2 Bände. Stuttgart: Klett.
Ulich, Dieter (1976): Pädagogische Interaktion. Weinheim: Beltz.
Weniger, Erich (1965): Neue Wege im Geschichtsunterricht (1949), 3. Aufl. Frankfurt am Main: Schulte-Bulmke.
Ergänzung fehlender Vornamen im Literaturverzeichnis (Blankertz u.a. 1968) durch sowi-online.
Jeismann, Karl-Ernst; Kosthorst, Erich (1979): Geschichte und Gesellschaftslehre. Die Stellung der Geschichte in den Rahmenrichtlinien für die Sekundarstufe I in Hessen und den Rahmenlehrplänen für die Gesamtschulen in Nordrhein Westfalen. Eine Kritik
I. Gesellschaftslehre (Hessen) bzw. Gesellschaft/Politik (NW) als Kernstück der Innovation durch Gesamtschulen - Das Problem der Integration
Die Gesamtschulen in Hessen und NW, ursprünglich als Schulversuch deklariert, können längst nicht mehr als pädagogische Experimente gelten - sie sind nach den Aussagen der verantwortlichen Kultusminister und ihrer Mitarbeiter die Regelschulen der Zukunft. Mit ihnen wurden nach eigenem Anspruch nicht etwa nur Reformen in die Wege geleitet, sondern "schrittweise durchzuführende ,Innovationen' an der Gesamtstruktur des Bildungswesens" (NW. Vorwort, S. 2).
Ein Kernstück der Innovation ist die Erneuerung der Lehrpläne von Grund auf (NW. Vorwort, S. 3); in ihrem Zentrum steht die Integration der bisher selbständigen bzw. kooperierenden Schulfächer Geschichte, Sozialkunde, Geographie und Arbeitslehre zu einem einheitlichen Lernbereich "Gesellschaftslehre" (Hessen) oder "Gesellschaft/Politik" (NW), mit dem die generell intendierte Befähigung der Schüler zur "Teilnahme an der produktiven Gestaltung gesellschaftlicher Realität" in erster Linie erreicht werden soll (H. S. 7; NW. S. 1).
Die folgende Untersuchung fragt nach dem Stellenwert der Geschichte in diesem zentralen Lernbereich der künfti- [/S. 30:] gen Regelschule. Die Antwort auf diese Frage ist für unsere Schule und unsere Gesellschaft von höchster Bedeutung. Mit der Analyse wird jedoch, das sei gegenüber möglichen Missverständnissen ausdrücklich gesagt, keineswegs das Konzept der Gesamtschule als solcher mit ihrer fundamentalen Zielsetzung des "Abbaus bestehender Chancenungleichheit der Schüler" und der "Vermittlung sozialintegrativer Lerninhalte und eines entsprechenden Verhaltens" (NW. Vorwort, S. 9/10) infrage gestellt.
Vorweg sei ebenfalls erklärt, dass die Integration der Geschichte in ein mehrere sozialwissenschaftliche Teilbereiche umfassendes allgemeines Unterrichtsfeld Gesellschaft/Politik als ein notwendiger Versuch zur didaktischen Zusammenführung von einander korrespondierenden Wissenschaften begrüßt wird. Eine unerlässliche Forderung an jede Art von Integration bleibt jedoch, die Integrationsfaktoren in ihrem je spezifischen Potential nicht auszulöschen, sondern interdependent zur Entfaltung kommen zu lassen, was u. a. auch bedeutet, das Interaktions- und Spannungsfeld der zugehörigen Wissenschaften zu erhalten. Es sei ausdrücklich vermerkt, dass die "Rahmenrichtlinien" (Hessen) wie auch die "Rahmenlehrpläne" (NW) angesichts der schwierigen theoretischen und praktischen Probleme der intendierten Integration den beteiligten Lehrern aus wohlbegründetem Pragmatismus eine Schonfrist, einen Lernprozess zubilligen und "Koordination" dort gestatten (H. S. 41; NW. S. V), wo das Maximalprogramm der Integration organisatorisch und personell noch nicht durchführbar ist. Die Begründung für die didaktische Notwendigkeit der Integration sowie ihrer zeitweiligen Suspendierung erfolgt in den hessischen Richtlinien in auffälligem Unterschied zum lapidaren Befehlston der NW-Lehrpläne in einer vorsichtigen, differenzierten und verbindlichen (demokratischen) Sprechweise. Gegenüber der im hessischen Plan vorgenommenen Wortwahl "Verschränkung", "gemeinsamer Bezugsrahmen" (H. S. 11), "Unmöglichkeit jeden Versuchs, Gesellschaftslehre auf der Systematik einer der beteiligten Fachdisziplinen zu begründen" (H. S.13), dekretiert der NW-Plan: "Unterricht im Lernbereich G/P ist grundsätzlich auf Voll- [/S. 31:] integration ausgerichtet und auszurichten" (NW. S. IV).
Die mit diesem dubiosen Begriff "Vollintegration" sich beim Leser sofort herstellende Assoziation eines totalen Zugriffs verfehlt nicht etwa den gemeinten Sachverhalt, sondern trifft, wie sich in der Begriffserläuterung (und später im unterrichtspraktischen Teil) zeigt, das Gemeinte leider nur zu genau: "Damit [mit der "Vollintegration"] ist weder die Addition eines Nacheinander oder Nebeneinander noch eine Kooperation von im Prinzip selbständigen Einheiten gemeint, sondern eine spezielle Qualität: das einheitliche, ungeteilte Ganze" (NW. S. IV). Aus dieser Setzung der Gesellschaftslehre und also auch der Gesellschaft als eines solchen "ungeteilten Ganzen" folgt zwangsläufig das Postulat der Eliminierung fachspezifischer Elemente oder Teilbereiche und ihre Reduktion auf "Aspekte". Die Zulassung von "Koordination" als Surrogat von "Integration" wird im NW-Plan wiederum im lakonischen Kommandoton verkündet - ohne weitere Kommentierung und vor allem ohne nähere pädagogische Dispositionen, wie sie der Hessen-Plan in Rücksicht auf eben nur langsam zu verändernde Vorgegebenheiten vornimmt. Was in den hessischen Richtlinien eher verhüllt und indirekt spürbar ist, das offenbart der Sprechstil der NW-Planer dagegen als Missbilligung einer verkehrten Welt.
In der Mystifikation einer "Vollintegration", eines "einheitlichen, ungeteilten Ganzen" liegt die Verschmelzung der unterschiedlichen Elemente der Gesellschaft und der Ebenen ihrer Analyse. Darin gehen die NW-Rahmenpläne weit über die hessischen Richtlinien hinaus: "Unterricht im Lernbereich Gesellschaft/Politik ist ein Unterricht, der politologische, sozialpsychologische, anthropologische, juristische ökonomische, geographische, historische und andere Aspekte gesellschaftlicher Realität und Möglichkeit in ihrer Komplexität und Interdependenz aufgreifen, einsichtig machen und handlungsrelevant erarbeiten will" (NW. S. I). Dieser voluminöse Satz mit seinem Universalanspruch wäre in den Formulierungen der hessischen Richtlinien so noch nicht vorstellbar. Die NW-Rahmenpläne, die die Rahmenrichtlinien Hessens im übrigen als Modell zu kopieren vorgeben [/S. 32:] (NW. S. III), haben, das lässt sich also schon jetzt sagen, Tendenzen ihres Vorbilds in einem Maximalsinn zu einer Aspekt-Didaktik ausgezogen. Was ist nun die Integrationsmitte, auf die fachspezifische Aspekte hingeordnet werden? Als "oberstes Lernziel" ist dem integrierten Lernbereich Gesellschaftslehre bzw. Gesellschaft/Politik aufgegeben: "Die Befähigung zur Selbst- und Mitbestimmung" (H. S. 7 f.; NW. S. 1 f.). Dieses Ziel ist kein aus Wissenschaft abgeleitetes und auch nicht ableitbares Postulat, sondern eine (wie die hessischen Planer im Unterschied zu den nordrhein-westfälischen ausdrücklich hervorheben) politische, am Demokratiegebot des Grundgesetzes orientierte Setzung. Mit der, politisch-legitim, letztlich auf der Vernunftfähigkeit aller Menschen gegründeten Zielsetzung der "optimale(n) Teilhabe des einzelnen an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen" als "an die Aufhebung ungleicher Lebenschancen geknüpft(e)" (NW. S. 1) Aufgabe ist die politisch-pädagogische Einstellung des Leitziels in den von weither kommenden geschichtlichen Emanzipationsprozess gegeben. Ob dies den Planern bewusst ist, muss freilich bezweifelt werden; sie sprechen den Zusammenhang weder hier noch später an. Im Gegenteil, wo von Geschichte im allgemeinen und geschichtlicher Situation im besonderen die Rede ist, da werden anstelle der emanzipatorischen Potenzen die negativen Erscheinungen in den Vordergrund gerückt: Geschichte als Ansammlung abgelebter Strukturen, Geschichtswissenschaft und Geschichtsbewusstsein als ideologisches Weltbewusstsein, das von der Soziologie destruiert werden muss, das ist - trotz mancher Gegenbeteuerungen - der Grundtenor der Aussagen insgesamt. Eindeutig ist die Dominanz einer unhistorischen Soziologie, deren Provenienz im Diffusen bleibt.
Im Diffusen bleibt nun aber vor allem das "oberste Lernziel", "die Befähigung zur Selbst- und Mitbestimmung". Die Verfasser wissen das selbst und konzedieren, dass die jeweilig mit diesem Lernziel verbundenen Inhalte nur in Beziehung zu konkreten "Anwendungssituationen" deutlich werden. Was aber in bestimmten und nicht vorwegnehmbaren Situationen "Selbstbestimmung oder soziale Gerechtig- [/S. 33:] keit" (zwei Begriffe, die hier fast synonym gebraucht werden, aber in Opposition stehen können) jeweils bedeuten, ist nicht festlegbar. So geraten die Verfasser beim Versuch, das oberste Lernziel zu differenzieren, notwendig in das Dilemma jeder normativen Didaktik. Sie geben sich so, als ob die Unterrichtsentscheidungen aus den obersten Setzungen ableitbar wären. "Tatsächlich aber sind die didaktisch-methodischen Entscheidungsgründe durch viele Faktoren mitbedingt, die nicht aus Sinnormen, wie sie als philosophisch explizierte Vernunftpostulate, als religiös-theologisch ausgelegte Offenbarungswahrheiten oder als Weltanschauungen mit politisch-gesellschaftlichen Zielen auftreten, abgeleitet werden können" (1). Innerhalb des Spielraums der "Sinnormen" sind aber nicht nur verschiedene didaktische Konzeptionen möglich, vielmehr sind hier die Sinnormen so vage, dass sie sogleich ambivalent und kontrovers auslegbar sind. Auch die Verfasser dieser Richtlinien sind der Deduktionsproblematik (2) insofern erlegen, als ihre einzelnen Lernziele keineswegs durch Berufung auf die oberste Setzung gerechtfertigt werden können, sondern jeweils selbst wieder ganz bestimmten Auslegungen dieser Setzung verpflichtet sind, die nun aber nicht mehr begründet, sondern unterschwellig eingeführt werden. Ließen die alten normativen Didaktikmodelle unter dem weiten Deckmantel des obersten "Bildungszieles" dem Lehrer Freiheit, die Stoffpläne hinsichtlich der an den Unterrichtsgegenständen zu gewinnenden Einsichten variabel auszulegen, so ist hier, in einer "lernzielorientierten" normativen Didaktik der Lehrer sehr viel strenger an die Einsicht der Richtlinienverfasser und an ihre Auslegung der obersten Norm gebunden - bis in die untersten Lernziele, bis in die empfohlenen oder vorgeschriebenen und zugelieferten Materialien hinein. Auf diese Weise entsteht eine scheinbar wissenschaftlich abgeleitete, in Wahrheit aber irrationale - d. h. im Entscheidenden der Diskussion und Offenlegung entzogene - Diktatur gesetzter Lernzielketten (3).
Eine so angesetzte politisch-normative Didaktik könnte nun kritisiert werden von den politischen Grundentscheidungen her - nicht von der allerobersten Norm, die min- [/S. 34:] destens verbal wohl in den meisten politischen Systemen der Welt Applaus findet -, sondern von den in den einzelnen Ausführungen, Frageansätzen, Blickausrichtungen, Lernzielformulierungen, Vorbehalten, Materialhinweisen usw. versteckten konkreten politischen Entscheidungen. Es wäre zu fragen, ob hier nicht eine Sicht vom Zustand wie von Veränderungstendenzen der Gesellschaft zugrunde liegt, die sich sehr viel genauer ausweisen müsste, ehe sie in Form von ministeriellen Richtlinien allen Schulen auferlegt werden dürfte. Es hat bisweilen den Anschein, als ob hier ein dialektisches Denkmuster durchschlägt, das die Schüler in der Gegenwart die Gesellschaft als ein schichten-/ klassen-/gruppenantagonistisches Modell sehen lehrt, in dem alles Denken nur Mittel im Kampf aller gegen alle ist - dass aber mit dem Zauberwort "Veränderung" die Richtung auf ein Harmoniemodell des Ausgleichs aller Ungleichheit, der sozialen Gerechtigkeit wie der Selbst- und Mitbestimmung zugleich eingeschlagen wird.
Aber hier geht es nicht um die Auseinandersetzung mit den nur diffus erkennbaren Konturen der Ausfüllung der obersten Norm, des "Demokratiegebotes". Gewiss ist richtig, dass eine politisch normative Didaktik zunächst in ihren politischen Setzungen zu kritisieren ist; hier geht es sehr viel bescheidener lediglich um die Untersuchung der didaktischen Dignität, also der Frage, ob die Entwürfe, gemessen an ihren eigenen Intentionen, stichhaltig sind. Die Frage nach der "Parteilichkeit" bleibt also aus dem Spiel.
In diesem Zusammenhang lässt sich hier schon die Hauptfrage umreißen, die sich immer wieder herandrängt: Ist die Zurückweisung der fachwissenschaftlichen Aspekte hinter eine politisch-didaktische Setzung nicht ein vielleicht unbewusst gebrauchtes Mittel, Instanzen der Kritik an einem im einzelnen voluntaristisch gesetzten Unterrichtsmodell auszuschalten? Denn die Reduzierung der Gesellschaftsvorstellung auf die konfliktträchtigen Antagonismen (ein allenfalls historisch verständlicher Gegenschlag gegen die "Institutionenkunde") und die Destruktion der Geschichte zum Instrumentarium für Orientierung oder Legitimierung von Gegenwartsaktionen findet in den systematischen wie hi- [/S. 35:] storischen Sozialwissenschaften ein Widerstandspotential gegen verzerrende Einseitigkeiten. Die Erfahrung, dass in der neueren Geschichte "Veränderungen" immer dann regressive, reaktionäre Veränderungen waren, wenn sie die Wissenschaften mediatisierten - unter welchen politischen Vorentscheidungen immer -, zwingt zu einer kritischen Untersuchung von Richtlinien und Lehrplänen, die sich ausdrücklich als Ableitungen aus einer politischen Norm zu erkennen geben. Hier geschieht das unter Begrenzung auf die Funktion, die der Geschichtswissenschaft und dem Geschichtsunterricht in dem neuen politischen Rahmenfach zugewiesen wird.
Das Geschichtsverständnis und die in ihm begründete gesellschaftliche Rollenzuweisung für Geschichtswissenschaft und Geschichtsunterricht innerhalb der Gesellschaftslehre artikulieren sich programmatisch in den allgemeinen Ausführungen zum "Arbeitsschwerpunkt Geschichte" (H. S. 18-30) bzw. zum "Historischen Aspekt" (NW. S. 15-20) und in der unterrichtspraktischen "Strukturierung der Lernfelder" (H. S. 47-311) bzw. "Unterrichtsorganisation" (NW. S. 29-131) (4).
II. Die hessischen Rahmenrichtlinien für die Gesellschaftslehre, Sekundarstufe I, Teil A
1. Das didaktische Modell
Die "Integration" bislang selbständig unterrichteter Fächer, die hinsichtlich ihrer Methoden, Kategorien und Aussagen auf eine Fachwissenschaft rückbeziehbar blieben, in einen Gesamtlernbereich, der nunmehr von einer politisch-didaktischen Vorentscheidung her strukturiert wird, bezeichnet das Kernproblem dieser Richtlinien: die Frage, ob rationale, am Wissenschaftsstand kontrollierbare Lerninhalte und -methoden politische Vorentscheidungen differenzierter reflektierbar machen können oder nicht.
Der Ansatz ist eindeutig geprägt vom Primat einer politischen Zielvorstellung; Didaktik ist die Fortsetzung der Poli- [/S. 36:] tik mit pädagogischen Mitteln. Nun ist gegen die Beziehung der "Gesellschaftslehre" auf die "Gesellschaft", der Erziehung auf die Verfassung grundsätzlich nichts einzuwenden: der Zusammenhang beider gehört seit Aristoteles zur immer wieder formulierten politischen Grunderkenntnis (5). Aber entscheidend ist die Art, in der dieser Zusammenhang hergestellt wird. Man erkennt das Problem deutlicher, wenn man es - das kann hier nur andeutend geschehen - in seinen historischen Zusammenhang rückt.
Das didaktische Modell der direkten politischen Funktion der Erziehung, wie es in der Bundesrepublik wieder vorzudringen scheint, wird am deutlichsten in den Jakobinischen Erziehungsplänen der französischen Revolution. Das "Demokratiegebot" der neu geschaffenen Verfassung soll aus den Gesetzen in die Gemüter getragen werden, und zwar unmittelbar. Ziel aller Erziehung soll sein das "richtige" politische Verhalten und Handeln. Wissen und Einsicht bleiben dem normativ vorgesetzten Handeln untergeordnet, d. h. sind nicht Voraussetzung oder Kritik politischer Entscheidungen sondern deren Legitimation. Die "eigentümliche Wissenschaftsfeindlichkeit" (6) dieses didaktischen Modells ist Konsequenz des Misstrauens in die Freiheit - nicht nur des Individuums, sondern auch der kommenden Entwicklung; die eigene Doktrin darf daher nicht der freien und unberechenbaren wissenschaftlichen Untersuchung ausgesetzt werden, die Heranwachsenden müssen zur Gewissheit und Sicherheit ihres Tuns, nicht zur kritischen und zweifelnden Prüfung erzogen werden. "Der Staat will nicht, dass die Geister und Gemüter irre gehen; darum führt und leitet er sie, indem er sie mit seinen Lehren panzert. Der Mensch bedarf einer Kräftigung des Zusammengehörigkeitsgedankens, er bedarf einer Theorie, die ihm Ursprung und Beschaffenheit der Wesen erklärt, ihm seinen Platz und seine Rolle in der Welt anweist" (7).
Unverkennbar, dass in diesem Modell das ältere, religiös fundierte, dogmatische Sozialisationsprinzip säkularisiert wieder aufgenommen wurde. Deshalb eignete es sich auch nicht nur für den demokratischen Zentralismus jakobinischer Prägung, sondern gleichermaßen für konträre Inhalte: [/S. 37:] der napoleonische Cäsarismus konnte es ebenso übernehmen wie die deutsche Pädagogik der Restauration oder des nationalen Staates mit imperialistischer Sendungsidee; dass es heute unter den verschiedensten Etiketten kräftig weiterlebt, braucht nicht erst gezeigt zu werden.
Diesem Typus stand aber ebenfalls schon in der Französischen Revolution ein anderer gegenüber. Es gehört zum europäischen Demokratiebegriff - und das ist sein Widerstandspotential gegen den despotischen Demokratismus - nicht nur das Postulat der Gleichheit, sondern als Basis dieses Postulats der Begriff der Autonomie, der Mündigkeit, der Selbstverantwortlichkeit des Menschen, und zwar jedes einzelnen. Selbstbestimmung aber ist nur denkbar als eigene Tätigkeit; eigene Tätigkeit kann nur Folge eigener Entscheidung und also eigener Denkfähigkeit sein. Von diesem Ansatz her versteht sich ein Erziehungsmodell, das auf Entwicklung der Urteilsfähigkeit abzielt. Entwicklung der Urteilsfähigkeit aber ist nicht anders mehr möglich als durch Rückgriff auf wissenschaftliche Methoden des Denkens. So durchbricht dieses Modell den Kurzschluss zwischen Theorie und Praxis und baut wissenschaftliche Bildung als den Weg zur Selbstbefreiung des Menschen an zentraler Stelle in den Unterricht ein. Condorcets Erziehungsplan ist dafür das deutlichste Beispiel (8). Kant und Humboldt versuchten - vergeblich - diese Erziehungsvorstellung zu realisieren. Sie unterlagen der direkten politisch-pädagogischen Aktion der Restauration, so wie Condorcet den Jakobinern und diese wiederum dem imperialen Cäsarismus.
Dieses zweite Modell ist nun keineswegs unpolitisch. Aber es ist nur möglich in einer freien Demokratie - d. h. bei einer Gesellschaftsverfassung, die sich nicht auf ein geschlossenes System einer politischen Theorie stützen muss, sondern die es vermag, unterschiedlichen Positionen Spielraum zu geben - nicht notgedrungen, sondern als Quintessenz der Auffassung, dass nur Vielfalt und Selbsttätigkeit den Prozess der Humanisierung vorwärtstreiben können; eine Gesellschaftsverfassung, die sich selbst in Frage zu stellen bereit ist und gerade zu diesem Zweck der freien Wissenschaft bedarf; die es zulässt, geradezu verlangt, dass der zur [/S. 38:] Selbstbestimmung gebildete Mensch die Verfassung an sich prüft (9); eine Verfassung, die nur an einer Grenze politischer "Veränderung" Halt gebieten muss: dort, wo dieser Grundsatz der Selbstverantwortlichkeit, der Selbstbestimmung, der Freiheit der Prüfung und Kritik selbst zugunsten einer normativen politischen Dogmatik aufgehoben werden soll.
Diese hier extrem vereinfachten Positionen zeigen den Antagonismus aller Konzeptionen der öffentlichen Erziehung seit dem späten 18. Jahrhundert. Auf der breiten Skala der Zwischen- und Mischformen ordnet sich bewusst oder unbewusst jeder didaktische Ansatz ein.
Wo stehen die hessischen Richtlinien?
Grob gesagt: sie reflektieren diesen Antagonismus nicht und schwanken zwischen beiden Positionen im einzelnen hin und her, haben im ganzen aber eine deutliche Schlagseite zur "Überzeugungsdidaktik", der Verpflichtung aller auf ein vorinterpretiertes Gesellschaftsbild. Das zeigt sich schon im Ansatz der Aufgliederung: Von einer politischen Maxime, aus der das oberste Lernziel in seinen drei Dimensionen: Erkennen - Urteilen - Handeln (H. S. 9) mit ausgesprochener Priorität des Handelns gewonnen wird, gehen sie über zu einer Aufgliederung des Gesamtgebietes in "Lernfelder". Wenn man die etwas unklaren Ausführungen richtig versteht, strukturieren diese "Lernfelder" den Unterricht, indem sie als vorgebliche Sektoren der Gesellschaftserfahrung den Rahmen für die Einordnung von Lernsituationen geben. Denn die Wissenschaftssystematik ist als didaktisch ungeeignete Struktur deklariert. So hatte schon Eduard Spranger im Leiden an der modernen, wissenschaftsorientierten Welt seine "Heimatkunde" (10) gegen die Wissenschaftssystematik konzipiert als das "einheitliche, ungeteilte Ganze" (NW. S. IV). Aber das ist nur die eine Seite. Im politischen Ansatz der Rückbeziehung auf das Grundgesetz steckt ja notwendig das Prinzip der Selbstbestimmung, und man sieht es immer wieder an verschiedenen Stellen durchbrechen, aber rudimentär und nicht klar ausgewiesen (H. S. 7). Die Wissenschaftsfeindlichkeit des Ansatzes wird durchkreuzt von einer nicht näher reflektierten, selektiven Aus- [/S. 39:] geliefertheit an Wissenschaft. Die Lernfelder sind ja keineswegs Erfahrungszentren; sie sind im Grunde selbst Wissenschaftsdisziplinen, die das komplexe Erfahrungsfeld bereits abstrahieren: Sozialisationsforschung - Wirtschaftswissenschaften - und zwei Disziplinen der Politikwissenschaft: Innere Politik und Internationale Beziehungen. So stellt sich heraus, dass im Grunde unter dem Anspruch des Primats politischer Didaktik der Begründung entzogene und willkürlich aus dem Bewusstseinsstand der Verfasser zitierte Wissenschaftssegmente soziologischer und teilweise wirtschaftswissenschaftlicher und politikwissenschaftlicher Provenienz sich hervordrängen. Steckt hinter dem Zurückdrängen der "Fächer" und der ihnen zugeordneten Wissenschaften also nichts als ein neuer "Streit der Fakultäten"?
Die Verfasser meinen es wohl nicht so. Sie unterwerfen die wirkliche oder die verlangte Erfahrung einer Vierteilung, die als Erkenntniszusammenhang deklariert das neue Einheitsfach strukturiert. Erst innerhalb dieser Vierteilung werden dann jeweils die Wissenschaften - Sozialwissenschaften, Geschichtswissenschaft, Geographie - nach ihrem möglichen didaktischen Wert befragt, sie werden zu "Arbeitsbereichen" oder zu "Aspekten". Ob sie selbst lernzielbestimmend sein dürfen, wird im Hessenplan nicht ganz deutlich (H. S. 13); in NW wird es strikt abgelehnt, ganz im Sinne der unten zu zeigenden Tendenzverschiebung (NW. S. 11).
So anspruchsvoll also diese Richtlinien mit einem scheinbar ganz neuen Ansatz daherkommen - so hilflos verwirrt ist die Grundkonzeption.
Wie nimmt sich nun in diesem Rahmen der "didaktischen" Vorentscheidungen der "Arbeitsschwerpunkt Geschichte" aus?
2. Der "Arbeitsschwerpunkt Geschichte"
Die Lektüre der Ausführungen zum Arbeitsschwerpunkt Geschichte hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Der Sprachgestus reklamiert einen erheblichen Anspruch der Selbstgewissheit über das, was Geschichtsunterricht und [/S. 40:] Geschichtswissenschaft sein müssen und nicht sein dürfen; diesem Anspruch kontrastiert merkwürdig die verworrene Gedankenführung und die strukturelle Unklarheit der Aussagen sowie die offensichtlich weithin fehlende Sachkompetenz der Verfasser hinsichtlich des wissenschaftlichen und theoretischen Hintergrunds ihrer Behauptungen. Es muss wohl in der Tat eine rein "politische" Entscheidung des Kultusministeriums gewesen sein, Fachwissenschaftler und Fachdidaktiker von der Erarbeitung auszuschließen (s. u. Anm. 20). Politisch deuten könnte man auch die Ambivalenz der Formulierungen, die sich genauer Festlegung durch einen assoziativ reihenden Stil entzieht ("nicht allein", "darüber hinaus", "auch"). Die Wichtigkeit eines solchen Papiers verlangt eigentlich eine Satz für Satz fortschreitende genaue Analyse von Inhalt und Sprache: das aber wäre ein Kommentar, der den Umfang der Richtlinien übertreffen würde. Hier können nur einige Bemerkungen zu wesentlichen Punkten gemacht werden.
a. Die "zentrale Aufgabe" und deren Begründung
Volle Zustimmung kann die Formulierung der "zentralen Aufgabe" finden, "ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein aufzubauen" (H. S. 21); nur ist diese Formulierung für sich eine Leerformel und besagt nicht viel anderes als etwa die ältere Zielforderung des "historischen Verständnisses". Es kommt also alles darauf an, wie diese begründet und wie sie nach diesem Ansatz angegriffen werden soll.
Wie sieht ein solches Geschichtsbewusstsein aus? Wie kommt es zustande? Da sind zunächst die Abgrenzungen: der Angriff gegen eine antiquarische Geschichtsauffassung, die meint, "objektiv gesicherte Daten und Tatsachen, die unabhängig von unserem Bewusstsein, von unserer jeweiligen gesellschaftlichen Interessenlage existieren", als abgeschlossene Vergangenheit repräsentieren zu können (H. S. 19). Das hier angesprochene, sehr komplizierte erkenntnistheoretische Problem, das seit dem Nominalismus-Realis- [/S. 41:] mus-Streit des Mittelalters geführt wird, ist für die Verfasser gelöst. "Die in letzter Zeit intensiv geführte erkenntnistheoretische Diskussion" habe eine solche Vorstellung als "objektivistischen Irrtum" erwiesen. Diese Bemerkung ist angesichts der differenzierten und keineswegs abgeschlossenen Auseinandersetzung mindestens spaßig (11). Offenbar kennen die Vf. das Problem nicht, sonst könnten sie nicht Banalitäten als Erkenntnisstand ausgeben. Da waren alte Didaktiker kenntnis- und gedankenreicher. Sie unterschieden sehr wohl zwischen der Geschichte selbst, die ohne unser Zutun existiert und von der wir nicht nur in bestimmter Absicht geschriebene, ideologieverdächtige Quellen ("Tradition"), sondern auch "Überreste" haben - und unserem Wissen von Geschichte, das in einem schwer zu analysierenden Oszillationsprozess zwischen der Überlieferung und ihrer Deutung entsteht (12). Auf einen salto mortale vom "objektivistischen Irrtum" in eine präsentistische Instrumentalisierung von Geschichtsbewusstsein lässt sich die anspruchsvolle zentrale Aufgabe nicht begründen. Das Muster der Ideologiekritik schlägt hier überall durch, und zwar in seiner vulgären Form, die sich der Untersuchungen der Wissenssoziologie oder der Arbeiten über das Problem der "Ideologie" nicht mehr versichert. So ist Geschichte als Bewusstsein stets nur Geschichte für uns, klassen- oder schichtenspezifisch, interessegebunden verstanden, im Dienste irgendeiner Absicht, Legitimierungsmaterial (H. S. 27).
Nun bleibt nicht aus, dass die Verfasser bei dieser Sicht auf das alte Problem des Relativismus stoßen. Gibt es denn überhaupt keine mindestens relativ gültigen Aussagen über die Vergangenheit? Bezeichnend ist nun, dass nicht dieses Problem an sich ernst genommen wird, sondern nur die Tatsache oder die Vermutung zählt, dass die Schüler bei einer solchen Geschichtssicht jedes Interesse an der Geschichte verlören. Da das aber nun nicht sein darf, weil ja Aussagen über Geschichte politische Kampfmittel sind, muss also ein Ausweg gefunden werden. Und nun bietet sich die Geschichtswissenschaft an: mit Hilfe ihrer wissenschaftlichen Methoden ist eine Überwindung der Beliebigkeit möglich; Aussagen müssen der wissenschaftlichen Quellenkritik standhalten (H. S. 20). [/S. 42:] Zwar bleibt unerfindlich, wieso die wissenschaftliche Quellenkritik unter den sonst hier gemachten Voraussetzungen in der Lage sein soll, die allgemeine Ideologiegebundenheit zu durchbrechen. Hier springt man aus dem einen theoretischen Zusammenhang in den anderen. Nachdem man zunächst einen halb rezipierten Habermas vorstellte und die generelle Interessegebundenheit der Erkenntnis nachdrücklich vor Augen rückte, greift man nun zurück auf das Prinzip der Wertfreiheit der Wissenschaft und bietet ein Stückchen Max Weberschen Gedankengutes: Geschichtliche Reflexion kann keineswegs Entscheidungen vorwegnehmen, aus ihr sind nicht Handlungsanweisungen abzuleiten; sie kann aber, indem sie die Bedingungen gegenwärtiger Verhältnisse erhellt, zur Rationalität der Entscheidungen beitragen (H. S. 20).
Der Leser, der auch dieser Meinung ist, fragt sich verwundert, was denn nun gilt und wie eins zusammen mit dem anderen gelten soll. Einerseits wird die Wissenschaft dem Interesse nachgeordnet, andererseits als Kritikinstanz davon getrennt. Ist es einfach eine unklare Position, die nicht konsequent auf das Denkmuster setzt, dass jede Wissenschaft letztlich nichts anderes sei als Politik? Von dieser Denkform her ließe sich ja das "Jakobinische" Didaktikmodell "rechtfertigen". Oder ist es so, dass lediglich die für sich und in ihrer Begrenzung richtige Erkenntnis der Standortgebundenheit und Instrumentalisierbarkeit historischer Aussagen hier als didaktisches Prinzip verabsolutiert wird?
Man wird das letztere annehmen dürfen. Aber es hat fatale Konsequenzen. Denn nach der Feststellung, dass die Geschichtswissenschaft die Verfahren liefere, die interessengebundene Beliebigkeit von Aussagen auf ihre Berechtigung zurückzuführen, müsste konsequenterweise nun entwickelt werden, wie es möglich ist, Schüler die Grundelemente dieses kritischen Verfahrens handhaben zu lehren, damit sie instrumentalisierten Geschichtsaussagen gegenüber nicht hilflos bleiben. Denn was sonst wäre Befähigung zu "reflektiertem Geschichtsbewusstsein", als die Mittel der Reflexion anwenden zu lehren? Genau das geschieht aber nicht. Die Aussage über die Geschichtswissenschaft als kritisches Verfahren [/S. 43:] bleibt folgenlos. Der Gedankengang pendelt um diese Konsequenz herum und gerät wieder in das Gleis der unausweichlichen Ideologiegebundenheit aller Erkenntnis. So kann man auch nirgends sehen, wie nach diesem Konzept ein didaktischer Weg zu finden sein soll, der zur "zentralen Aufgabe" hinführt. Statt dessen werden dann fragwürdige Vermutungen über Erwartungshaltungen der Schüler geboten, die als didaktische Ausgangspunkte dienen sollen: nun gut, aber wozu Ausgangspunkte, wenn kein Weg zum Ziel führt?
Ganz deutlich muss eingewandt werden: ein didaktischer Ansatz, der versäumt, Fähigkeiten zu entwickeln, die es erlauben, historische Verhältnisse überhaupt erst einmal soweit wie möglich objektiv - d. h. quellen- und standortkritisch - für sich zu untersuchen und aufzunehmen, kann nicht zur Rationalisierung politischer Entscheidungen beitragen. Die zusammenfassend formulierten Aufgaben am Schluss hängen in der Luft (H. S. 30).
Man geht wohl nicht fehl, wenn man das Entfremdungsverhältnis, in dem die Verfasser zur Wissenschaft stehen, für diese eigentümlich unklaren Verwirrungen des didaktischen Ansatzes verantwortlich macht - warum sonst scheuen sie im Arbeitsbereich Geschichte vor den Folgerungen zurück, die sich aus der eigenen Behauptung ergeben, die im Arbeitsbereich Sozialwissenschaften wenigstens annähernd anerkannt sind: nämlich die Wissenschaft zu befragen, was sie "zur Vermittlung von erschließenden Kategorien und grundlegenden Erkenntnissen beizutragen" habe- wenngleich auch hier diese Kategorien "einer didaktischen Überprüfung" unterzogen werden sollen. Ein seltsamer Gedanke: Didaktik als Metawissenschaft, die wissenschaftliche Kategorien an "Erfahrungen der Schüler" prüfen will (H. S. 13)!
b. "Veränderung" und "Kontinuität"
Es ist eine wichtige und im Lernprozess zu thematisierende Einsicht, dass die Gegenwart und ihre Verhältnisse nichts unabänderlich Gegebenes sind, sondern im historischen [/S. 44:] Prozess von Menschen herbeigeführt und also nur ein Moment dieses Prozesses sind. Zu Recht wird dem Arbeitsbereich Geschichte zugewiesen, "Veränderung erfahrbar zu machen" (H. S. 23). Wenn in den gesamten Richtlinien nun immer wieder das Prinzip Veränderung sehr stark betont wird, man also annehmen darf, dass unter dem Primat des politischen Ansatzes ein Verhalten bewirkt werden soll, das die Gegenwart überwindet, so wäre nun dringend erforderlich - unter dem Lernziel der Rationalisierung von Entscheidungen durch geschichtliche Reflexion -, dass dieser zentrale Begriff nicht einfach immer wieder formal wiederholt würde. Veränderungen in der Geschichte können vielfältiger Art sein. Nicht immer ist von vornherein zu sagen, inwieweit sie Progression (unter dem Postulat des Demokratie- und Selbstbestimmungsgebots), inwieweit sie Regression sind. Veränderung an sich kann fragwürdig sein. Diese Ambivalenz von Veränderung, von der die Geschichte so ausdrücklich zu sagen weiß, kommt nirgends in den Blick. Zwar heißt es richtig, man dürfe keine "isolierte Erfahrung von Veränderung" vermitteln - aber was heißt das genau? Man kann vermuten, dass die an anderer Stelle ausdrücklich erwähnte historische Komplexität, "die Vielschichtigkeit der Bedingungen", Veränderungen als Gesamtphänomene verständlich machen soll (H. S. 24), dass die Vielschichtigkeit es verbietet, durch Vereinfachungen eine "unwandelbare Gesetzmäßigkeit" vorzutäuschen, die von der "vielschichtigen historischen Analyse" befreie (H. S. 24). Wenn das ernst gemeint ist, müssten wiederum die Instrumente solcher Analyse didaktisch thematisiert werden. Aber die folgenden Fragestellungen gehen über die Grundanalyse hinweg und bezeichnen wieder genau die Interessegebundenheit von Veränderungen allein: ihre Bedingungen, Möglichkeiten, Richtungen - der Bestand gesellschaftlicher Wirklichkeit, in den sie eingreifen - werden an sich nicht ernst genommen. Man hat den Verdacht, dass der Begriff "Veränderung" von vornherein positiv im Sinne "gesellschaftlicher Weiterentwicklung" interpretiert wird.
Er verstärkt sich durch die Art, wie der Begriff Kontinuität verwendet ist. Er sei mitgesetzt mit dem Begriff Verän- [/S. 45:] derung - aber wie? "Im Unterricht" stelle sich Kontinuität her, "indem nach Bedingungen für Veränderung gefragt wird" (H. S. 23). Das bleibt Behauptung. Der Lehrer möge sie verstehen und auf seine Weise lehren, wie solche Bedingungen fassbar sind. Dass auch der Begriff Kontinuität ambivalent ist, dass Kontinuität ebenso sehr Antrieb wie Hemmnis von Veränderung sein kann - das ist gar nicht im Blick. Wie soll aber bei so unklaren Schlüsselbegriffen die hohe Forderung an Lehrer und Schüler eingelöst werden, die Kriterien der Stoffauswahl selbst zu "thematisieren" - ein richtiger Anspruch; nur, wenn er mit unzulänglichen Mitteln erfüllt werden soll, wird er schlimmere Wirkungen zeigen als das als "ahistorisch" beschriebene Kontinuitätsbewusstsein, das aus einem chronologischen Durchgang erwachsen soll (H. S. 23).
c. Die Kritik an anderen Ansätzen
Die Ablehnung des "chronologischen Durchgangs" ist inzwischen eine allgemein verbreitete Forderung; man kann sie unterstützen; nur muss man wissen, dass damit ein dem Prinzip der Veränderung querlaufender Ansatz gewählt wird. Und so geht es auch gar nicht um Ablehnung der Chronologie schlechthin: Alle Unterrichtsthemen dieses Plans folgen dem Prinzip der "relativen Chronologie", was wohl heißen soll, dass der Unterricht Schwerpunkte setzt und Zwischenräume auslässt. Nur, das tat der Geschichtsunterricht schon immer. Und dass chronologisches Vorgehen Gegenwartsbezug nicht ausschließt, dass Gegenwartsbezug eine Sache der Fragestellung ist, wissen die Verfasser an anderer Stelle selbst. Verwechselten sie vielleicht den Aufbau mancher Schulbücher mit dem Unterricht?
Der Angriff gegen den personalisierenden Geschichtsunterricht ist ein Scheibenschießen auf Pappkameraden. Wenn ein Lehrer heute noch so verfährt, helfen auch keine neuen Richtlinien. Aber die Begründung für diese Ablehnung ist nun wieder bezeichnend für den gesamten Ansatz: Nicht weil ein solcher Unterricht den geschichtlichen Sach- [/S. 46:] verhalten nicht gerecht wird, also objektiv falsch ist - oder besser: insofern er für bestimmte Zeiten in unterschiedlichem Grade objektiv falsch ist -, ist er abzulehnen; abzulehnen ist er, weil er dem politischen Erziehungsziel widerspricht, weil er "das Gefühl individueller Ohnmacht verstärkt" (H. S. 25). (Tut er das wirklich, gibt er nicht vielmehr eine falsche Vorstellung von individueller Macht?) Nicht das wissenschaftlich zu prüfende Wahrheitskriterium zählt, sondern die "Auswirkung" (H. S. 25). Heißt das auch, dass ein Geschichtsunterricht, der erwünschte politisch-didaktische Wirkungen hat, eben deshalb schon gerechtfertigt ist? Das passte vortrefflich zum instrumentalisierten Begriff des Geschichtsbewusstseins: es dient dazu, "Urteile und daraus folgende Entscheidungen abzusichern" (H. S. 27).
Die Ablehnung des "thematischen Längsschnittes" wird mit guten Gründen gerechtfertigt. Solche Längsschnitte isolieren in der Tat Einzelphänomene, die nur im "gesellschaftlichen Kontext" gesehen werden sollten. Wissen die Verfasser, wie schwer diese Forderung, wird sie ernst genommen, einzulösen ist? Sie müssten es spätestens bei der Konstruktion der eigenen Unterrichtseinheiten gemerkt haben. Was sie dort tun, ist das Musterbeispiel thematischer Längsschnitte unter den vier Lernfeldern; zwar wird im allgemeinen Teil das unbehagliche Gefühl, gegen eigene Prinzipien zu verstoßen, noch durch alibihafte Hinweise auf herzustellende Zusammenhänge verdrängt (H. S. 23, 28 f.). Dann schwindet es mehr und mehr. Man lese im 4. Lernfeld etwa die Hinweise zur Behandlung des Krieges oder der Stellung des Militärs (H. S. 295 f.). Und wie soll in der 5./6. und 7./8. Jahrgangsstufe zu den thematischen Längsschnitten zum Erziehungswesen der gesamte Kontext geliefert werden?
Richtlinien sind keine Theorie des Geschichtsunterrichts, keine Manifeste guter Meinung oder hübscher Vorstellungen. Sie haben die Pflicht des Realitätsbezuges. Sonst sind sie intellektuell unredlich, indem sie Wunschbilder gegen die Wirklichkeit ausspielen. Es muss die Frage nach der Stundenzahl erlaubt sein, die in diesem Fächerverbund für den historischen Arbeitsbereich zur Verfügung stehen soll. [/S. 47:] Solange, wie in NW, im Höchstfall insgesamt vier Wochenstunden in den Gesamtschulen, in Realschulen und Gymnasien eher weniger Stunden für das gesamte integrierte Fach Gesellschaftslehre angesetzt sind, wird allein aus pragmatischen Gründen über den didaktischen Ansatz und seine Ausführungen in Teil B nicht mehr zu reden sein - es sei denn, man habe gar nicht verstanden, was zur Erarbeitung der genannten Einsichten gehört. Die Materialhinweise in Teil B und die Ankündigung in der Vorbemerkung S. 5 lassen allerdings Schlimmes befürchten.
d. Der "Gegenwartsbezug"
Hier herrscht zunächst eine fröhliche Selbstgewissheit: Beschäftigung mit Geschichte kann sich nur legitimieren (vor wem? dem gesunden Gesellschaftsverstand?) "durch einen Nachweis [!] ihrer Beziehung zu den jeweils relevanten politisch-gesellschaftlichen Problemen" (H. S. 19). Wer aber entscheidet darüber, was relevant ist? Die Schülererwartung? Die wirkliche oder die, die er haben sollte? Wo ist hier der Bezug auf eine eindeutige Gesellschaftsanalyse, die es erlauben würde, auf diese Weise gesichert in die Geschichte zurückzufragen? Angesichts der wissenschaftstheoretischen Diskussion über "Relevanz" kann man hier von bloßem Gerede sprechen, ohne unhöflich zu werden (13). Es herrscht hier ein krasser und unreflektierter Neopositivismus. So geht's, wenn man die Tradition der Wissenschaft für sich nicht ernst nimmt und nur noch als Maßnahmen zur Interessensicherung begreifen kann - weder die sog. "bürgerliche" noch die "marxistische" mit ihren Spielarten, die weiß, dass gegenwärtige Veränderung nur zu erkennen und zu beurteilen ist durch eine Positionsbestimmung der Gegenwart im Gesamtfeld der Geschichte. So kann nicht überzeugen, wenn von "wechselseitiger Verschränkung von Gegenwart und Geschichte" gesprochen wird (H. S. 21): ist doch auch hier Geschichte nicht als Geschichte, sondern nur als Wirkung auf die Gegenwartsfragen gemeint.
Wäre man nun konsequent, müsste man einen präsentisti- [/S. 48:] schen Zugriff entwickeln. Aber sogleich schlägt der Gedankengang wieder Haken. Die Ausführungen S. 21 sind geeignet, den Leser vollends zu verwirren. Nachdem man liest, was der Gegenwartsbezug nicht heißen kann, nachdem eine unverständliche didaktische Aporie konstruiert, der chronologische Durchgang sowie der thematische Längsschnitt abgelehnt sind, kommt dann die Erklärung: "unmittelbar erfahrene Verhältnisse in ihren historischen Bedingungen" müssten "fassbar" werden (H. S. 23). Da sind denn nun wieder die Lernfelder als Gebiete gesellschaftlicher Erfahrung zur Hand und definieren den Gegenwartsbezug: Der Schüler "erfährt" Erziehung, Wirtschaft, öffentliche Aufgaben und zwischengesellschaftliche Beziehungen. In dieser Vierteilung ist die Geschichte zu befragen, das gibt Gegenwartsbezug (H. S. 28)!
Im Grunde ist hier nichts anderes gesagt, als dass der historische Ansatz struktur- und sozialgeschichtlich aufzufassen ist - nur, dass nun die Vierteilung in die Lernfelder die Zusammenhänge zerschneidet, die man doch herstellen möchte. Eine sektorielle Typologie von Gesellschaften ist eigentlich gemeint - und die Ausführungen in Teil B bestätigen das.
Dieser Art von "Gegenwartsbezug" liegt ein soziologisch-systematischer Zugriff auf die Geschichte zugrunde: eine Erscheinung, die durchaus ihre partielle Berechtigung auch in der Wissenschaftsentwicklung hat. Nur kommt in der konkreten Ausfüllung dieses Ansatzes gerade das Prozesshafte der geschichtlichen Welt zu kurz. Nirgends sind die bedeutenden Wandlungen von Gesellschaft ausdrücklich thematisiert und in ihrer Vielschichtigkeit zum Unterrichtsgegenstand geworden; vielmehr reiht sich statisch Bild an Bild - zwar Andersartigkeit, aber nicht eigentlich Veränderung zeigend. Es ist eigenartig, dass die bedeutenden Revolutionen nirgendwo in ihrem ganzen Umfang zum Thema werden - mit einer Ausnahme: der industriellen Revolution in England, die aber auch nur sektoriell behandelt werden soll.
Damit bleibt ein Zentralbegriff der Richtlinien dort unabgedeckt, wo er allein auszufüllen wäre, im historischen [/S. 49:] Bereich. Die Lernfelder erweisen sich als ungeeignet, geradezu als hemmende Begrenzungen für die Aufarbeitung historischer Erfahrung von Veränderung ebenso wie für die historische Erkenntnis von Strukturen. Akzeptabel als vorläufige heuristische Aspekte bei der Erschließung von gesellschaftlichen Zusammenhängen, werden sie als unterrichtsorganisierende Grenzen zum Hindernis von Erkenntnis.
Diese Hinweise mögen genügen, um die Unklarheiten und Widersprüchlichkeiten des grundsätzlichen Ansatzes der Richtlinien zu zeigen. Man muss fragen, in welche der sich kreuzenden Richtungen sich die Praxis bewegen wird, welche Dynamik in diesem Knäuel von Setzungen liegt. Der Blick auf die Rahmenlehrpläne für die Gesamtschulen in NW, die diese Richtlinien ab- und fortschreiben, zeigt eine bereits realisierte negative Möglichkeit der Veränderung und Interpretation dieses Ansatzes.
III. Die Rahmenlehrpläne für die Gesamtschulen in NW ? "Historischer Aspekt"
1. Das Phänomen der Erosion
Das anfangs bereits konstatierte Gefälle von den Rahmenrichtlinien Hessens zu den das hessische Vorbild kopierenden Rahmenlehrplänen NW's hat, wie sich beim Detail-Vergleich zeigt, zu einer Erosion der differenzierten und auf die fachwissenschaftliche Diskussion wenigstens noch hinweisenden Aussagen des Hessen-Plans geführt. In diesem Erosionsprozess sind dabei mehr als nur Facetten abgeschliffen, Nuancen eingeebnet worden; an entscheidend wichtigen Stellen sind nicht nur Vergröberungen und Simplifikationen, sondern auch substantielle Veränderungen festzustellen. Freilich hat nicht allein die Widersprüchlichkeit der Hessen-Richtlinien sich einem radikalen Zugriff nur zu leicht dargeboten; es liegen außerdem Tendenzen in ihnen selbst, die im Maximalsinn auszuziehen geradezu provozieren mussten.
Wenn schon der "Differenzierung der allgemeinen Lern- [/S. 50:] ziele unter fachspezifischen Aspekten" im Hessen-Plan in der Hauptsache nur eine negative Funktion zugewiesen wird, nämlich dies, zu verhindern, "dass bei Unterricht in Einzelfächern die angestrebten Erkenntniszusammenhänge getrennt werden... .", dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn die gröberen Planer in NW die fachspezifischen "Arbeitsschwerpunkte" Hessens überhaupt aufgeben und stattdessen nur noch "fachspezifische Aspekte" auf die soziologische Leitschiene projizieren. Die hessischen Aussagen zur Differenzierung verschärfend fügen sie hinzu: "die in den einzelnen fachspezifischen Aspekten formulierten, an der obersten Zielsetzung orientierten Ziele dürfen nicht als unterrichtsbezogene Lernziele missverstanden werden" (NW. S. 11). Was sind sie dann - versehentlich stehen gebliebene Reste eines Denkens, das sich erst auf dem Wege der Emanzipation von Wissenschaft befindet?
Die Minderung der spezifischen historischen Gewichte wird bereits an der im Vergleich mit dem hessischen Vorbild sofort ins Auge fallenden beträchtlichen Verkürzung der grundlegenden Ausführungen zum "Historischen Aspekt" erkennbar (NW S. 15-20, H., S. 18-30).
Dass die Geschichtswissenschaft im allgemeinen, ihr inzwischen fortgeschrittener wissenschaftstheoretischer Diskussionsstand im besonderen im Bewusstsein der NW-Planer keine Rolle spielen, wäre weniger auffallend, hätten sie sich bei der Beschreibung des "Historischen Aspekts" wenigstens in den Hauptzügen an das Hessische Modell gehalten. Die Defizienz eines eigenen reflektiert-geschichtlichen Bewusstseins hat sie bei ihrem Willen zur Verselbständigung, zur Originalität, zur "Verbesserung" der Vorlage dazu gebracht, die im hessischen Grundsatzteil wenigstens intentional proklamierte Grundfunktion geschichtlicher Unterweisung, den Aufbau eines reflektierten Geschichtsbewusstseins (14), gänzlich aus dem Auge zu verlieren.
Auf die im Hessenplan erst am Ende eines langen Gedankenganges deklarierte "Funktion" der Geschichte läuft man in NW gleich am Anfang schnurstracks zu. Das Omelett wird serviert, ohne dass man zuvor die Eier zerschlagen und umgerührt hätte: "Die in der obersten Zielsetzung erhobe- [/S. 51:] ne Forderung nach Verwirklichung von Selbst- und Mitbestimmung muss in Beziehung gesetzt werden zum Bewusstsein der Betroffenen, d. h. wie sie ihre Möglichkeiten, diese Forderung zu realisieren, einschätzen." "Zur angemessenen Einschätzung dieser Möglichkeiten muss ein G/P-Unterricht unter historischem Aspekt anstreben:
- das individuelle Geschichtsbewusstsein wesentlich als Ergebnis vor- und außerschulischer und schichtenspezifischer Einflüsse erkennbar zu machen,
- gegenwärtige wirtschaftliche, politische und kulturelle Verhältnisse in ihrer historischen Entstehung und Entwicklung und damit als veränderbar zu zeigen und
- Voraussetzungen und Folgen politischen Handelns zu klären" (NW. S. 15).
So einfach ist das: Es werde Licht, und es ward Licht. Entweder haben wir es hier mit dem Selbstbewusstsein von Demiurgen oder mit den Schöpfern von Plänen zu tun, die die Sache nicht ernst nehmen bzw. nicht ernst nehmen können, weil ihnen selbst ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein abgeht. Dass sie ohne Kontakt mit der modernen Geschichtswissenschaft, ohne eine Ahnung davon, dass sie es hier mit einer historisch-kritischen Sozialwissenschaft zu tun haben würden, nicht in der Lage waren, Kategorien zu entwickeln, zeigt sich in den folgenden Detailausführungen zum "Individuelle(n) Geschichtsbewusstsein" (NW. S.15-17), zur "Veränderbarkeit gesellschaftlicher Verhältnisse" (NW. S. 17-19) und zu den "Voraussetzungen politischen Handelns" (NW. S. 19-20) auf eine makabre Weise: Es finden sich keine argumentativen Bemühungen wie noch im Hessen-Plan, sondern nur noch Setzungen. Die Instrumentalisierung der Geschichte hat sich gegenüber den hessischen Richtlinien noch verschärft - hier im allgemeinen Teil im Dienste vage bezeichneter gesellschaftlicher Zwecke; im unterrichtspraktischen Teil, wie noch zu zeigen ist, im Dienste einer eindimensionalen, Alternativen ausblendenden Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Das politisch-pädagogische Überzeugungsmodell wird zur Katechismusdidaktik. [/S. 52:]
2. "Individuelle" Vorurteilsverfallenheit - "Objektive" historische Bedingungen - gesellschaftliche "Veränderbarkeit"
"Individuelles Geschichtsbewusstsein" erscheint nicht als vorwissenschaftliche Erfahrung, die im Geschichtsunterricht zu rationalisieren wäre, sondern allein als Ergebnis von "Vorurteilen, Normen und emotionalen Einstellungen", die nicht nach Wahrheit und Begründbarkeit befragt werden und also von vornherein als Negativ-Syndrom gelten. "Einstellungen" haben eine individuelle und soziale Absicherungs- und Rechtfertigungsfunktion, die "überprüft" (S. 17) - mit anderen Worten: entlarvt - werden muss. Der Unterricht G/P hat mit diesem sog. Historischen Aspekt permanent falsches Weltbewusstsein zu destruieren. "Prüfungs"-Kriterium ist ein nebuloser Praxisbegriff.
Selbstverständlich sind Geschichtserfahrung, Geschichtswissenschaft und Geschichtsunterricht an "erkenntnisleitende Interessen" angekoppelt (Habermas). Aber die Rückkoppelung auf die Geschichte führt die "disziplinierte Wahrheitssuche" (Rothfels), woher sie auch immer ansetzen mag, in der Begegnung mit sperrigen, unbequemen Tatsachen zu Urteilskorrekturen, ggf. zur Transzendierung der aus der Gegenwart mitgebrachten Begrifflichkeit. So vermag auch der marxistische Historiker dem "bürgerlichen" die Erkenntnis von Teilwahrheiten durchaus zuzugestehen und vice versa dieser jenem. Auf den Unterschied zwischen Genese und Geltung wissenschaftlicher Aussagen hat unlängst Thomas Nipperdey eindrücklich verwiesen (15). Von der in dieser Hinsicht emanzipatorischen Funktion eines reflektierten Umgangs mit der Geschichte ist in den Ausführungen zum "Historischen Aspekt" nirgends die Rede.
Sollten die vom Diktat einer totalen Ideologieverfallenheit der Historie betroffenen Lehrer und Schüler bewegt worden sein, jegliches Zutrauen in eine wie auch immer relative Möglichkeit objektiver, wahrer, durch Geschichtswissenschaft vermittelter Einsichten aufzugeben, so werden sie einige Seiten später von den NW-Rahmenplänen (S. 20) ohne jede Begründung auf das Gegenteil verpflichtet: Im Kapitel [/S. 53:] "Voraussetzungen politischen Handelns" erscheinen plötzlich "objektive Entwicklungstendenzen", "objektive Bedingungen", die man kennen muss und auf die hin das "subjektive Handeln" auszurichten ist, weil "historische Veränderungen aus dem Einklang von subjektivem Handeln und objektiven Bedingungen bewirkt werden" (S. 20). Wie man zu dieser "Kenntnis" (so heißt es im Text statt: Erkenntnis) gelangen kann, dass es dafür fachspezifische Methoden gibt, welcher Art sie sind und wie sie in Lernzielbestimmungen umgesetzt werden können, davon ist im Rahmenlehrplan keine Rede. (In einen generellen Lernzielimperativ übertragen, würde der zweideutige Gedankengang des Rahmenplans sich so darstellen: Du sollst Dein Handeln an objektiven Bedingungen orientieren, die Du zwar nicht selbst erkennen kannst, die Dir aber zur Kenntnis gebracht werden!) Auch an dieser Stelle enthüllt sich also ein Dezisionismus, für den die Geschichte nichts weiter als ein abrufbares Sortiment von Stützmaterialien ist.
Mit der im zweiten Abschnitt der generellen Ausführungen im NW-Plan der historischen Analyse zugeschriebenen Leistung, ein "Bewusstsein der Veränderbarkeit aller gesellschaftlicher Verhältnisse" zu bewirken, ist ein richtiger Sachverhalt herausgestellt, der dann aber sofort wieder durch Verabsolutierung pervertiert wird. Die Veränderung wird zum Fetisch, die Frage nach ihrer Vernünftigkeit bzw. Unvernunft kommt nicht in den Blick. Geschichtliche Sensibilität, die in der Lage ist, die "neuen Schnittlinien progressiver und bewahrender Interessen zu erkennen", wie sie der geschichtsbewusste Bundeskanzler jüngst in seiner Regierungserklärung für die "neue Mitte" forderte, ist bei den Verfassern der Lehrpläne G/P nicht zu entdecken. Infolgedessen fehlen völlig Lernziele, die sich auf die Einsicht gründen, dass unsere Gesellschaft im Laufe langer Geschichte in Kämpfen und Leiden errungene Dinge - Freiheiten etwa - nicht wieder verlieren darf, also bewahren muss. Es fehlt eben das Bewusstsein der Dialektik von Tradition und Fortschritt, das dem modernen "bürgerlichen" Historiker ebenso selbstverständlich ist wie dem marxistischen.
Dem Defizit an wissenschaftlich begründeten Elementen, [/S. 54:] die den Aufbau eines reflektierten Geschichtsbewusstseins zum Zwecke einer rationalen Einschätzung gegenwärtiger gesellschaftlicher Verhältnisse konstituieren könnten, steht eine Summe von universalen didaktischen Postulaten gegenüber, die den intellektuell redlichen Lehrer, der sie im Unterricht realisieren soll, frustrieren oder empören werden. Dafür abschließend als Beispiel folgender Schlusssatz aus dem zweiten Kapitel des "Historischen Aspekts": "An der Analyse verschiedener Situationen soll der Schüler auch die Fähigkeit entwickeln können, jede Form von Abhängigkeit auf ihre Rechtfertigung zu befragen und die Abhängigkeit, die tatsächlich besteht, von derjenigen zu unterscheiden, die notwendig ist, um auf dem jeweils erreichten Stand aller wissenschaftlichen, technischen und ökonomischen Möglichkeiten Existenz und Entwicklung der Gesellschaft und ihrer Individuen zu sichern." In dem hier verkündeten Lernziel einer omnipotenten Kompetenz (für Schüler!) meldet sich ein Anspruch, der entweder hybrid oder läppisch zu nennen ist. Mit einer solchen Donquichotterie (16) politischer Bildung wird die notwendige Emanzipation schon im Ansatz verfehlt. Nach der Lektüre solcher Passagen ist man versucht, die Rahmenlehrpläne endgültig beiseite zu legen. Dennoch sei ihr Anspruch am unterrichtspraktischen Teil (S. 29-131) exemplarisch überprüft; vielleicht dass hier die stillschweigende Korrektur überhöhter didaktischer Programmatik erfolgt.
IV. Der unterrichtspraktische Teil. Schwerpunkt Geschichte
Im folgenden sollen zunächst einige Bemerkungen zu der Aufbereitung historischen Materials in den hessischen Richtlinien gemacht werden, die sich ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit auf die Lernfelder I, III und IV beziehen. Im Lernfeld II - Wirtschaft - liegt der stärkste historische Anspruch der Richtlinien. Deshalb wird an diesem Lernfeld in einem zweiten Abschnitt noch einmal ein Vergleich der hessischen Richtlinien mit den NW-Rahmenplänen skizziert. [/S. 55:]
1. Zu den Lernfeldern Sozialisation (I), Öffentliche Aufgaben (III) und Intergesellschaftliche Konflikte (IV) in den hessischen Rahmenrichtlinien
Es ist den Verfassern wohl bewusst, dass Erziehung und Schule nur aus dem Kontext der gesellschaftlichen Gesamtverhältnisse verstehbar sind. Wenn dennoch unter dem Lernziel der Einsicht in die Veränderbarkeit heutiger Sozialisationsformen die Erziehung für sich thematisiert wird - und zwar in kleinen Querschnitten von der griechischen Antike bis ins 19. Jahrhundert -, so geschieht das, was im grundsätzlichen Teil abgelehnt wird: eine Isolierung von nur noch als kurios erscheinenden vergangenen Erziehungsformen. Zwar soll - das wird sogar durch eine Graphik (H. S. 29) verdeutlicht - irgendwann in den beiden Schuljahren 5/6 durch Aufarbeitung der anderen Lernfelder doch ein Gesamtzusammenhang hergestellt werden: aber das Auseinanderreißen des Themas "antike Gesellschaftsformen" lässt genau das nicht zu, was die Verfasser als vielschichtige historische Analyse fordern (17). Es gilt für dieses Vorgehen das gleiche, was sie dem chronologischen Durchgang vorwerfen: der Stoff, den man später braucht, ist längst vergessen (H. S. 22).
Dieser Einwand gilt nun nicht etwa nur für dieses Beispiel; er trifft die Anlage des Unterrichts überhaupt. Sie verhindert eine Gesamtanalyse und erschwert gerade den wichtigsten Lerneffekt des Geschichtsunterrichts: die Erkenntnis der Interdependenz von politischen, sozialen, ökonomischen, kulturellen Faktoren. Die vorweg entschiedene Vierteilung der Aspekte lässt das eigentliche Lernpotential der Geschichte nicht oder nur sehr gebrochen zur Geltung kommen. Das im allgemeinen Teil proklamierte Strukturprinzip als Kern von Gegenwartsbezug wird damit wieder in Frage gestellt, um so mehr, als es ausdrücklich heißt, dass die Beispiele nicht in den Zusammenhang ihrer Zeit gerückt werden sollen (H. S. 61 f.). Damit wird Geschichte zum großen Raritätenkasten; weder Struktur noch Prozess werden erfahrbar. Das wird im vierten Lernfeld am krassesten deutlich: dort ist z. B. unter dem Aspekt "Krieg" nur noch abrufbares [/S. 56:] Beispielmaterial aufgeführt. Die großen Revolutionen sind nur noch "Beispiele", die sich "anbieten", die Rolle des Militärs zu erkennen (H. S. 297).
Dieser erste grundsätzliche Einwand wird noch verstärkt durch die Diktatur der Lernziele, die hier nicht in Wechselwirkung mit dem historischen Potential und seiner Aussagekraft einerseits, mit den Methoden rationaler Befragung des Materials andererseits entwickelt werden, sondern die vorweg verordnet sind. Auf diese Weise ist "lernzielorientierter Unterricht" denaturiert.
Es ist schlechterdings nicht einzusehen, warum die hier vorgelegten Konstruktionen einem Geschichtsunterricht vorzuziehen sein sollen, der in sozial- und strukturgeschichtlichem Zugriff z. B. "die Ablösung der ersten Demokratie in Deutschland durch den Faschismus" (H. S. 237) (18) als ein Thema aufgreift und es in seinen wichtigsten Aspekten zusammenhängend erarbeitet: Dann erst gewinnen z. B. besondere Erziehungsformen in Bünden und Schule, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die politischen Institutionen und die politische Psychologie der verschiedenen Gruppen sowie die institutionellen Regelungen miteinander Aussagekraft für die Erkenntnis eines Prozesses regressiver Veränderung von Gesellschaft. Nur in diesem Kontext sind die Problematisierungen möglich, von denen man sich den Transfer historischer Einsichten in politische Reflexionsfähigkeit erhoffen kann.
Zerschlagung der bedeutenden historischen Themen und der sie konstituierenden Zusammenhänge in Manipelformation öffnet die Tür zur Manipulation. Man könnte einwenden, dass dies durchaus nicht der Fall sein müsste; dass eine Unterrichtsorganisation möglich sei, die doch durch Zusammenschiebung der historischen Themenstichworte zur Strukturanalyse vorstößt. Wenn das so ist, dann liegt es jedenfalls nicht im Ansatz der Richtlinien. Dass es nicht so sein soll, zeigt die sorgfältige Aufsplitterung von Aspekten; die gelegentlichen Hinweise auf Rückgriffe haben Alibifunktion. Dass es nicht so sein kann, zeigen nun die zitierten Materialien, die "als Grundlage für die Arbeit der Gruppen" gedacht sind (H. S. 5). [/S. 57:]
Damit ist ein Punkt berührt, der in doppelter Weise die Diskrepanz zwischen Grundsatzformulierungen und praktischer Ausführung betrifft. Richtlinien müssen ja nicht Literaturhinweise, Verweise auf Arbeitsmaterialien geben. Wenn sie es trotzdem tun, dann zeigen diese Hinweise besser als die Erörterungen über Grundlegung oder Ausführung des Unterrichts, welcher Bewusstseinsstand und welche Tendenz eigentlich hinter solchen Richtlinien stehen. Die Hinweise zu den einzelnen Themenstichworten sind ein Sammelsurium von Titeln, die, ungenau und unterschiedlich zitiert, Konzeptlosigkeit und mangelnden Informationsstand offenbaren; für wissenschaftlich ausgebildete Lehrer sind sie, an so anspruchsvoller Stelle veröffentlicht, ein Skandalon. Nicht nur fehlt die wichtigste wissenschaftliche Literatur zu den Abschnitten; es wird am keiner Stelle der Angaben zu geschichtlichen Themen die Literatur für die unterschiedlichen Zwecke (Lehrervorbereitung, Schülerreferate usw.) gewichtet. Wenn auf dieser Basis - die die Verfasser ausdrücklich als ihren Informationsstand bezeichnen (H. S. 5) - Unterricht gegeben wird, kann von "vielschichtiger historischer Analyse", wie sie gefordert wird, nicht die Rede sein. Wir ersparen uns, die Defizite anzuführen. Nur als Beispiel sei hingewiesen auf die Materialien zum Themenstichwort "Schule als Institution in historischer Sicht". Die Verfasser kommen zu der seltsamen Bemerkung, dass "konkrete Materialhinweise schwer zugänglich" seien. Nur Bungerts Buch, "Die Odyssee der Lehrerschaft" fällt ihnen neben Wilhelm Buschs "Lehrer Lämpel" ein (H. S. 67). Nun ist offenkundig, dass gerade zur Erziehungsgeschichte eine Vielzahl von leicht zugänglichen Quellensammlungen und neuerer Literatur vorliegt (19). Man darf gespannt sein, welches Material in "Auszügen" vorgelegt werden wird.
Dies ist ein weiteres Zeichen der Wissenschaftsfremdheit und der Unterordnung historischen Materials unter politisch fixierte Ziele. Mit gleichem Ergebnis kann man alle Hinweise zu Themen durchgehen - und es ist schon fast zu harmlos anzunehmen, dass sich in den Materialangaben wirklich der Informationsstand der Bearbeiter spiegelt (H. S. 5). Es ist nicht auszudenken, welche Manipulationsmöglichkei- [/S. 58:] ten über festgelegte Lernziele und selektierte Information, durch Lieferung von Unterrichtsmaterial und durch wissenschaftlich nicht mehr reflektierte, trotz verhüllender Sprache sehr massive "Parteilichkeit" in Richtlinienformulierungen sich anbieten, wenn das wissenschaftliche Studium der Lehrer allgemein auf sechs Semester beschränkt werden würde.
Die aufgeführten Materialien zeigen aber noch ein anderes Charakteristikum, das den Widerspruch zwischen allgemeinen Ausführungen und unterrichtspraktischem Teil deutlich macht. Als Materialien werden z. B. Lykurg für die Erziehung in Sparta, Parzival für ritterliche Erziehung angegeben und Heinrich Manns Roman "Der Untertan" (nach der Häufigkeit der Zitierung wohl die Standardlektüre der Verfasser über das 2. Kaiserreich) für bürgerliche Erziehung. Da man nun nicht annehmen kann, dass in den Klassen 5/6 Plutarchs Kunstform, seine "Interessen" und sein Aussagewille über eine Zeit, die für ihn mehr als ein halbes Jahrtausend zurücklag, erarbeitet werden kann und soll, bleibt der Schluss, dass die Verfasser dem "objektivistischen Irrtum" erliegen und die jeweiligen Bedingungen der Aussage, sobald sie nicht mehr allgemein reden können, vergessen. Es soll doch wohl die "Erziehung" Dietrich Heßlings, wie sie im Roman H. Manns "Der Untertan" beschrieben wird, als Material für die Wirklichkeit ausgegeben werden - sonst wäre ja der Hinweis auf das erste Kapitel unsinnig. Diese bewusst und mit bestimmter politischer Absicht kunstvoll stilisierte Biographie naiv als Quelle zu nehmen für die Erziehung am Ende der Bismarckzeit - das zeugt nicht von einem reflektierten Geschichtsverständnis. Nach dem eigenen Anspruch müssten die Schüler in der Jahrgangsstufe 5/6 diesen Roman in seiner politischen Tendenz im Jahre 1918 vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs des monarchischen Staates als eine politische Satire und Kampfschrift begreifen; selbst hochfliegender pädagogischer Optimismus wird ihnen das nicht zutrauen. Es ist nun zu ahnen, warum man auf die didaktische Aufbereitung fachwissenschaftlicher Methoden verzichtet: man kennt sie entweder nicht oder will sie nicht verbreiten, weil es dann nicht mehr möglich ist, Dichtung [/S. 59:] für Wahrheit auszugeben, anders ausgedrückt: vorgesetzte Lernziele zu erreichen. So fällt man hinter die vergangenen zweihundert Jahre der Wissenschaftsgeschichte zurück. Aber es war ja eine "politische" Entscheidung, Fachverbände und Hochschulen nicht zu beteiligen (20).
Wie eine solche Entscheidung sich in Unterrichtssteuerung umsetzen kann, die den Rückbezug auf die Fachwissenschaft durchkreuzt, soll durch einen letzten Hinweis noch einmal verdeutlicht werden. Die Materialhinweise zum Themenstichwort "Militär und Innenpolitik" wissen an Literatur außer der von Wehler herausgegebenen Aufsatzsammlung Kehrs nichts anzugeben, soweit es die innenpolitische Rolle des Militärs in Deutschland vor 1914 betrifft. Aber den bekannten Passus aus der Rede Oldenburg-Januschaus, den weiß man wohl und zitiert ihn wörtlich - das einzige Quellenzitat überhaupt -, bringt ihn als Unterrichtsmaterial handlich an den Lehrer heran: ohne Zitatnachweis (man könnte ja weiterlesen!), ohne Hinweis auf die kritische Reflexion dieser extremen Aussage im Verfassungskontext. Sie wird zum repräsentativen Zeugnis der inneren Struktur des zweiten Reiches verfälscht.
So sieht der Beitrag der Geschichte zum politischen Ziel dieses didaktischen Entwurfs aus, wenn man auf die praktischen Anweisungen sieht. Allerdings - das alles wird ja nur zur "Diskussion" gestellt (H. S. 298). Wie die Rahmenlehrpläne in NW ihr Muster in dieser Hinsicht noch übertreffen, soll am Lernfeld II gezeigt werden.
2. Das Lernfeld Wirtschaft (II) in den hessischen Rahmenrichtlinien und seine "Modifikation" im Arbeitsbereich Wirtschaft der NW-Rahmenlehrpläne
a. Die Funktion geschichtlicher Themen
Da die moderne Industriegesellschaft die geschichtlichste von allen Gesellschaften ist, kann sie nicht ohne geschichtliche Strukturvergleiche und ohne Hilfe langfristiger Konstellationsanalysen begriffen werden; in soziologischer Beschreibung allein ist sie keineswegs erfassbar. Daraus folgt, [/S. 60:] dass die Befähigung zur Beteiligung an der permanenten Aufgabe der Humanisierung dieser Industriegesellschaft ohne ein historisch fundiertes Problembewusstsein nicht möglich ist.
Beim Versuch der didaktischen Strukturierung des Arbeitsbereichs Wirtschaft haben denn auch die Rahmenrichtlinien (Hessen) und Rahmenlehrpläne (NW) geschichtliche Teilstücke eingebaut - so etwa: "Stände im Mittelalter" (H. S. 150, 5./6. Jahrgangsstufe), "Klassen und Schichten im 19. Jahrhundert" (H. S. 150, 5./6. JgSt.) "Grundherrschaft" (H. S. 157 f., 7./8. JgSt.), "Entwicklung des städtischen Gewerbes" (H. S. 159 f., 7./8. JgSt.), "Industrielle Revolution" (H. S. 162-165, 7./8. JgSt.), "Aufbauphase der Wirtschaft nach 1945" (H. S. 181 f., 9./10. JgSt.). Die NW-Rahmenlehrpläne enthalten in der Übersicht über die Jahrgänge 5-10 (S. 92-94) vergleichbare Themenstichworte; eine Ausfaltung in "Lernzielzusammenhänge" liegt vorerst nur für den 5./6. Jg. vor (NW-Plan, S. 95-103).
Bei näherem Zusehen zeigt sich freilich, dass die Lernziele im vorhinein geschichtsfern festgelegt wurden. Erst nachträglich wird dann das jeweils als passend erscheinende historische Material abgerufen, so daß es nur eine Demonstrations-, aber keine Korrektivfunktion mehr erfüllt. Im Grunde stehen also auch hier wieder alle Ergebnisse des Unterrichts bereits von vornherein fest, die Lernziele sind die Leitschienen eines "statischen" Lernablaufs. Um einen dynamischen Lernprozess in Gang zu bringen, bedürfte es einer historisch-politischen Didaktik, die sich in einer gemeinsamen Anstrengung von Lehrenden und Lernenden um die Aufhellung von Fragen bemüht, so dass Resultate nicht durch Lernzieldiktate, sondern durch Verschränkung soziologischer und historischer Arbeitsmethoden zustande kommen. "Aspekte", die nichts anderes sind als zu politisch-didaktischen Zwecken vorfabrizierte Sehschlitze, eröffnen keinen Blick auf den Horizont der Geschichte - sie bringen nur noch isolierte, unverbindliche und unverbindbare Stücke zu Gesicht. [/S. 61:]
b. Lernziele und "Lernziele"
Über diese allgemeinen Feststellungen hinaus ist nunmehr nach der Realisierung des obersten Lernziels im konkreten Lernfeld/Arbeitsbereich Wirtschaft zu fragen. Der hessische Plan bemüht sich auch in diesem Fall um eine differenziertere Bestandsaufnahme der komplexen Lernzielzusammenhänge. Mit Recht wird bei der Problemausfaltung die Wirtschaftsverfassung der Bundesrepublik Deutschland ausführlich erörtert. Ihre kritische Betrachtung - hier "übrigens einmal in enger Verschränkung mit der historischen Genese" - schließt wesentliche Kategorien auf, Reformen und Alternativen werden anvisiert, ohne dass den Schülern etwa eine "Systemüberwindung" suggeriert würde - das Leitziel der Befähigung zur Selbst- und Mitbestimmung wird hier ernstgenommen.
Ganz anders verhält es sich bei der Planungsgruppe NW. Hier wird massiv indoktriniert. Ein milderes Urteil würde den Sachverhalt beschönigen. An dieser Stelle kann man auch nicht mehr von einem von Hessen nach NW laufenden Erosionsprozess sprechen, hier ist das hessische Modell schlechthin verfälscht worden. Die behauptete "Übereinstimmung mit den Grundzügen der Vorlage", die Behauptung einer lediglich "sektoriell bzw. punktuell modifizierte(n) Fassung" (NW, Vorbemerkungen, S. III) kann danach nicht mehr aufrechterhalten werden.
Während die hessischen Planer die Marktwirtschaft durchaus ernsthaft zur Debatte stellen, haben die Verfasser der NW-Pläne sie bereits - sozial hin, sozial her - in aller Stille hingerichtet und beerdigt. Nicht dass sie keine Freunde dieser Wirtschaftsverfassung sind, ist ihnen vorzuwerfen, sondern dass sie der Axiomatik des Lernbereichs G/P entgegen dem Gegner - um im Bilde zu bleiben - nicht öffentlich (d. h. im Unterricht) einen fairen Prozess machen, wozu außer Anklägern auch Verteidiger gehören. Mit der Verfahrensweise der NW-Rahmenpläne ist eine Grenze überschritten, jenseits derer eine wissenschaftliche Auseinandersetzung kaum noch möglich ist.
In den hessischen Rahmenrichtlinien wird im Lernfeld [/S. 62:] Wirtschaft bei der Beschreibung des "Lernzielzusammenhangs 1: Voraussetzungen und Bedingungen der Produktion" die Frage der Bedürfnisbefriedigung und im Zusammenhang damit die der Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel erörtert und folgende Aufgabe gestellt: "Bezogen auf die Wirtschaftsverfassung der BRD müsste dabei auch geprüft werden, inwieweit die soziale Marktwirtschaft in Theorie und Praxis gewährleistet, dass die Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse (z. B. im Infrastrukturbereich; Schulbau, Krankenhäuser, Kindergärten; Arbeitszeitverkürzung) zum Maßstab von Produktions- und Investitionsentscheidungen wird" (H. S. 134).
Dieser Satz wurde in den Rahmenlehrplänen von NW wie folgt geändert: "Bezogen auf die Wirtschaftsverfassung der BRD müsste dabei auch geprüft werden, inwieweit das Prinzip der Gewinnoptimierung in einer erwerbswirtschaftlich bestimmten Wirtschaftsordnung erschwert bzw. verhindert, dass die Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse (z. B. Schulbau, Krankenhäuser, Kindergärten) zum [als?] Maßstab bei Produktions- und Investitionsentscheidungen im notwendigen Umfange berücksichtigt wird (LZ. 1-14)" (NW. S. 81).
Die hier vorgenommene Umpolung bedarf keines weiteren Kommentars. Ihr Sinn ist eindeutig. Folgerichtig ist dann auch die völlige Eliminierung des im Hessen-Plan ausführlich erörterten Spannungsfeldes "Soziale Marktwirtschaft". Denn auf die Konkretisierung der oben geforderten "Prüfung" käme es nun an - gemäß der Selbstbestimmungsnorm, gemäß dem Gebot der Wissenschaftlichkeit, gemäß der Fundamentalforderung jeder rationalen Didaktik. Anstelle der in den hessischen Richtlinien auf zwei Druckseiten skizzierten historischen und ökonomischen Probleme der Marktwirtschaft (S. 136 und 137) enthält der NW-Rahmenplan nur noch acht Zeilen darüber, in denen der konkrete Gegenstand in leeren Redensarten verflüchtigt ist. Warum diese merkwürdige Zurückhaltung? Es gibt nur zwei mögliche Antworten: entweder weil die Wirtschaftsverfassung der Bundesrepublik nicht einmal mehr einer Debatte für wertgehalten wird oder aus Tarnungsgründen. [/S. 63:]
Die Prämissen und die Konsequenzen der Umpolung werden in Einschüben versteckt, die sich erst bei einem sorgfältigen Vergleich der Lehrpläne erkennen lassen. Dafür einige hervorstechende Beispiele:
Die hessischen Rahmenrichtlinien formulieren unter der Überschrift "Konflikte und Krisen" (Lernzielzusammenhang 3): "Die Beschreibung wirtschaftlicher Abläufe wird erst lernrelevant, wenn die gesellschaftlichen und politischen Bedingungen miteinbezogen werden, durch welche die jetzige und spätere Stellung des Schülers im Wirtschaftsprozess bestimmt wird (Arbeit - Konsum - Freizeit). Da dieser Zusammenhang auf ein zentrales Moment gesellschaftlicher Interessenauseinandersetzung verweist, müssen Erklärungsmodelle für wirtschaftliche Vorgänge daraufhin untersucht werden, welche Vorstellungen sie über deren Voraussetzungen, Abläufe und Auswirkungen vermitteln" (H. S. 130).
Dieser Absatz ist in den NW-Plänen durch mehrere Einschübe (hier zwecks Kenntlichmachung kursiv gesetzt) in einen anderen Aggregatzustand gebracht worden. Der NW-Text lautet: "Die Beschreibung wirtschaftlicher Abläufe und ihrer widersprüchlichen Entwicklung wird erst lernrelevant, wenn... Da dieser Zusammenhang auf ein zentrales Moment gesellschaftlicher Interessenauseinandersetzung (Kapital - Arbeit) verweist, müssen die Erklärungsmodelle, die in diesem Bereich auftreten, auf ihren Rechtfertigungscharakter hin untersucht werden" (NW. S. 82).
Im Anschluss an den oben zitierten Hessen-Text werden dort Untersuchungsaufgaben formuliert, u. a. sollen untersucht werden: "monokausale Erklärungen sozioökonomischer Zusammenhänge (z. B. Schuld an inflationären Tendenzen ist allein die Währungspolitik der Regierung, Lohn-Preisspirale...)." Die NW-Planer formulieren die Untersuchungsaufgabe in folgender Weise um: "Erklärungsversuche; die sozioökonomische Zusammenhänge in voneinander isolierte Teilbereiche auflösen", um dann in einer in den hessischen Richtlinien nicht enthaltenen längeren Darstellung die Wettbewerbsthese ad absurdum zu führen und den Manipulationscharakter von Erklärungen aufzuweisen, durch [/S. 64:] welche "der Gegensatz zwischen Unternehmerinteressen und den Interessen der Arbeitnehmer ... verdeckt" wird (NW. S. 82 und S. 83).
Eingeschoben in die hessische Vorlage haben die NW-Planer weiterhin die folgenden Lernziele 5 und 6: "5. lernen, dass Geld und Sachvermögen nur durch Arbeit im Produktionsprozess entsteht und sich vermehrt; 6. lernen, dass ein untrennbarer Zusammenhang besteht zwischen den Formen der Produktion und der Verteilung bzw. Aneignung der wirtschaftlichen Güter."
Neben den Einschüben finden sich im NW-Plan charakteristische Auslassungen wie z. B. folgende: Das erste Lernziel in Hessen lautet: "erkennen, dass die Grundstrukturen gesellschaftlicher Wirklichkeit ökonomisch mitbedingt sind (auch unter Berücksichtigung der Mobilität sozialer Gruppen)" (H. S. 134). Im NW-Plan heißt es stattdessen: "erkennen, dass . . . ökonomisch bedingt sind" (NW. S. 85). Mit einem Federstrich ist die in Hessen vertretene Interdependenz der gesellschaftlichen Bereiche aus der Welt geschafft und an ihrer Stelle die Priorität der ökonomischen Faktoren gesetzt worden.
Die hessischen Richtlinien wollen im Lernzielzusammenhang 3 u. a. ausdrücklich untersucht wissen "die Behauptung, bei einer Sozialisierung der Verfügungsgewalt würde die Wirtschaft krisenfrei funktionieren" (H. S. 139). Diese Aufgabe fehlt im NW-Plan ebenso wie der im Lernfeld 3 des Hessen-Plans (Öffentliche Aufgaben) skizzierte kritische Ansatz, der nicht nur die gesellschaftlichen Binnenverhältnisse (BRD), sondern auch die gesellschaftlichen Gegenbilder unter die Lupe genommen haben und den Schülern bewusst machen will, was es bedeutet, "wenn in einer Gesellschaft die für die Schüler meist selbstverständlichen institutionellen und verfassungsrechtlichen Sicherungen zur Wahrnehmung unterschiedlicher Interessen fehlen (Pressefreiheit; Mehrparteiensystem; Gewerkschaften; unabhängige Rechtsprechung u. a.)" (H. S. 196).
Ausgelassen sind in den NW-Rahmenplänen. schließlich die hessischen Lernziele 17 und 18:
"17. lernen, die wirtschaftliche Entwicklung der BRD im [/S. 65:] Zusammenhang mit den binnen- und außenwirtschaftlichen Bedingungen nach 1945 zu sehen,
18. die besonderen Bedingungen der Aufbauphase unter Berücksichtigung der politischen Verhältnisse entwickeln zu können" (H. S. 138).
Die Aussparung dieser Lernziele in den NW-Plänen ist gemäß der unverkennbaren dogmatischen Intention logisch durchaus folgerichtig: wo das Urteil für Lehrer und Schüler von vornherein festzustehen hat, da bedarf es keiner differenzierten Erörterung des historischen Kontextes der sozialen Marktwirtschaft mehr; Geschichte als potentielle Ideologiekritik ist unerwünscht.
Die "Soziale Marktwirtschaft" ist sicherlich nicht sakrosankt, sie muss am Sozialstaatspostulat des Grundgesetzes gemessen werden. Man kann als Bürger dieses Staates Verfechter eines demokratischen Sozialismus sein und braucht als Lehrer keinen Hehl aus einer solchen Überzeugung zu machen. Unerträglich ist aber jede Art von Indoktrinierung, erst recht einer unterschwellig pädagogischen, wie sie der NW-Rahmenlehrplan Gesellschaft/Politik vornimmt.
Was wollen die NW-Planer an die Stelle der schlechten Wirklichkeit setzen? Wie sieht die bessere Gesellschaft, wie sieht der bessere Staat aus? Darüber ist nichts Genaues ausgesagt. Manche Indizien sprechen dafür, dass die NW-Lehrplaner eine klassen- und schichtenlose, konfliktfreie Gruppengesellschaft als Ziel im Auge haben, in der partikulare Interessenvertretungen nicht mehr möglich und notwendig sind. Mit dieser vagen Alternative stehen die NW-Rahmenpläne in der Linie einer traditionellen politischen Pädagogik in Deutschland, die in der Sehnsucht nach Harmonie der Idee der "gemeinschaftlichen Vergesellschaftung" verfallen bleibt (21) - mit einem spezifischen Qualitätsunterschied: sie ist anderswo bereits klarer und deutlicher vertreten worden. Wohin diese irrationale Doktrin der "Systemüberwindung" uns führen könnte, haben die Verfasser der Lehrpläne geradezu klassisch vorgeführt: zur Unterdrückung anderer Anschauungen, zur pädagogischen Annullierung des Rechts auf Autonomie. [/S. 66:]
V. Fazit
Es ist unbestritten, dass Geschichtswissenschaft und Geschichtsunterricht in der industriellen Gesellschaft mit neu zu organisierenden Ansätzen - in Lernzielen, Lernpotential, Lernverfahren - und in Kooperation mit anderen gesellschaftswissenschaftlichen Fächern eine bedeutsame Aufgabe zur Steigerung von Rationalität und Humanität als Voraussetzungen verantwortlicher Selbst- und Mitbestimmung zu leisten haben. Unbestritten ist auch, dass diese vorhandenen neuen Ansätze bislang noch nirgends in ein überzeugendes System gebracht sind. Noch fehlt eine Alternative zu den hier kritisierten Lehrplänen in gleich geschlossener Form.
Wenn diese Lehrpläne ein Verdienst haben, so dies, die Notwendigkeit der Alternative unübersehbar zu fordern. Denn sie machen das Potential, das in der Aufarbeitung der Geschichte zu dem oben genannten Ziel liegt, unwirksam.
Es ist ihnen zum Vorwurf zu machen die Eliminierung des kritischen Potentials wissenschaftlicher Reflexion zugunsten nichtdurchreflektierter Voreinstellungen und diffuser Ausgangs- und Zielpunkte hinsichtlich der Vorstellung von gegenwärtiger Gesellschaft und ihrer Veränderung. Sie lassen die Einsicht vermissen, dass es die Aufgabe der Schule in der demokratischen Gesellschaft ist, nicht die Heranwachsenden mit - wie immer begründeten - Meinungen und Sichtweisen zu umstellen und ihnen diese als die "wahre" Wirklichkeit auszugeben, sondern ihnen die Denkformen, Begriffe, Fragestellungen, Fertigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, die nötig sind, um selbst zu verantwortende Entscheidungen treffen zu können. Unterricht ist nicht Propaganda oder Agitation. Wo das vergessen oder wegdiskutiert wird, entsteht ein Unterrichtsmodell, das missbrauchbar ist von autoritären und totalitären - undemokratischen - Erziehungs- und Verfassungssystemen, mag es selbst sich auch als "demokratisch" missverstehen, Solche "demokratische" Erziehung kann Demokratie nicht erhalten oder hervorbringen. Erziehung für die Demokratie ist heute, in einer wissenschaftsgeleiteten und wissenschaftsbedürftigen Welt, nicht [/S. 67:] mehr denkbar durch Zurückdrängung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Fragestellungen hinter scheinbar vorrangige didaktisch-politische Entscheidungen, durch die Priorität direkter Verhaltensschulung über die Befähigung zu selbständiger Urteilsbildung.
Es kommt vielmehr darauf an, den zweifellos schwieriger gewordenen Prozess der Gewinnung und Verarbeitung von Informationen, der Urteilsfindung und Verhaltensbegründung durch die didaktisch verantwortete und überprüfte weitere Hineinnahme des in der Wissenschaft aufgearbeiteten Erkenntnis- und Problemstandes zu ermöglichen. Diese Anstrengung durch den Rückzug auf eine politisch-didaktisch vorweggedeutete Welt zu umgehen und nur passende Teilerkenntnisse zuzulassen, führt in eine didaktische und politische Sackgasse, ist Rückschritt, Regression, mag sie auch im progressivsten Vokabular auftreten. Das irrationale Element, in den hessischen Richtlinien schon greifbar, in den nordrhein-westfälischen Rahmenlehrplänen dominierend, ist eben dieser Rückzug vor der komplizierter werdenden, wissenschaftlich verantwortbaren Deutung der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft in die großen, "einfachen" Schneisen politischer Sehnsucht - Nostalgie auf didaktisch (22). Regressiv ist die Weigerung, sich und die Schüler den großen Kontroversen, auch den Aporien der Gegenwart auszusetzen; regressiv ist die Selbstgewissheit und die Ungebrochenheit des eigenen Anspruchs, ist das verhüllt, aber zugleich penetrant sich vordrängende Sendungsbewusstsein einer Gruppe von neuen Praeceptores Germaniae; Regression zeigt schließlich das mit einem solchen Anspruch kontrastierende Niveau der Ausführungen wie des wissenschaftlichen Informationsstandes.
Autoritär und gerade nicht im Sinne der selbst in Anspruch genommenen Ziele aber ist die Methode, sehr eng führende und den Unterricht weithin vorprogrammierende Richtlinien zu erlassen. Wer auch nur ein wenig aus der Geschichte der Versuche zu Schulreformen gelernt hat, müsste wissen, dass es nur einen Weg gibt, in einem Staate, der nicht ein Staat des Gesinnungszwanges sein will, Reformen in diesem verflochtenen Gebiet erfolgreich anzusetzen: den [/S. 68:] Weg der Überzeugung, der vollen Mitbeteiligung der am Erziehungsprozess Beteiligten (23), der Diskussion und des Geltenslassens von unterschiedlichen Positionen und des gewiss nicht einfachen, aber durchaus möglichen Findens eines Consensus. Aber dazu gehört neben Geduld auch die Einsicht, dass man möglicherweise mit seiner eigenen Konzeption nur eine Teilwahrheit gefasst hat, die zur Unwahrheit wird, wenn sie sich absolutsetzt.
In der didaktischen Literatur wie in der Praxis des Unterrichts und der Lehrerausbildung gibt es eine Vielzahl von Modellen, Versuchen und Anregungen, die die Schwächen des alten Geschichtsunterrichts überwunden und neue Konzeptionen entwickelt haben. Eine gut beratene Unterrichtspolitik würde nicht auserlesene, geschlossene Zirkel mit der Erarbeitung von Programmen beauftragen, die dann als Erlasse erscheinen; sie würde vielmehr die Möglichkeiten vermehren, dass die im Gang befindliche vielfältige Reform im Bereich der Fächer der Gesellschaftslehre sich selbst weiter ausbreiten und durchsetzen kann. Nicht Klausuren von genehmen brain-trusts, sondern offene Tagungen, Fortbildungs- und Versuchsmöglichkeiten für alle Lehrer und an allen Schulen müsste eine Kultusbehörde, in dem Wissen, dass sie in paedagogigicis kein Mandat, keine innere Legitimation für Programme, sondern nur die Pflicht hat, für die Möglichkeit der Entwicklung aller Potenzen zu sorgen, die - im Rahmen unserer Verfassung - an der Verbesserung des Unterrichts arbeiten. Das ist unbequemer als der Umgang mit selbstberufenen Kommissionen, aber das eben wäre - nach unserem Verständnis - demokratisch.
Sehr nachdrücklich muss man fordern, dass diesen Konzeptionen eine wissenschaftsbezogene Didaktik für eine moderne, demokratische Schule entgegengesetzt wird. Gerade wenn man der Ansicht ist - wie die Verfasser -, dass unserer Gesellschaft eine integrierte und zugleich differenzierte Gesamtschule Not tut, ist die Art, in der in einer solchen allgemeinen Schule unterrichtet wird, von höchster Bedeutung.
Diesen Richtlinien muss ein Konzept entgegengesetzt werden, das jene verstreuten und unklaren Ansätze, die in den hessischen Richtlinien immerhin zu finden sind, auf- [/S. 69:] nimmt und ausbaut, die zur Rationalität des Denkens, Urteilens und Verhaltens durch Reflexion auf Geschichte beitragen könnten; die Rahmenlehrpläne von NW führen genau in die entgegengesetzte Richtung. Eine "Vollintegration", wie sie dort propagiert wird, ist nichts anderes als die Liquidation der Möglichkeit, aus aufgearbeiteter Vergangenheit zu lernen. Vor diesen Plänen ist nicht nur aus wissenschaftlicher und didaktischer, sondern auch aus politischer Verantwortung zu warnen. "Nur im Bewusstsein und im Horizont geschichtlicher Erfahrung kann gewonnene Wahrheit, erreichte Freiheit bewahrt und behütet werden, kann erkannt werden, was zu tun sei, dass sie nicht wieder verschwänden. So sicher wir nicht so frei sind, wie wir sollten, und also fortzuschreiten haben, so sicher haben wir Freiheiten zu verlieren, also zu verteidigen, zu verspielen, also zu bewahren. Wir sind von Rückfällen bedroht, und so ist dem Fortschritt geschichtliches Bewusstsein nicht entgegengesetzt, vielmehr gehört es konstitutiv zu ihm. Wir brauchen geschichtliches Bewusstsein nicht zur Legitimation von Privilegien, sondern zur Sensibilisierung gegen Regressionen, die ja stets unter dem Schein des Fortschritts auftreten" (24).
VI. Anmerkungen
(*) Nachweise hinfort im Text zitiert als (H. S. ...) und (NW. S. ...). Die hessischen Rahmenrichtlinien liegen gedruckt vor (die Ausführungen zum "Arbeitsschwerpunkt Geschichte" siehe auch in GWU, 23 [1972] H. 10, S. 613-623); die Rahmenlehrpläne von NW sind erhältlich bei der "Informations- und Dokumentationsstelle für den Gesamtschulversuch NW", 46 Dortmund, Lindemannstraße 80 (Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass es sich dabei nicht um die Entwürfe für ein eigenständiges Fach Politik handelt, wie sie im sog. "Schörken-Plan" vorgelegt wurden.)
(1) H. Blankertz: Theorien und Modelle der Didaktik, München 2. Aufl. 1969b, S. 19 f.
(2) Vgl. H. L. Meyer: Das ungelöste Deduktionsproblem in der Curriculumforschung. In: Curriculumrevision, Möglichkeiten und Grenzen. Hrsg. v. F. Achtenhagen und H. L. Meyer. München 1971, S. 107 ff. [/S. 70:]
(3) Man müsste einmal die Zahl der Lernziele aller Grade feststellen: in den NW-Plänen, die nur die Klassen 5/6 vollständig ausführen, sind es über 160, in den hessischen Richtlinien noch mehr. Demgegenüber verschlägt die Versicherung im NW-Rahmenlehrplan, er solle keine "Zwangsmaßnahme" sein (NW.S. VI) wenig. Auch gegen den subjektiven Willen der Verfasser gerät dieser Ansatz dazu und widerspricht in der Tat "der obersten Zielsetzung eben dieses Rahmenlehrplans, nämlich der Selbst- und Mitbestimmung" (NW. S. VI).
(4) Die Lehrplaner offenbaren allerdings freimütig (in Hessen in vorsichtiger Ausdrucksweise, S. 12; in NW massiver, S. 11), dass die "Differenzierung der allgemeinen Lernziele unter fachspezifischen Aspekten" lediglich als ein Zugeständnis an eine noch unzulängliche Schulwirklichkeit anzusehen ist, die, so lange die Optimallösung der vorgestellten Integration noch nicht möglich ist, verhindern soll, "dass bei Unterricht in Einzelfächern die angestrebten Erkenntniszusammenhänge getrennt werden ...". Die Fachwissenschaften behalten in diesem Zusammenhang nach den hessischen Aussagen noch eine wichtige Funktion. In NW sind sie von "nachgeordneter Bedeutung" (NW. S. I). Im Widerspruch dazu werden ein paar Seiten später im NW-Plan (S. 11) dann doch bei der Beschreibung des "Sozialwissenschaftlichen Aspekts" der "Politologie wie Soziologie eine entscheidende Rolle als Hintergrundwissenschaften [sic!] des G/P-Unterrichts" zugewiesen. Auch "Sozialwissenschaften wie Wirtschaftswissenschaft, Rechtswissenschaft, Sozialpsychologie usw.," dürfen "wesentliche Aspekte" beisteuern - die Geschichtswissenschaft wird nicht nur hier nicht, wo es ja auch kaum zu erwarten wäre, sondern auch an keiner anderen Stelle, selbst nicht im Kapitel "Historischer Aspekt", überhaupt nur erwähnt.
(5) Vgl. den Beginn des 8. Buches der "Politik"
(6) W. U. Drechsel: Erziehung und Schule in der Französischen Revolution (Frankfurter Beiträge zur Pädagogik) Frankfurt 1969, S. 40
(7) H. Taine: Die Entstehung des modernen Frankreichs. Deutsch von L. Katscher, 2. Bd., 3. Abt., Leipzig o. J., (3. Aufl.) S. 105
(8) "Bericht und Entwurf einer Verordnung über die allgemeine Organisation des öffentlichen Unterrichtswesens" (1792) - Mit einer Einleitung von H. H. Schepp. Hrsg. in "Kleine pädagogische Texte", Bd. 36, Weinheim 1966
(9) Vgl. W. v. Humboldt: Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen (1792). Werke in fünf Bänden. Hrsg. v. A. Flitner und K. Giel. Darmstadt 1960, Bd. I, S. 106
(10) E. Spranger: Der Bildungswert der Heimatkunde. (1923) Verlag Reclam, Stuttgart. 3. Aufl. 1962, S.16, S. 24 "Alles wird zur Hilfswissenschaft" einer "durchgängigen Lebensgemeinschaft" [/S. 71:]
(11) Nur drei Bücher seien genannt, deren Lektüre sehr schnell verdeutlicht, wie leichthin mit erkenntnistheoretischen Problemen umgegangen wird: A. Schaff: Geschichte und Wahrheit. Wien 1970; H. J. Marrou: De la connaissance historique. Paris 1959; K. G. Faber: Theorie der Geschichtswissenschaft. München 1971
(12) z. B. E. Wilmans: Geschichtsunterricht. Grundlegung seiner Methode. Stuttgart 1949, S. 11 ff.
(13) Vgl. Th. Nipperdey: über Relevanz; Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 23 (1972), S. 577-596
(14) Diese und alle folgenden Hervorhebungen von uns.
(15) s. o. Anm. 13
(16) Vgl. dazu die differenzierten Ausführungen von G. Thoma: "Zur Strukturierung der ,politischen Dimension' des Unterrichts im Teilbereich der allgemeinen Gesellschaftslehre an der Kollegstufe". In: Kollegstufe NW, Schriftenreihe des KM, Heft 17, Düsseldorf 1972, S. 161
(17) Die Skizze (S. 29) täuscht außerdem den Leser, denn in Teil B ist das im Lernfeld III ausgewiesene Thema nirgends vermerkt, und die Pfeile führen ins Leere.
(18) Vgl. für den Unterschied zwischen H. und NW. gerade an diesem Punkt die Veränderung zur unredlichen Großsprecherei: NW (S. 38) schlägt vor "eine umfassende Faschismustheorie (Adorno, Nolte, Bloch)"
(19) Wenn schon nichts anderes, hätten hier wenigstens angegeben werden müssen: H. Blankertz: Bildung im Zeitalter der großen Industrie. Hannover 1969a; die leicht zugänglichen Quellenausgaben des Beltz Verlages (Kl. pädagog. Texte); Quellen zur deutschen Schulgeschichte seit 1800, hrsg. von H. Giese, Berlin 1961; Quellen zur Geschichte der Erziehung, ausgew. von K. H. Günther u. a., Berlin 5. Aufl. 1968
(20) s. FAZ, 27. 2. 73, die Erklärung der an der Ausarbeitung der Richtlinien beteiligten OSchR Ingrid Haller: in der "Erstphase" der Diskussion seien Fachverbände und Hochschulen nicht beteiligt worden. "Das war eine politische Entscheidung". Man darf annehmen, dass die Erstphase bis in die Druckfassung hineinreichte.
(21) Zu diesem hier nur angedeuteten Sachverhalt siehe die soeben erschienene Untersuchung von Günter C. Behrmann: "Soziales System und politische Sozialisation. Eine Kritik der politischen Pädagogik". Stuttgart 1972. Vgl. dazu die Rezension von Christian Graf von Krockow: "Eine Grundlagen-Kritik der politischen Pädagogik". In: Gesellschaft - Staat - Erziehung, 17. Jg./1972, Heft 6/Dezember, S. 381-384
(22) Man darf sich durch das progressive Vokabular nicht täuschen lassen: In der Abwendung von der wissenschaftlichen Überprüfbarkeit und der Hinwendung zu einer politischen Mission besteht - ungeachtet des konträren Inhalts der politischen [/S. 72:] Zielvorstellungen und des umgekehrten Vorzeichens der bildungspolitischen Absichten - in der Grundfigur des Ansatzes offenbar eine Analogie zu dem Weg, den deutsche "Volkserzieher" schon einmal vor hundert Jahren eingeschlagen haben, als sie sich in Zivilisationskritik steigerten und der "verderbten", "zersplitterten", "falsches Wissen" verbreitenden Bildungsorganisation den Kampf für die völkische (gesellschaftliche) Erneuerung ansagten. Nicht nur die Strategie ist ähnlich: "Aufstellung überspannter Erwartungen und Ideale, eine(r) verzerrte(n), überkritische(n) Darlegung der bestehenden Zustände und eine(r) Ausarbeitung konkreter Reformen" (Fritz Stern: Kulturpessimismus als politische Gefahr. Bern, Stuttgart 1963, S. 101; über das Vorgehen Paul de Lagardes); auch substantielle Parallelen zeigen sich in der fortschreitenden Wissenschaftsfeindlichkeit und insbesondere einer Ablehnung der kritischen Aufarbeitung der Geschichte, einer die "Spontaneität" erstickenden Beschäftigung mit Vergangenheit, stattdessen die Instrumentalisierung von Geschichte im Dienst der eigenen Vision (a. a. O. zu Langbehn, S. 215 ff.)
(23) Am Schluss der Rahmenlehrpläne von NW zeigt sich, wie solche "Mitarbeit" aussehen darf; durch Vorgabe von Fragetabellen wird jede grundsätzliche Kritik abgebogen und zugleich eine Kontrolle eingebaut: In welcher Unterrichtsreihe, bei welchem Unterrichtsverfahren, mit welchen Materialien welche Lernziele erreicht oder nicht erreicht wurden, muss der Lehrer aufführen. Hat er vorgeschriebene Unterrichtsreihen nicht behandelt - oder andere besprochen - muss er Begründungen angeben. Erst nach solcher Disziplinierung möglicher Kritik sind auch "sonstige Bemerkungen", "zusammenfassende (was?) Stellungnahmen" erwünscht - alles in allem ein Beispiel für die arcana imperii autoritärer Verwaltungspraktiken, kaum noch verhüllt vom demokratischen Schafspelz.
(24) K. Gründer: Perspektiven für eine Theorie der Geschichtswissenschaft. In: Saeculum XXII, 1971/2-3, S. 112
Literatur
Behrmann, Günter C. (1972): Soziales System und politische Sozialisation. Eine Kritik der politischen Pädagogik. Stuttgart: Kohlhammer.
Blankertz, Herwig (1969a): Bildung im Zeitalter der großen Industrie. Hannover: Schroedel.
Blankertz, Herwig (1969b): Theorien und Modelle der Didaktik, 2. Aufl. München: Juventa.
Drechsel, Wiltrud Ulrike (1969): Erziehung und Schule in der Französischen Revolution (Frankfurter Beiträge zur Pädagogik). Frankfurt am Main: Diesterweg.
Faber, Karl-Georg (1971): Theorie der Geschichtswissenschaft. München: Beck.
FAZ, 27. 2. 1973: Die Erklärung der an der Ausarbeitung der Richtlinien beteiligten OSchR Ingrid Haller.
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, Jg. 23. 1972. (10), 613-623.
Giese, Gerhardt (1961): Quellen zur deutschen Schulgeschichte seit 1800. Berlin [u.a.]: Musterschmidt.
Gründer, Karlfried (1971): Perspektiven für eine Theorie der Geschichtswissenschaft. In: Saeculum XXII, (2-3), Seite 112.
Günther, Karl-Heinz (1968): Quellen zur Geschichte der Erziehung, Aufl. Berlin: Volk und Wissen.
Humboldt, Wilhelm von (1960): Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen (1792). Werke in fünf Bänden. In: Flitner, A.; Giel, K. (Hg.): Bd. I.. Darmstadt.
Kleine pädagogische Texte. Weinheim: Beltz.
Krockow, Christian von (1972): Eine Grundlagen-Kritik der politischen Pädagogik. In: Gesellschaft - Staat - Erziehung, Jg. 17 (6), Seiten 381 - 384.
Marrou, Henri Irénée (1959): De la connaissance historique. Paris: Ed. du Seuil.
Meyer, Hilbert L. (1971): Das ungelöste Deduktionsproblem in der Curriculumforschung. In: Achtenhagen, Frank; Meyer, Hilbert L. (Hg.): Curriculumrevision, Möglichkeiten und Grenzen. München: Koesel, Seiten 107 ff.
Nipperdey, Thomas (1972): In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, Jg. 23, Seiten 577 - 596.
Schaff, Adam (1970): Geschichte und Wahrheit. Wien: Europa.
Schepp, Heinz -Hermann (1966): Bericht und Entwurf einer Verordnung über die allgemeine Organisation des öffentlichen Unterrichtswesens (1792). In: Kleine pädagogische Texte, Bd. 36. Weinheim: Beltz.
Spranger, Eduard (1962): Der Bildungswert der Heimatkunde. 3. Aufl. Stuttgart: Reclam.
Stern, Fritz (1963): Kulturpessimismus als politische Gefahr. Bern, Stuttgart: Scherz.
Taine, Hippolyte: Die Entstehung des modernen Frankreichs. Deutsch von L. Katscher, 2. Bd., 3. Abt., Leipzig o. J., (3. Aufl.).
Thoma, G. (1972): Zur Strukturierung der ‘politischen Dimension’ des Unterrichts im Teilbereich der allgemeinen Gesellschaftslehre an der Kollegstufe. In: Kollegstufe NW, Schriftenreihe des KM (17), Düsseldorf , Seite 161.
Wilmans, E. (1949): Geschichtsunterricht. Grundlegung seiner Methode. Stuttgart: Klett.
Pandel, Hans-Jürgen (1978): Integration durch Eigenständigkeit? Zum didaktischen Zusammenhang von Gegenwartsproblemen und fachspezifischen Erkenntnisweisen
Um die Möglichkeiten einer pädagogisch notwendigen Zusammenarbeit von Sozialkunde, Geographie und Geschichte zum Zwecke der politischen Bildung zu erörtern, wähle ich im folgenden als theoretische Prämisse einen fachdidaktischen Bezugsrahmen (1). Fachdidaktik begreife ich dabei weder als schiere Unterrichtstechnologie noch als fachenthobene allgemeine Didaktik, sondern als Reflexionsinstanz, die darauf gerichtet ist, den gesellschaftlichen Relevanzanspruch und die faktische Relevanzwirkung der Fachwissenschaften auf Lernprozesse in Form von Emanzipationsprozessen der lernenden Subjekte einzulösen. Ausdruck für diesen Anspruch ist die beobachtbare Tendenz der Fachdidaktiken, sich als kritische wissenschaftliche Instanzen mehr und mehr zwischen Fachwissenschaften und Schule einerseits und zwischen Staat und Schule andererseits zu schieben. Die Fachdidaktiken wären der theoretisch geeignete und legitime Ort, die Ansprüche von Schuladministrationen und Wissenschaften in reflektierter Parteinahme für den Schüler zu prüfen. Das gilt auch für die Forderung nach Kooperation, Integration und Eigenständigkeit der Schulfächer.
Weder Vertreter der Fachwissenschaften, des Staates, der Schulpraxis noch der Standesverbände konnten bisher eine Lösung dieses Problems anbieten. Es wurden weder befriedigende Integrationskonzepte vorgelegt, noch wurden überzeugende Nachweise für deren Unmöglichkeit erbracht. Die Antworten wurden nämlich auf Ebenen gesucht, auf denen sie m. E. nicht zu finden sind. Das Problem der Integration, Kooperation und Eigenständigkeit der Unterrichtsfächer im Rahmen der politischen Bildung ist weder ein [/S. 347:] wissenschaftsorganisatorisches oder ein bildungspolitisches, sondern ein didaktisches Problem. Diese Problemkonstellation brachte deshalb auch Richtlinienverfasser und um Integration bemühte Schulpraktiker immer wieder in Schwierigkeiten. Sie waren (und sind es wohl noch immer) gezwungen, einen fachdidaktischen Diskussionsstand zu antizipieren, der heute noch nicht erreicht ist. So existiert z. B. noch immer keine einzige fachdidaktische Monographie des Integrationsproblems.
Der Anspruch der Fachdidaktiken, diejenigen Probleme zu lösen, die bisher als bloße wissenschaftsorganisatorische und bildungspolitische Fragen angesehen wurden, hat ihnen heftige Kritik eingetragen. Ihnen wird die Legitimation, Ziele zu formulieren, als ein "hybrider" Anspruch abgesprochen (2); weiterhin wird ihnen vorgeworfen, nur eine "sich zum Heilsmythos steigernde Didaktik" könne das Integrationsproblem lösen wollen (3). Trotz dieser Argumente, die als wenig überzeugende Gegenvorschläge die sich potentiell im Vierjahreszyklus der Wahlen erneuernde staatliche Dezision und eine personengebundene Wissenschaftlerethik für Interdisziplinarität empfehlen, halte ich an dem Konzept einer wissenschaftstheoretisch aufgeklärten und um Erkenntnisweisen zentrierten Didaktik als Sozialwissenschaft fest.
Eine fachdidaktische Bestandsaufnahme des Integrationsproblems (in dem eben skizzierten Sinne von Fachdidaktik) müßte sich m. E. auf drei Argumentations- und Diskussionszusammenhänge beziehen: auf die curriculare Diskussion, wie sie sich nach Abschluß der Richtlinienkontroversen zeigt, auf den innerwissenschaftlichen Diskussionsstand der Fachwissenschaften und auf die Ergebnisse der Wissenschafts- und Erkenntnistheorie. Die Fachdidaktiken lassen sich gegenwärtig stärker auf die Reflexion ihrer facheigenen Grundlagen ein und gewinnen zunehmend an kategorialer Festigkeit. Der innerwissenschaftliche Diskussionsstand in den Fachwissenschaften, der gekennzeichnet ist durch Tendenzen und Versuche einer sozialwissenschaftlichen Fundierung sowie einer explizit gemachten gesellschaftstheoretischen Orientierung der Disziplinen, ergibt [/S. 348:] (eventuell) neue Perspektiven für die didaktische Diskussion (Geschichte als Historische Sozialwissenschaft, Geographie als Sozialgeographie bzw. als Raumwissenschaft). Ein für die Didaktik noch unerschlossener Argumentationszusammenhang liegt in der Wissenschaftstheorie vor. Von der "Wissenschafts-Wissenschaft" haben die Didaktiken bisher kaum Kenntnis genommen.
1. Wissenschaftstheorie
Der Begriff "Fachdidaktik" verweist nicht nur darauf, daß Fachdidaktik selbst ein Fach ist, sondern kennzeichnet auch ihre Bezogenheit auf andere Fächer. Eine Überprüfung der Bedingungen für die Möglichkeiten einer Integration von Fächern muß sich deshalb über Voraussetzung, Struktur und Logik von "Fächern" Klarheit verschaffen. Jenseits ihres organisatorischen Status als Institutionen begründen sie sich in ihrem wissenschaftshistorischen Prozeß auf gegenstandstheoretischer, methodologischer und konstitutionstheoretischer Ebene. Von diesen drei sich durchdringenden Ebenen soll geprüft werden, welche hemmenden oder fördernden Bedingungen für eine Integration vorliegen.
1.1 Gegenstandstheoretische Ebene
Integration wird erleichtert durch die gegenstandstheoretische Einsicht, daß die einzelnen Fachdisziplinen sich nicht durch eine besondere Dignität ihres dinglich verstandenen oder phänomenologisch wahrgenommenen Gegenstandes unterscheiden. Gegenstände von Wissenschaft sind nicht irgendwelche von vornherein gegebenen Klassen von separaten Phänomenen. Die Verschiedenheit der Wissenschaften resultiert nicht daraus, daß sie einen bestimmten vorgängig gegebenen Gegenstand, eine bestimmte exklusive Klasse von Phänomenen, zu ihrem ausschließlich von ihnen zu untersuchenden Gegenstand machen. Auf alle Dinge, Personen und Ereignisse in der Welt können sich alle Wissenschaften forschend beziehen. Da die Vergangenheit kein Monopolobjekt der Geschichtswissenschaft und die Gegenwart keines der Politologie oder Soziologie ist, kann jede vergangene, [/S. 349:] gegenwärtige und zukünftige Gesellschaft von allen diesen Disziplinen zum Objekt ihrer Forschung gemacht werden (4). Ein Blick auf die neuere Disziplin der Friedens- und Konfliktforschung macht deutlich, daß ein Fach nicht lediglich durch einen konkretistisch gefaßten "Gegenstand" definiert wird. "Kriege" und "Konflikte" waren und sind "Gegenstände" etablierter Disziplinen. Die Friedens- und Konfliktforschung geht diese Gegenstände unter eigenen, neueren Fragestellungen an, wenn sie nach den gesellschaftlichen Bedingungen des Friedens, der strukturellen Gewalt oder nach der organisierten Friedenslosigkeit fragt. Ähnlich verhält es sich mit den Gegenständen "Geschichte" und "Vergangenheit". Auch sie ergeben allein keine tragfähige Basis zur Definition einer bestimmten Wissenschaft. Mit dem Gegenstand "Zeitgeschichte" befassen sich Politologie, Soziologie und Geschichtswissenschaft gleichermaßen, ohne daß dabei deren Verfahrensweisen oder deren Antworten, die sie auf ihre unterschiedlichen Frageweisen erhalten, identisch werden (5). Auf dem Gebiet der Zeitgeschichte ist in den letzten Jahren das Nebeneinander unterschiedlicher Disziplinen kaum strittig gewesen. Die Geschichtswissenschaft konnte aber die übrigen Bereiche der Vergangenheit mit gutem Grund um so mehr als ihr Monopolobjekt betrachten, als sich die Soziologie in Methode und in den von ihr gewählten Erkenntnisbereichen immer mehr enthistorisierte. Die Zahl der historisch gerichteten soziologischen Untersuchungen nimmt gegenwärtig aber merklich zu (Norbert Elias, Klaus Eder, Karlheinz Messelken) (6). Damit werden alle klassischen Entgegensetzungen, die vom dinglichen oder phänomenologischen Gegenstand her Geschichtswissenschaft und systematisierende Sozialwissenschaften zu unterscheiden suchten, immer unschärfer: Vergangenheit vs. Gegenwart, Geschichte vs. Gesellschaft, Geschichte vs. Politik, "res gestae" vs. "res gerendae" verlieren immer mehr ihre analytische Trennschärfe (vorausgesetzt, daß sie sie jemals besessen haben). Das gilt auch für die Formalgegenstände Individuelles vs. Allgemeines und Raum vs. Zeit. Ohne den hohen Stellenwert von Individuellem oder [/S. 350:] von Zeit für die Geschichtswissenschaft in Abrede stellen zu wollen, kann der Historiker weder individuelle Ereignisse noch Zeitphänomene für sich reklamieren. Politologische und soziologische Fallstudien befassen sich ebenso mit Individuellem wie Psychologie, Psychiatrie und Soziologie mit der Zeit (7). Historiker und Geographen, die die Praxis ihrer Disziplin reflektieren, machen deutlich, daß ihre Wissenschaften sich nicht durch einen vorab gegebenen Gegenstand definieren (8). So schreibt der Historiker Reinhart Koselleck: "In der Praxis ist das Objekt der Historie alles oder nichts, denn ungefähr alles kann sie durch ihre Fragestellung zum historischen Gegenstand deklarieren. Nichts entgeht der historischen Perspektive" (9). Noch konkreter faßt es Fred K. Schaefer für die Geographie: "Demnach muß die Geographie ihre Aufmerksamkeit auf die räumliche Anordnung der Phänomene in einem Gebiet, und nicht so sehr auf die Phänomene selbst richten ... Nichträumliche Beziehungen, die sich unter den Phänomenen eines Gebietes finden, sind Untersuchungsgegenstand anderer Spezialisten wie der Geologen, Anthropologen oder Ökonomen ..." (10). Die "physischen Manifestationen wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Sachverhalte [bilden] keine selbständige Gegenstandskategorie", sondern sind "Beobachtungsgrundlage, welche die Analyse der eigentlichen Problemkategorie erleichtert" (11). Werner Hofmann hatte bereits vor Jahren die Definition einer Wissenschaft von einem Gegenstand her verworfen: "Wissenschaft ist durch nichts außer ihr Gegebenes, gleichsam dinglich, gesichert" (12). Folgt man dieser Argumentation, so fehlt einem Fach Gesellschaftslehre der wissenschaftstheoretisch gesicherte Zugriff, sofern man es vom "Gegenstand Gesellschaft" her konzipieren will. Trotzdem ist mit diesem Argument kein Einwand gegen die didaktische Forderung vorgebracht, Gesellschaft zum Gegenstand von Unterricht zu machen. Da der Gegenstand Gesellschaft nicht unabhängig vom Erkennenden schlicht objektivistisch gegeben ist, kann er nur über die unterschiedlichen fachspezifischen Frage- und Erkenntnisweisen erschlossen werden (13). [/S. 351:]
1.2 Methodologische Ebene
Integration wird erschwert durch die Einsicht in den gegenstandskonstitutiven Charakter der wissenschaftlichen Methoden. Die Einheitswissenschaft mit der Einheitsmethode ist ein wissenschafts-konservativer, positivistischer Traum geblieben. Im Positivismusstreit wurde offenbar, daß sich die Einheit der Wissenschaft durch das Verfahren nicht herstellen läßt. Allerdings sind Methoden nicht einer einzigen Fachwissenschaft zu eigen, sondern einer Fächergruppe. Die an der politischen Bildung im engeren Sinne beteiligten Fächer sind nicht einer einzigen, sondern mehreren Methoden verpflichtet. Keines dieser einzelnen Fächer ist methodologisch autonom; ihre Methoden sind vielmehr integraler Bestandteil einer allgemeinen Methodologie aller Sozialwissenschaften. Eine Reduzierung auf eine oder wenige Methoden - z. B. durch den Ausschluß der Hermeneutik -‚ um durch größere Einheitlichkeit Integrationsvoraussetzungen zu schaffen, ist ohne Erkenntnisverlust nicht möglich. Da diese Methoden emanzipationsermöglichendes Denken befördern sollen, wenn sie gelehrt werden, ist ihre Reduktion auf eine sogenannte Einheitsmethode mit gravierenden didaktischen Gefahren verbunden: Den Schülern werden Erkenntnismöglichkeiten vorenthalten. Mit "Methoden (historischer, politologischer, soziologischer, psychologischer etc.) Erkenntnis" sind jene Operationen der geistigen Auseinandersetzung mit den "Repräsentationsmodi der Gegenständlichkeit" (14) gemeint, die zu fachspezifischen Aussagen führen. Den Methoden, verstanden als folgerichtige Denkoperationen, liegt eine bestimmte Erkenntnisabsicht und damit eine bestimmte Aussageintention zugrunde. Der Schüler sollte daher nicht in erster Linie Wissensbestände lernen, sondern die "Wege des Fragens und Urteilens" (15). Insofern sind die Methoden der Erkenntnis Aneignungsform en oder Verfahrensweisen des Nachdenkens über Gegenstände, die durch das Verfahren des Nachdenkens erst konstituiert werden. Diese Erkenntnisweisen sind in der didaktischen Literatur ein bislang kaum diskutierter Bereich (16). Untersuchungen über diejenigen Erkenntnisweisen, denen sich ein Schüler bedie[/S. 352:]nen muß, wenn er für das "Fach", in dem er diese Erkenntnisweisen anwendet, zu fachspezifischen Aussagen kommen will, fehlen noch. Da diese Erkenntnisweisen für die einzelnen Wissenschaften grundlegend sind, können sie von den Didaktikern nicht (mehr) beliebig entworfen oder verändert werden. Sie sind vielmehr in den Wissenschaften "vorgezeichnet". In dem Bereich der Didaktiken der Sozialkunde, Geographie und Geschichte - einschließlich ihrer Bezugsdisziplinen - haben wir es vorwiegend mit vier unterscheidbaren Erkenntnisweisen zu tun, die unterschiedliche Erkenntnismöglichkeiten bieten:
- die historisch-hermeneutische Verfahrensweise,
- die kritisch-dialektische Verfahrensweise,
- die empirisch-analytische Verfahrensweise,
- die quantitativ-statistische Verfahrensweise.
Wenn durch die Unmöglichkeit einer Universalmethode die Integration nicht gerade erleichtert wird, so bieten die unterschiedlichen Verfahrensweisen doch die Grundlage für weitere Überlegungen. Auf dem Hintergrund dieser gegenstandskonstitutiven Verfahrens- und Erkenntnisweisen lassen sich m. E. weiterführende Aussagen über Kooperation, Integration und Eigenständigkeit der Unterrichtsfächer treffen. Geht man in der Analyse der Kooperations-Integrations-Problematik auf die fach(bereichs)spezifischen Erkenntnisweisen als Arten wissenschaftlichen Arbeitens zurück, so stellt sich die Frage der Zusammenarbeit der Unterrichtsfächer anders dar, als sie bisher diskutiert wurde. Die isolierenden Fächergrenzen sind nämlich in einer gewissen Weise bereits durchbrochen - und zwar durch die Erkenntnisweisen, "die sich zwar weitgehend, aber nicht vollständig mit Fächerbereichen im institutionellen Sinne decken bzw. zu decken brauchen" (17). Diese Erkenntnisweisen finden wir nur schwerpunktmäßig in den einzelnen Disziplinen. Selbst die einzelnen akademischen Schulen und Forschungsrichtungen innerhalb einer Disziplin bedienen sich unterschiedlicher Erkenntnisweisen, so daß die Verwandtschaft zu einem Nachbarfach der Disziplin oft eher erkennbar ist als zu einer anderen akademischen Schule innerhalb der eigenen Disziplin. [/S. 353:]
1.3 Konstitutionstheoretische Ebene
Die in einem Integrationsprozeß nicht einschmelzbaren Elemente sind die wissenschaftlichen Frageweisen, durch die sich die Wissenschaften erst konstituieren. Fächer konstituieren sich durch eine bestimmte Weise des Fragens und der daraus folgenden Art des Nachdenkens. Fächer sind folglich Denkweisen. Die jeweils spezifischen Frageweisen sind es, die die Eigen-Art der Wissenschaftsdisziplinen ausmachen. Wenn die Wissenschaften sich nicht durch die Ausrichtung auf separate Gegenstände konstituieren, sondern durch die Frageweisen, müssen sie sich mittels dieser Frageweisen ihren Gegenstand als Objekt möglicher Erkenntnis begrifflich erzeugen. Der Objektbereich des Fragens und Forschens wird im wesentlichen durch die Frageweise konstruktiv hergestellt (18). Erkenntnisgegenstände der Wissenschaft, die durch die "kategoriale Formung der Gegenstandsbereiche" (19) entstehen, sind somit nicht primär vorgegeben, sondern erst sekundär durch Wissenschaft konstituiert (20). Von den jeweiligen spezifischen konstitutiven Fragestellungen ausgehend, werden im Forschungsprozeß in empirischer und logischer Analyse systematische Aussagen über Zusammenhänge von Bereichen der Wirklichkeit oder systematische Aussagen über das System der Aussagen selbst gefunden (Disziplin und Metadisziplin). "Fächer" sind also "die verschiedenen objektiv möglichen und üblichen Weisen, die Welt zu begreifen und deren Ergebnisse" zu verstehen (21). Wirklichkeit wird auf eine spezifische Art erfaßt und denkend geordnet (22). Diese Definition von Fach macht keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Schul-Fach und Wissenschafts-Fach. Sie geht vielmehr davon aus, daß die Denkweisen in beiden Bereichen prinzipiell richtungsgleich und in ihrer Spezifik identisch sind. Forschungslogik und Unterrichtslogik werden dadurch aber nicht gleichgesetzt. Die Logik der Forschung folgt, wenn sie einmal von gesellschaftlich-praktischen Problemen ausgegangen ist, auch wissenschaftsimmanenter Gesetzlichkeit. Sie erbringt Ergebnisse des Faches, die von der Didaktik daraufhin befragt werden müssen, ob sie als Unterrichtsgegen[/S. 354:]stände geeignet sind, Wirklichkeit - und das heißt in diesem Falle: die Gegenwart und absehbare Zukunft des Schülers innerhalb einer historisch-gesellschaftlichen Konstellation - durch bestimmte Denkweisen zu begreifen und denkend zu ordnen (23). Fachwissenschaft ist damit ein "zumindest prinzipiell richtungsgleiches Verfolgen der auch im vorwissenschaftlichen Streben ... wirksamen Fragen" (24). Wenn aus praktischem Bedürfnis sich spezifische Fragen herausgebildet haben, die mit rational gesicherten und verfeinerten Methoden in den Fachwissenschaften fortgesetzt werden, kann ein Verzicht auf diese Betrachtungsweisen nur durch einen Verzicht auf bestimmte gesellschaftlich-praktische Erfahrung erkauft werden. Aus dem erkenntnistheoretischen Primat der Frageweisen folgt, daß sie sich nicht mit beliebigen Methoden verbinden lassen. Erkenntnismethoden (Verfahrensweisen und Forschungstechniken) müssen vielmehr mit den Frageweisen kompatibel sein, denn der Gegenstand wird nicht nur durch die Frageweise konstituiert, sondern er wird auch durch die Erkenntnismethoden mitkonstituiert. Verfahrensweisen und Untersuchungstechniken, derer sich die Erkenntnisweisen bedienen müssen, schlagen auf die Frageweise zurück und können, falls dieser Zusammenhang vernachlässigt wird, eine ganz andere als durch diese Frage angestrebte Aussageintention erzeugen.
2 Sozialwissenschaften als Bezugsdisziplinen
Sozialwissenschaften sind diejenigen Disziplinen, die ihre durch die eigene Fragestellung erzeugte faktische Wirkung auf die soziale Lebenspraxis reflektiert in ihr Forschungsinteresse aufgenommen haben. Eine abschließende Entscheidung darüber, ob die Geschichtswissenschaft und die Geographie sich insgesamt als Sozialwissenschaften begreifen, ist noch nicht in Sicht. Diese Frage ist für die Didaktiken von großem Interesse, da sie Konsequenzen für methodologische Probleme, für das Selbstverständnis, die Erkenntnisinteressen und die gesellschaftstheoretische Orien[/S. 355:]tierung nach sich zieht. Der Charakter der Didaktiken kann dagegen unabhängig davon definiert werden, wie die Bezugsdisziplinen sich entscheiden. Wenn die Didaktiken nicht "Kunst" oder "Technik", sondern Wissenschaften sein wollen - und vieles spricht dafür, daß sie gegenwärtig auf dem Wege sind, ihr Paradigma als Wissenschaft zu formulieren -‚ dann bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als sich selbst als Sozialwissenschaften zu verstehen. Didaktiken sind, auch als Didaktiken von Naturwissenschaften, unweigerlich Sozialwissenschaften. Sie können und müssen deshalb auch mit den Begriffen der Sozialwissenschaften untersucht werden.
2.1 Sozialwissenschaft: Integration oder Spezialisierung
Die Hoffnung, der Forderung nach Integration durch eine sozialwissenschaftliche Umorientierung der Fachdisziplinen nachzukommen, hat sich bisher nicht erfüllt. Der Begriff "Sozialwissenschaften" legt eine Addition kompatibler und homogener Disziplinen nahe und täuschte in der Diskussion um das Fach (!) Gesellschaftslehre über die Unterschiede der einzelnen Sozialwissenschaften hinweg. Wenn politische Bildung in den Sozialwissenschaften ihre Bezugsdisziplinen hat (und eine Alternative dazu zeichnet sich zumindest im Augenblick nicht ab), ist sie darauf angewiesen, daß die einzelnen Disziplinen ihr mit einer Umorientierung die entsprechenden Vorgaben machen. In der Diskussion um die sozialwissenschaftliche Umorientierung ist aber auf eine gravierende Differenz zu achten: Es ist von eminenter Bedeutung, ob die Disziplin sich als Ganzes als Sozialwissenschaft begreift, oder ob damit nur eine Spezialdisziplin (Sozialgeschichte, Sozialgeographie) neben anderen Spezialdisziplinen (Mittelalterliche Geschichte, Wirtschaftsgeographie) gemeint ist. Bezieht sich das Verständnis als Sozialwissenschaft nur auf eine dieser Spezialdisziplinen, so hat das für die Integrationsproblematik tiefgreifende Folgen. Die Umorientierung und Definition als Sozialwissenschaft kann nämlich nicht durch Amputation, durch eine radikale Abtrennung einzelner Wissenschaftsgebiete erfolgen. Teilbereiche (Wirtschafts- und Sozialgeographie, Wirtschafts- und [/S. 356:] Sozialgeschichte) können nicht als fortschrittlichste Varianten der Gesamtdisziplin angesehen werden, um dann durch Zusammenfassung dieser Teilbereiche das Integrationsproblem zu "lösen". Die Widersprüchlichkeit einer solchen Integrationsstrategie ist offenkundig. Im Bemühen, sich nicht in enge Fächerungen einsperren zu lassen, gründet eine so verfahrende Didaktik sich nicht auf eine (!) "breite" Sozialwissenschaft als Bezugswissenschaft, sondern auf enge Spezialdisziplinen. Anstatt die isolierenden Wände der Zellen zu beseitigen, sind sie nur enger gezogen worden.
2.2 Darstellungsformen
Die Diskussion um die theoretischen Prämissen und um das Selbstverständnis als Sozialwissenschaft brachte für die Frage der Integration insofern eine positive Rückwirkung auf die Didaktiken, als sich die Formen, in denen sich die Darstellung der fachwissenschaftlichen Ergebnisse vollzog, nicht als Essentials der Disziplinen erwiesen. So erfuhren die didaktischen Darstellungsformen - chronologischer Durchgang, Länderkunde, Fallprinzip -‚ die in ihrer Heterogenität immer ein Integrationshemmnis darstellten, keine Unterstützung durch die bisherige Grundlagendiskussion. Sie erwiesen sich lediglich als traditionelle Vorlieben. Eine bestimmte Art des Denkens, das sich als ein Denken vom Out-put des Forschungsprozesses her charakterisieren läßt, hat die Darstellungsformen zu einem Integrationshemmnis ersten Ranges werden lassen. Es standen immer die Ergebnisse des Forschungsprozesses im Vordergrund, nicht dessen Fragestellungen. Im Fachunterricht sollten diese Ergebnisse gelernt werden und nicht das Fach als Frage- und Denkweise. Demzufolge sind auch im Bereich der politischen Bildung die Beiträge der einzelnen Fächer vorwiegend von den Ergebnissen der (fachwissenschaftlichen) Forschung her bestimmt worden. Fach und Forschungsergebnis wurden gleichgesetzt. Erschwerend (für die Integrationsproblematik) kommt noch hinzu, daß die Forschungsergebnisse die Summe der im historischen Prozeß des Forschens aufgehäuften Resultate sind, die zudem teilweise Antworten auf bereits vergangene historische Situationen darstel[/S. 357:]len. Während in der Vergangenheit die Unterrichtsfächer Geschichte und Geographie im Materiellen der kumulierten Forschungsergebnisse verharrten, trieb die Sozialkunde die Entmaterialisierung der Bildungsprozesse auf die Spitze. Das Fallprinzip verband sich bei vielen Sozialkundedidaktikern immer mit der These von der Austauschbarkeit der Inhalte. Darin, daß die Inhalte völlig sekundär seien, wurde die Didaktik der Sozialkunde noch von der Curriculumtheorie bestärkt, indem diese die Inhalte in ein instrumentelles Verhältnis zu den Zielen setzte. Das Nachdenken über Integrationsmöglichkeiten mußte sich zwangsläufig festlaufen: Geographen und Historiker beharrten auf ihren in bestimmten Darstellungsformen angeordneten Inhalten. Die Sozialkundedidaktiker insistierten zwar nicht auf bestimmte Inhalte, aber sie bestanden darauf, daß man nicht auf bestimmten Inhalten beharren dürfe - diese aber müßten kasuistisch dargestellt werden. Die Unzulänglichkeit dieser isolierenden, traditionellen Darstellungsformen, die durch ihre Erstarrung den Kernbereich jeder Didaktik, die Auswahltheorie, suspendierten, ist inzwischen hinreichend bekannt. In der didaktischen Reflexion haben diese Formen keinen Stellenwert mehr. Es bleibt aber (selbstkritisch) anzumerken, daß in der Schulpraxis weitgehend noch nach diesen Darstellungsformen verfahren wird, da die methodische Phantasie der (Hochschul-)Didaktiker keine alternativen, prinzipiell auf Integration angelegten Darstellungsformen bereitzustellen vermochte.
2.3 Erkenntnisinteressen
Ihre Selbstdefinition als Sozialwissenschaften mit einer explizit gemachten gesellschaftstheoretischen Orientierung läßt die Einzeldisziplinen zwar nicht in einer einzigen Wissenschaft aufgehen, verpflichtet sie aber auf ein gemeinsames (emanzipatorisches?) Erkenntnisinteresse. Dieses Erkenntnisinteresse stellt in doppelter Hinsicht ein notwendiges Vermittlungsglied zur politischen Bildung dar. Gravierende Differenzen zwischen den einzelnen Sozialwissenschaften, die einer Zusammenarbeit hemmend im Wege [/S. 358:] stehen, können damit ebenso abgebaut werden wie zwischen den Sozialwissenschaften und den Didaktiken. Ohne diese Gemeinsamkeit in dem Erkenntnisinteresse wird das Verhältnis von Wissenschaft und politischer Bildung ein gewalttätiges Unternehmen, das in Schülerköpfe etwas hineinpraktiziert, was mit den aktuellen und zukünftigen Interessen der Schüler nicht zu vereinbaren ist. Der bisherige und noch andauernde Widerstand gegen den erkenntnistheoretischen Begriff des Erkenntnisinteresses ist in erster Linie durch die damit verknüpften Folgerungen motiviert. Ausgewiesenes Erkenntnisinteresse bedeutet, den Gegenwartsbezug allen Fragens und Forschens anzuerkennen, und das heißt wiederum, Gegenwart als Prinzip der Auswahl von Forschungsobjekten und Unterrichtsinhalten zu akzeptieren. Für Theorie und Logik der Sozialwissenschaften ist das keine neue Erkenntnis. Daß die Auswahl von Forschungsgegenständen von den Wertentscheidungen der Fragenden abhängt, hatte bereits Max Weber gezeigt, indem er darauf hinwies, daß nur interessierende Merkmale gesellschaftlicher Wirklichkeit zum Untersuchungsgegenstand gemacht werden können. Die Einsicht in den Zusammenhang von Erkenntnisinteressen, Gegenwart und Auswahl wurde bisher immer mit dem Vorwurf mangelnder Wissenschaftlichkeit abgelehnt. In diesem Punkt scheint sich durch die zunehmende geschichtstheoretische Diskussion eine Wende anzubahnen: Integration wird erleichtert durch die sich immer mehr durchsetzende Einsicht in die Gegenwartsbezogenheit der Geschichte (sowie von Wissenschaft überhaupt). Daß der Gegenwartsbezug die Wissenschaftlichkeit der Geschichtswissenschaft keineswegs aufhebt, wurde in letzter Zeit mehrfach von der Geschichtstheorie belegt. "Perspektivität und Objektivität" (Wolfgang J. Mommsen) sowie "Objektivität und Praxisbezug" (Jörn Rüsen) sind in der Geschichtswissenschaft keine einander widersprechenden und einander ausschließenden Faktoren. Sie gehören vielmehr unverbrüchlich zusammen (25). Damit scheint sich eine innerwissenschaftliche Entwicklung anzubahnen, die der Geschichte die Gegenwart wiederzugewinnen hilft. [/S. 359:]
3. Didaktik
Neben den bisher aufgezeigten, stärker wissenschaftstheoretisch und fachwissenschaftlich orientierten Vorschlägen zum Integrationsproblem lassen sich auch drei didaktische Lösungsstrategien benennen. Diese Ansätze versuchen, durch die Betonung der sozialen Komplexität, durch die Formulierung von "allgemeinen" Lernzielen und durch die Umschreibung von Lernfeldern die unterschiedlichen Fächer zusammenzubinden oder durch den Rückgriff auf ein "vorfachliches" Orientierungssystem einander zuzuordnen. Obwohl diese Lösungsstrategien ihrem Ansatz nach überfachlich und allgemein sein sollen, wurden unter der Hand die Fachwissenschaften - gegen den Willen der diese Ansätze vertretenden Autoren - doch wieder zum bestimmenden Moment.
3.1 Soziale Komplexität und Aspekt
Ein nicht realisierbarer Integrationsansatz ergibt sich aus der Zuordnung von "Komplexität" und "Aspekt". Inhalte der politischen Bildung sind vieldimensional und können deshalb unter den jeweils verschiedenen fachspezifischen Sichtweisen betrachtet werden. Diese Einsicht ist in der Literatur unter die Begriffe "Komplexität" und "Aspekt" gefaßt worden. Die Gleichberechtigung der verschiedenen Sichtweisen bei der Analyse gesellschaftlicher Sachverhalte ist prinzipiell möglich und auch anzuerkennen. Die verschiedenen Sichtweisen sind im didaktischen Sinne keineswegs gleichwertig. So wie der Inhalt "Autoritätsfixierung" unter dem Aspekt "Mythos Hindenburg" oder "Fixierung an den Führer" behandelt werden kann, kann der Inhalt "Gastarbeiter" auch unter dem sozialpsychologischen Aspekt der "Vorurteilsbereitschaft" angegangen werden. Damit werden aber keinesfalls die Problembereiche "Faschismus" und "Lohnarbeit des Subproletariats" miterledigt. Die Isolierung und Betonung von bestimmten Teilaspekten läßt Faktoren in den Vordergrund treten, die für die Erklärung des Gesamtproblems nur sekundären Charakter tragen. Inhalte werden diesem Verfahren in einseitiger Weise akzentuiert [/S. 360:] und in der Folge wie ich meine, auch entpolitisiert. So ergab eine quantitative Inhaltsanalyse von acht Unterrichtsmodellen und Sozialkundebüchern zum Problem "Gastarbeiter", daß 57 % aller Aussagen sozialpsychologischer Art waren und 10,5 % sich auf ökonomische Sachverhalte bezogen (26). Der Schritt zur zwischenmenschlichen Freundlichkeit des "Seid-nett-zueinander" ist nicht weit. Aus diesen Gründen kann das Integrationsproblem innerhalb der Sozialkunde keineswegs als gelöst gelten. Die Möglichkeit unterschiedlicher Analyseansätze ist nicht identisch mit deren Lernwürdigkeit. Aus der Perspektive der Didaktik, die sich als Sozialwissenschaft auf den Horizont der Gegenwart bezieht, gibt es an den Inhalten dominante Strukturen. Eine dominante Struktur im didaktischen Sinne bemißt sich nicht an der fachwissenschaftlichen Möglichkeit, die Fragerichtung auf beliebige Aspekte zu reduzieren, sondern an der Perspektive gelingender oder verhinderter Emanzipationsprozesse. Inhalte haben in der Gegenwart einen ganz bestimmten und von ihr affizierten Wertakzent. Sie können nicht aus methodischen Gründen (Lernerleichterung, Anschaulichkeit etc.) oder fachlicher Kompetenz (Ausbildung, Vorliebe etc.) des Lehrers auf bestimmte Aspekte hin reduziert werden.
3.2 Allgemeine Lernziele
Den bisher erfolgversprechendsten Ansatz zur Integration von Unterrichtsfächern bildeten die Entwürfe von "allgemeinen Lernzielen". Diese Lösungsstrategie lastet die eigentliche Integrationsfunktion den Lernzielen an. Sie sollen die einzelnen Fächer oder Fachaspekte integrieren und weitergehende Ansprüche der Fächer filtern. Allgemeine Lernziele - die Angabe "allgemein" ist meist stillschweigend auf fächergruppenspezifische Lernziele eingeschränkt - sind im Bereich der politischen Bildung ihrem Anspruch nach Ziele, die mit dem Blick auf das "Lernfeld Gesellschaft" formuliert sind, ohne daß auf einzelne fachwissenschaftliche Disziplinen zurückgegriffen werden muß. Ihrem Charakter nach sollen sie die Funktion eines Netzes haben, das (politi[/S. 361:]sche) Wirklichkeit einfängt. Darüber hinaus versuchen sie andere (fachliche) Lernziele zusammenzuhalten, um "begrenztes Fachdenken" zu überwinden. Diesen Lernzielen wird die Fähigkeit zugetraut, die einzelnen Fächer zusammenzuhalten, wenn sie ihnen in Form von fachspezifischen Lernzielen zugeordnet werden.
Die großen Erwartungen, die man in die allgemeinen Lernziele als Integrationsinstrumente gesetzt hatte, haben sich nicht erfüllt. Die theoretischen Prämissen, von denen man ausgegangen war, lassen sich aus wissenschaftstheoretischen Gründen nicht halten. Plausible Argumente sprechen vielmehr für folgende These: Allgemeine Lernziele binden die Fächer nicht zusammen, da allgemeine Lernziele immer schon unter Zuhilfenahme der auch in der Umgangssprache implizierten Paradigmen der Fachwissenschaften formuliert werden. Der gegenwärtige Diskussionsstand der Lernzielproblematik ermöglicht es, im einzelnen folgende kritische Fragen nach Voraussetzungen und Möglichkeiten der allgemeinen Lernziele zu stellen: Als erstes stellt sich die Frage nach der Instanz. Wer formuliert die allgemeinen Lernziele? Wenn sie "allgemein" sein sollen, können sie nicht von einer einzelnen Fachwissenschaft oder Fachdidaktik formuliert werden. Auch ein Gremium unterschiedlicher Fachvertreter kann nicht angenommen werden, da allgemeine Lernziele ihrem Anspruch nach nicht durch eine Addition von Fachaspekten gewonnen werden sollen. Die einzelnen Vertreter der Fachwissenschaft und Fachdidaktik können sich zudem nicht gleichsam selbst in ihrer Sichtweise auslöschen und eine Metawissenschaft durch Zusammensitzen begründen. Aber nicht nur die Frage nach der Formulierungsinstanz ist ungeklärt. Die Frage nach der Analyseinstanz ist es ebenfalls. Lernziele im Bereich der politischen Bildung müssen aus einer Analyse gesellschaftlicher Wirklichkeit hervorgehen. Wer unternimmt diese Analyse, mit welchen Methoden und welchen Instrumenten, wenn eine fachneutrale Methode nicht existiert? Der Versuch, diese Aufgabe der Erziehungswissenschaft zuzuweisen, greift ebenfalls zu kurz, da die Pädagogik [/S. 362:] zur gesellschaftlichen Analyse gegenwärtiger Wirklichkeit wegen der Existenz irreduzibler "gesellschaftlicher Sachverhalte" (27) nicht gerüstet ist. Das Korrelat zur Annahme einer allgemeinen Formulierungs- und Analyseinstanz ist das Attribut "allgemein" der Lernziele. "Allgemein" wird in der Lernzieldiskussion auf zwei unterschiedliche Weisen gebraucht. Einmal als "vorwissenschaftlich" und zum anderen im Sinne von "überfachlich". "Allgemein" im Sinne von "überfachlich" meint, daß der Zusammenhang der Ziele unterschiedlicher Ebenen allgemein-fachspezifisch lautet. Es wird dabei übersehen, daß "allgemein" nur im Sinne von "abstrakt" verstanden werden kann. Der Zielzusammenhang verknüpft die Ebenen "abstrakt" und "konkret" und spielt sich innerhalb des Fachaspekts ab. "Vorfachlich" und "vorwissenschaftlich" meint, daß man umgangssprachlich, gewissermaßen nur (!) mit dem "gesunden Menschenverstand" bei Ausblendung fachspezifischer Frageweisen und fachspezifischer Begrifflichkeit, die immer spezielle Theorien implizieren, Ziele für die politische Bildung formulieren kann. Die in der Umgangssprache enthaltenen Sichtweisen werden übersehen. Die wissenschaftstheoretische Diskussion weist gegenwärtig ausdrücklich auf die Theorieabhängigkeit der Beobachtungssprache hin. Diese Erkenntnis ist in der Lernzieldebatte noch nicht rezipiert worden. Alle bisher angebotenen Systeme allgemeiner Lernziele sind logisch, grammatikalisch und semantisch eine Addition fachspezifischer Begriffe und Theorien, die in ihrer jeweiligen spezifischen Zusammensetzung sowohl Integration verhindern als auch durch ihre Komplexität die unterrichtspraktische Handhabung erschweren (28). Eine sprachanalytische Untersuchung der allgemeinen Lernziele der hessischen Rahmenrichtlinien für Gesellschaftslehre zeigt (29), daß sie keineswegs "allgemein", d. h. überfachlich sind. Die einzelnen fachspezifischen Aspekte lassen sich ohne Schwierigkeiten ausmachen. Eine Aufschlüsselung nach Häufigkeit ergibt folgendes Bild: [/S. 363:]| Lernfeld | ||||||
| Aspekte | I | II | III | IV | Ges. | |
| 1. | Soziologie | .08 | .06 | .04 | .03 | .21 |
| 2. | Historie | .02 | .03 | .04 | .04 | .13 |
| 3. | Politik | .03 | .08 | .15 | .11 | .37 |
| 4. | Geographie | .01 | .03 | .00 | .02 | .07 |
| 5. | Psychologie | .01 | .00 | .00 | .00 | .01 |
| 6. | Ökonomie | .00 | .16 | .01 | .03 | .21 |
| 7. | Sonst. | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 |
| Gesamt | .15 | .36 | .25 | .25 | 1.00 | |
(Annäherungswerte durch Abrundung)
Die allgemeinen Lernziele benutzen mit bestimmten Fachtermini stets bestimmte fachspezifische Theorien und stellen damit bereits bestimmte Relationen in der Wirklichkeit her (Rolle, Autoritätsfixierung, Triebsublimierung, Schicht, Klasse, öffentliche Armut - privater Reichtum). Die linguistische Analyse legt zudem auch die Zeitreferenz der Lernzielformulierungen dar: In den Tempusmorphemen wird auf öffentliche Zeit Bezug genommen (30). Zeitreferenz ist mit den Formen der Sprache gegeben und erzeugt mit und in der Sprache jene Narrativität, die die Geschichtswissenschaft zu ihrem Metier gemacht hat. Weder in der Wahl der Termini noch in der Sprachstruktur entrinnen die Lernzielformulierungen den fachspezifischen Denkweisen. Die Begriffe, obwohl sie "nichts anderes sein wollen als die Abbreviaturen je vorfindlicher Tatsachen" (31), sowie die ~h den Morphemen der Sprache implizierte Zeitreferenz verkünden auch dann noch ihre Fachlichkeit, wenn deren Benutzer nicht wissen will, was er tut. So bleibt in den allgemeinen Lernzielen unweigerlich, wenn auch ihren Verfassern nicht bewußt, die epistemologische Struktur der Wissenschaften präsent. [/S. 364:]
3.3 Lernfelder
Der Vorschlag der Curriculumtheorie, von Lebenssituationen oder Lernfeldern auszugehen, birgt für die ungelöste Integrationsproblematik noch ungenutzte Möglichkeiten, da sich hier für die einzelnen Fächer gemeinsame Bezugsrahmen anbieten. In der didaktischen Literatur ist dieser Ansatz aber bisher in einer Weise aufgegriffen worden, die die unauflösbaren Zusammenhänge von Lernfeldern und Wissenschaftsdisziplinen vernachlässigte. Der Begriff des "Lernfeldes" beinhaltet, daß die Anordnung der Unterrichtsinhalte nicht nach den in den Fächern dominierenden Darstellungsweisen und -formen erfolgt, sondern nach denjenigen Feldern, "wo und wie Schüler Gesellschaft erfahren" (32). Die Unterrichtsinhalte sollen aus der Systematik und Anordnungsweise der einzelnen Unterrichtsfächer herausgelöst und in "Lebenssituationen" angeordnet werden. Aber auch hier haben die vorliegenden Lernzielentwürfe die Rechnung ohne die Fachdisziplinen gemacht. In den einzelnen Lernfeldern der hessischen Rahmenrichtlinien (Sozialisation, Öffentliche Aufgaben, Wirtschaft, intergesellschaftliche Konflikte) sind die einzelnen Fachdisziplinen unterschiedlich stark vertreten (33). Die Lernziele, die diese Lernfelder konkretisierend umschreiben sollen, spiegeln Terminologie und Fragestellung der Fachdisziplinen in einer bestimmten gewichteten Weise wider. Im Lernfeld "Sozialisation" dominiert die Soziologie. 53 % aller soziologischen Begriffe, Theoreme und Fragestellungen befinden sich in diesem Lernfeld. Entsprechendes ist in den anderen Lernfeldern zu finden. Im Lernfeld "Wirtschaft" dominiert die Ökonomie, im Lernfeld "Öffentliche Aufgaben" die Politologie und im Lernfeld "Intergesellschaftliche Konflikte" ebenfalls die Politologie. Der Assoziationszusammenhang, der sich bei den Verfassern der Richtlinien zwischen Lernfeld und Disziplin einstellt, ist offensichtlich. Das belegt die Auffächerung der Fachaspekte nach Lernfeldern: [/S. 365:]
| Lernfeld | ||||||
| Aspekte | I | II | III | IV | Ges. | |
| 1. | Soziologie | .53 | .15 | .16 | .14 | .21 |
| 2. | Historie | .14 | .07 | .17 | .17 | .13 |
| 3. | Politik | .19 | .23 | .60 | .45 | .37 |
| 4. | Geographie | .08 | .08 | .02 | .09 | .07 |
| 5. | Psychologie | .06 | .00 | .00 | .02 | .01 |
| 6. | Ökonomie | .00 | .45 | .05 | .13 | .21 |
| 7. | Sonst. | .00 | .01 | .00 | .02 | .01 |
| Gesamt | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
(Annäherungswerte durch Abrundung)
Nicht nur innerhalb der Lernfelder schlägt die Fachlichkeit wieder durch. Die Lernfelder selbst sind weitgehend disziplinär erzeugt. Die Lernfelder, die bisher vorgeschlagen wurden, sind keineswegs disziplinlose Wirklichkeitsbereiche, obwohl sie es dem Anspruch nach sein sollten, sondern sie sind selbst Wissenschaftsdisziplinen. Sozialisation z. B. ist weniger ein Lernfeld, als eine sich gegenwärtig durchsetzende Forschungsrichtung, die alle Chancen hat, sich als Disziplin dauerhaft zu institutionalisieren. Ebenso sind die "Intergesellschaftlichen Konflikte" kein disziplinfreies Lernfeld, sondern eine sich aus der Politologie aussondernde Teildisziplin. Internationale Beziehungen sind "heute zum Erkenntnisgegenstand einer weitgehend anerkannten wissenschaftlichen Disziplin geworden" (34). Diese Befunde legen den Schluß nahe, daß die Konzeption von Lernfeldern nicht so sehr auf dem Versuch einer Integration von Fachdisziplinen beruht, sondern sich von der Zielsetzung leiten läßt, in den Unterricht neue, modernere disziplinäre Frageweisen einzubeziehen. Die vorgestellten Lernzielraster ergeben sich folglich nicht aus einer Integration der traditionellen Fächer durch disziplinfreie Lernfelder. Das Design der neuen Lernfelder resultiert vielmehr [/S. 366:] daraus, daß die Ergebnisbestände der klassischen Fächer, Erdkunde, Geschichte und Sozialkunde mit den Fragestellungen von neueren Disziplinen (z. B. Sozialisationsforschung und Internationale Beziehungen) analysiert werden, um ihnen andere Akzentuierungen abzugewinnen. Dadurch werden den traditionellen Wissensbeständen zweifellos neue Erkenntnisse abgewonnen; den disziplinär gebundenen Sichtweisen kann aber auch so nicht entgangen werden.
4. Integration durch Eigenständigkeit
Der Entwurf eines schlüssigen Integrationskonzeptes wird nur gelingen, wenn die Auswahlfrage gleichzeitig mitthematisiert wird. Ein Denken vom Output des Forschungsprozesses her, das fertige disziplinäre Inhaltssysteme zusammenzufassen sucht; erweist immer mehr seine Unzulänglichkeit. Da nun, wie ich aufzuzeigen hoffte, Wissenschaft um Wissenschaft zu sein, sich nicht notwendigerweise auf separate Gegenstände richten muß (separat von den anderen Wissenschaften wie von der Lebenspraxis), spricht kein Argument dagegen, daß sich die einzelnen Wissenschaften und Unterrichtsfächer mit ihren eigenständigen Frageweisen nicht auf die gleichen gesellschaftlichen Probleme der Gegenwart richten können. Für das Fach Geschichte bedeutet das allerdings die didaktische Abkehr von traditionellen fachwissenschaftlichen Forschungsprioritäten. Ein didaktisches Konzept für Integration wird sich auf die drei Elemente "Problem", "Frage" und "Gegenwart" stützen müssen.
4.1 Problem und Problemzusammenhang
Unter einem "Problem" ist ein Ereignis zu verstehen, das in Widerspruch zur Erwartung tritt. Erst dadurch, daß ein Ereignis einer sozialen Norm widerspricht, eine Erwartung enttäuscht oder eine erwartete Regelmäßigkeit durchbricht, wird aus diesem Ereignis ein Problem. Die Existenz eines Systems von normativen Erwartungen gibt den Hintergrund ab, auf dem ein Ereignis zu einem Problem werden kann - vor dem ein Ereignis fragwürdig wird. Das Auftauchen von Problemen ist deshalb an Voraussetzungen gebunden: [/S. 367:] Erwartungen, Normen, Soll-Werte, Regelmäßigkeiten, Vorstellungen vom "guten Leben" etc. Obwohl einerseits die Probleme von Erwartungen abhängen und andererseits ein für alle gemeinsamer Erwartungsrahmen nicht existiert (er könnte nur gewaltsam hergestellt werden), ist durch die auf das Problem gerichteten Lösungsstrategien eine Konsensfähigkeit in der Problembenennung gegeben. Die Voraussetzung für einen möglichen Konsens im Prozeß der Problembenennung ist die Tatsache, daß Probleme Problemlösungen erfordern. Geht man von zwei unterschiedlichen Erwartungsrahmen aus, so kann ein bestimmtes Ereignis in einem dieser Rahmen als "normal" und im anderen Rahmen als "problematisch" gelten. Innerhalb des Erwartungsrahmens, in dem das Ereignis ein Problem darstellt, werden Lösungsvorschläge gemacht, die den Widerspruch zwischen Erwartung und eingetretenem Ereignis aufheben sollen. Diese Lösungsstrategie wird für den anderen Bezugsrahmen zum Problem, da sie die "Normalität" des Ereignisses in Frage stellt. Der Lösungsvorschlag stellt für den zweiten Erwartungsrahmen ein Ereignis dar, das seinen Erwartungen zuwiderläuft. Für den einen Erwartungsrahmen stellt das Ereignis ein Problem dar, für den anderen wird das Ereignis des Lösungsvorschlages zum Problem. Beide Bezugsrahmen könnten sich darüber verständigen, daß die Konstellation von Ereignis und Lösungsvorschlag für beide ein Problem darstellt: Das Verfahren des freien Zuganges für jeden zu öffentlichen Ämtern wurde in dem Moment für Vertreter der staatlichen Administration zum Problem, als aktuelle Einstellung und bisherige Lebensgeschichte der Bewerber nicht mehr ihren Erwartungen entsprachen. Ihre Lösungsstrategie bestand aus "Einstellungs"gesprächen und faktischen Berufsverboten. Für weite Teile der demokratischen und liberalen Öffentlichkeit ist dieses Vorgehen eine nicht mit den demokratischen Grundsätzen zu vereinbarende Praxis. Dieser Ereigniskomplex, für den sich (auch international) der Begriff "Berufsverbot" eingebürgert hat, stellt sowohl für den Befürworter wie für den Gegner dieser Praxis ein Problem dar. [/S. 368:] Mit der Benennung von Problemen als Ausgangspunkt didaktischen Handelns ist keineswegs eine bestimmte Problemlösung verbunden. Das Problem erlaubt uns aber, Fragen zu stellen - disziplinäre wie auch praktische, nach Handlungsanweisung suchende Fragen. Die unterschiedlichen Antworten geben die Wissenschaften sowie die an dem Problem beteiligt Handelnden. Multidisziplinarität und Multiperspektivität haben hier - nach der Problembenennung - ihre methodische Berechtigung. Das Problem als gesellschaftlich-praktische Angelegenheit motiviert uns, Fragen zu stellen. Wenn ein Ereigniskomplex intersubjektiv als Problem benannt ist, nimmt das Problem einen anderen Status an. Es wird zu einem Denkobjekt. Dieser Statuswechsel ist für die Dialektik von Theorie und Praxis, für den Zusammenhang von praktischem Handeln und fachspezifischen Denkweisen von Bedeutung. Insofern muß es genauer heißen: Gesellschaftlich-praktische Probleme werden durch die intersubjektiv gestellten Fragen der Forschenden zu einem theoretischen Problem. Das gesellschaftlich-praktische Problem kann unmittelbar praktisch gelöst oder zu lösen versucht werden. Es kann aber auch im Praxisvollzug innegehalten und das praktische Problem in den Reflexionshorizont der Handelnden gehoben werden. Das Handeln wird aufgeschoben, und es wird nachgedacht. Das praktische Problem ist damit zu einem Denkobjekt geworden, zu einem theoretischen Problem, das theoretisch-intellektuell bewältigt werden muß, ehe wieder gehandelt wird. Ohne Reflexion wird Praxis hilfloses Probieren, und ohne Praxis bleibt Reflexion abstrakte Neugier. Gesellschaftlich-praktische Probleme fallen nicht in die Kompetenz einer einzigen Disziplin. "[S]ie dürfen nicht zur Domäne einer Wissenschaft ... werden" (35). Indem das praktische in ein theoretisches Problem übergeführt wird, treten die Wissenschaften hinzu, da Probleme durch die Konstitutionsleistungen der fachspezifischen Fragestellungen zu Denkobjekten werden. Praktische Probleme sind ungefächert; theoretische Probleme sind disziplinär gebunden, d. h. disziplinär konstituiert und mit disziplinären Methoden bearbeitbar. Nichtdisziplinäre Realität kann nur fachdifferenzierend analysiert werden. [/S. 369:] Wenn praktische Probleme über den Weg des Denkobjektes disziplinär bearbeitet werden, könnte durch die Selbstorientierung der einzelnen Didaktiken der politischen Bildung auf gegenwärtige Probleme ein fruchtbarer Ansatz zur Integration gemacht und die Perspektive für ein integriertes Curriculum eröffnet werden. Durch die Verständigung der Vertreter der Fachdidaktiken über die gegenwärtigen praktisch-politischen Probleme, ihre Auflistung und ihre Anordnung nach didaktischer Dringlichkeit und zeitlich-methodischer Abfolge wäre der erste Schritt für eine Integration gegeben. Die einzelnen Disziplinen, vertreten durch Hochschuldidaktiker und Fachlehrer - denn diese Art der Kooperation ist auf jeder Ebene möglich -‚ müßten angeben können, ob und was sie zu diesen Problemen zu fragen und zu sagen hätten und welchen Stellenwert das Gesagte in ihrer Wissenschaft hat. Daß dieses Vorgehen Erfolg verspricht, belegen die interessanten Beiträge, die die Geographiedidaktik in letzter Zeit zu den gegenwärtigen praktisch-gesellschaftlichen Problemen erbringt. Umweltbelastung durch Kernkraftwerke, Strukturveränderung von Dorfkernen durch Gastarbeiter, Zechensanierungen im Ruhrgebiet, Veränderung der Kulturlandschaft durch die industrielle Revolution, Planungsfragen, Einfluß von Raumbedingungen auf die Sozialisation sind einige der Themen (36). Dagegen wirken die curricularen Vorschläge der Didaktik der Geschichte noch etwas betulich. Es werden häufig nur die modern arrangierten traditionellen Themen angeboten. Würde das oft zitierte Postulat, die Geschichte nach Maßgabe des Möglichen (!) gegen den Strich zu bürsten, realisiert, kämen andere Schwerpunkte in den Blick: Einführung neuer Technologien und Gutachterprognosen am Beispiel Eisenbahnbau, Polen als "Gastarbeiter" im Ruhrgebiet des 19. Jahrhunderts, Bau von Zechenkolonien und Anwerbepraxis, die Rationalisierungsbewegung in der Weimarer Zeit, ökonomische und politische Macht - das Beispiel Fugger, Jugendarbeitslosigkeit in den 30er Jahren, Terrorismus und politischer Mord, Formen des sozialen Protestes (37), "Frauenunterdrückung und Frauenbefreiung bei den Römern" (38). Die Didaktik der Geschichte würde sich auf diese Weise [/S. 370:] explizit an der Gegenwartsbezogenheit orientieren anstatt an traditionellen - inzwischen aber auch nicht mehr unangefochtenen - fachwissenschaftlichen Forschungsprioritäten.
4.2 Wissenschaft und Alltagswissen
Die Präpotenz der Fachwissenschaft und deren im doppelten Sinne isolierende Funktion in der Bestimmung von Unterrichtsinhalten hat in besonderem Maß bei didaktisch sensiblen Richtlinienverfassern und Lehrern zu einer in dieser Form nicht haltbaren Abwendung von den Wissenschaften geführt. Die diffizilen Zusammenhänge von Wissenschaft und Alltagswissen wurden nicht beachtet - oder nur unter dem Aspekt einer Manipulation des Alltagswissens durch die Wissenschaften gesehen. Es soll keineswegs bestritten werden,, daß eine Korrumpierung des Alltagswissens durch die Wissenschaften erfolgen kann und auch erfolgt. Darüber dürfen aber nicht die weiteren Aspekte des Zusammenhangs übersehen werden. Wissenschaft hat sich historisch aus Alltagswissen und Alltagsproblemen entwickelt. Ihre Denk- und Argumentationsweise ist allerdings rationaler und methodischer, da sie sich besserer Beobachtungstechniken und stringenterer Argumentationsweisen bedient. Trotz aller vorhandener esoterischer Forschung ist Wissenschaft auch gegenwärtig die rational-methodische Fortsetzung des Alltagsverständnisses. Fragen nach Genese und Wirkung, Zusammenhängen, nach Ursachen und Prognosen von und über gesellschaftliche Sachverhalte werden nicht nur in den Wissenschaften gestellt. Wir müssen in der Didaktik vielmehr davon ausgehen, daß Schüler immer schon strukturell das tun, was die politische Bildung in der Schule ihnen erst beibringen will. Die Beharrlichkeit und Folgerichtigkeit der Fragen des Alltagsverständnisses zu erhöhen - das ist ein Ansatzpunkt für die Didaktik der politischen Bildung. Auch die meisten erklärungsbedürftigen Phänomene haben Wissenschaft und Alltagsverständnis gemeinsam. Wenn Wissenschaft in problematisierter Erfahrung ihren Ursprung hat, aber dann nur in spezialisiertem Vorgehen mit rationalen und höchst kom[/S. 371:]plexen Techniken Ergebnisse erbringen kann, stellt sich das Problem der Rückübersetzung der Forschungsergebnisse in eben dieses Alltagsverständnis. Es zeigt sich immer deutlicher, daß spezialisierte Kenntnisse nur unter Schwierigkeiten in die unspezialisierte Praxis umgesetzt werden können. Läßt man alles Wissenschafts-Wissen ungeordnet, ungefiltert und unkoordiniert auf das Alltagsverständnis von Nicht-Wissenschaftlern zurückwirken, so ist dieses Wissen keine Hilfe, sondern eher eine Belastung, die das Problem, das eigentlich durch dieses Wissen aufgeklärt werden sollte, noch unerkennbarer macht. Hier liegt ein zweiter Ansatzpunkt für die Didaktik. Ein weiterer - systematischer - Gesichtspunkt des Zusammenhangs von Alltagswissen und Wissenschaft bildet die Struktur und die Historizität der Alltagssprache. Thomas S. Kuhn hat auf die Theorieabhängigkeit der Beobachtungssprache hingewiesen (39). In der Beobachtungssprache, derer wir uns in der Wissenschaft wie im Alltag bedienen, sind immer schon theoretische Vorannahmen eingeschlossen, die in der Realität bestimmte Relationen herstellen. Ohne diese Theorieelemente werden diese Relationen der Realität nicht entdeckt. Nicht jedes Theorieelement ist schon immer in der Beobachtungssprache enthalten gewesen. Es wurde vielmehr zu einer bestimmten historischen Zeit in sie aufgenommen (z. B. das Naturrecht oder das Theorem von der nivellierten Mittelstandsgesellschaft). Das Eindringen neuer Theorieelemente in die Beobachtungssprache erzeugt "Wahrnehmungsverschiebungen" (40). Nach solchen "Umwandlungen des Sehbildes" (41) wirken diese Theoreme ihrerseits wieder als beharrende und resistente Momente gegen neue Sichtweisen. Der Physiker Thomas S. Kuhn hat hierin die Feststellungen der Soziologen Max Horkheimer und Erich Fromm über die historische Geform[t]heit des menschlichen Wahrnehmungsapparates bestätigt. Die in der Umgangssprache impliziten fachwissenschaftlichen Paradigmen und Theoreme sind unverzichtbar für sozialwissenschaftliche Erkenntnis. Wir besitzen in der Alltagssprache ein Wissen über Aspekte menschlichen Verhal[/S. 372:]tens, das nicht direkter sinnlicher Erfahrung zugänglich ist. Eine Intention ist z. B. kein direkt beobachtbares Element einer Handlungssequenz. Aussagen über gesellschaftliche Sachverhalte sind nur durch kommunikative und nicht (allein) durch sensorische Erfahrung möglich. Die fachwissenschaftlichen Begriffe der einzelnen Sozialwissenschaften lassen sich nicht unmittelbar durch sensorische Wahrnehmung aneignen. Sie sind nur ein Begriffsapparat, der mehr oder minder gut gehandhabt werden kann. Erst die Anwendung des Begriffs "Konflikt" auf ein Bündel menschlicher Handlungen und Äußerungen nach bestimmten Zuordnungsregeln führt zu der Erkenntnis, daß ein Konflikt vorliegt. Die Kombination von theoretischen Annahmen und "ouvertem Verhalten" (Mandelbaum) erlaubt es erst, Aussagen über gesellschaftliche Sachverhalte zu machen. Gesellschaftliche Ereignisse und Probleme sind nicht ausschließlich direkter, sondern nur theoriegeleiteter Beobachtung zugänglich. "Relative Deprivation", "Einstellungen", "Schichtung" und "Klasse" oder "Revolution" und "Feudalismus" sind in das Alltagsverständnis aufgenommene fachwissenschaftliche Begriffsbildungen. die eine bestimmte Theorie implizieren.
4.3 Fragestruktur
Probleme müssen in Fragen umgesetzt werden. Die Frage ist offen für alternative Antworten, sonst wäre sie keine Frage mehr. Sie leitet den Prozeß der Erkenntnisgewinnung ein, ohne das Ergebnis zu präjudizieren. Wenn auch die Frage selbst auf keine spezielle Antwort festgelegt ist, so richtet sie sich doch auf eine bestimmte Klasse von Antworten, in deren Rahmen eine sinnvolle Antwort möglich ist. Wenn die Beziehung zwischen Frage und Antwort in diesem Sinne offen ist, können Fragen weder wahr noch falsch sein. Diese Prädikate kommen nur den Voraussetzungen der Fragen zu; sie selbst können nur sinnvoll oder sinnlos sein. Der Zusammenhang von Fragerichtung und jener Klasse von Antworten, innerhalb deren eine sinnvolle Antwort gefunden werden kann, gibt das Begründungsprinzip einer Disziplin ab. Eine prinzipiell gleichbleibende Fragerichtung, die [/S. 373:] sich bestimmter Methoden bedient, institutionalisiert sich als Wissenschaft. Die Fragerichtung ist deshalb als die "kognitive Ausdrucksform unseres jeweiligen Interesses an der Welt" (42) anzusehen. Die Frage ist ihrer Struktur nach durch Offenheit und Informationsbedürfnis gekennzeichnet. Ihr Wesen ist "das Offenlegen und Offenhalten von Möglichkeiten" (43). Linguistisch gewendet heißt das: "Die Frage ist gegenüber der Antwort, die auf sie folgt, ein Weniger an Information, nicht etwa ein Nichts an Information" (44). Um eine Frage stellen zu können, muß man folglich immer schon etwas wissen. Diese hermeneutische Implikation erfordert als Bedingung der Möglichkeit, Fragen zu stellen, empirisches Vorwissen. Wir wissen weder alles, noch sind wir unseres Wissens gewiß. Wir stellen Fragen, wenn wir uns eines Sachverhalts nicht sicher sind. Insofern ist eine Frage immer auch Zeichen mangelnder Gewißheit. Die Fähigkeit, Fragen zu stellen, ist nicht vorgegeben, sondern muß gelernt werden. Entsprechend den unterschiedlichen Fragerichtungen und den verschiedenen Fragestellungen sind es jeweils andere Sozialisationskontexte, in denen die Fähigkeit, Fragen zu stellen, erworben wird. Die sozialisationstheoretisch fundierte Fachdidaktik wird hier ansetzen müssen, um den Zusammenhang von Lebenspraxis und Erkenntnisweisen in einem organisierten Lernprozeß herzustellen. In den einzelnen erlernbaren Fragen sind formale und inhaltliche Kategorien enthalten (45). Die fundamentalsten wie "Zeit", "Raum" und "Quantität" (wann? wo? wieviel?) ebenso, wie die spezialisiertesten: "Gewordenheit", "Verstehbarkeit", "Rechtfertigung", "Identität" usw. Fachspezifische Fragen implizieren fachspezifische Kategorien. Eine Wissenschaft lernen heißt, ihre grundlegenden Kategorien in Form von Fragen auf die Realität anzuwenden, um sich der Aussageintention dieser Disziplin zu vergewissern. Beim Erlernen einer Wissenschaft ist es nicht von Interesse, daß der Fragende überhaupt eine Antwort erhält, sondern daß er eine Antwort auf seine spezifische Frage erhält. "Zu fragen verstehen heißt verstehen lernen, was zugehörige von unzugehörigen Antworten unterscheidet" (46). [/S. 374:] Die hier vorgenommene Betonung des Fragecharakters von Wissenschaft und Alltagswissen ist nicht allein für eine Theorie der Didaktik der politischen Bildung von Interesse, sondern hat eminente praktische Konsequenzen für die Unterrichtspraxis wie für die Konzeption von Schulbüchern: Das Erlernen von kategoriengesättigten Fragen ist die Voraussetzung für prozeßorientierten und schülerzentrierten Unterricht. Der Schüler muß in die Lage versetzt werden, die unterschiedlichen Frageweisen anzuwenden: Was bedeutet die quantifizierend-statistische Argumentationsweise bei der Untersuchung des Problems "Kernenergie"? Welchen Aussagewert haben mit statistischen Methoden errechnete Sicherheitsrisikos und statistische Prognosen? Welche Erfahrungen machte man in der Vergangenheit mit der Einführung neuer Technologien? Welche Motive und Interessen begleiteten sie? Welche neuen Arbeitsplatze schufen und welche vernichteten sie? Läßt sich dieser Vorgang quantifizieren? Wie legt man eine empirische Befragung an, und wie aussagekräftig ist sie? Ist eine Antwort immer eindeutig richtig oder vielleicht auch ihr Gegenteil? Wie muß man nach standortrelevanten Faktoren fragen? ... Die dieser Unterrichtskonzeption entsprechenden Schulbücher müßten konsequent von explizit ausgewiesenen - auch im grammatikalischen und linguistischen Sinne - Fragestellungen ausgehen, um beim Schüler einen Frage-, Denk- und Untersuchungsprozeß in Gang zu bringen, an dessen Ende ein stets revisionsbedürftiger Entscheidungsakt steht. Einer solchen Konzeption widersprechen diejenigen Schulbücher und Unterrichtsmaterialien, die sich nur formal und rhetorisch der Frage bedienen. Ihr folgt dann stets die "richtige" Antwort in Form eines "Merke". Die subtilere Variante dieser entmündigenden und affirmativen Konzeption versteckt den Merksatz im Lehrerbegleitheft. Alternativ dazu steht der um Erkenntnisweisen zentrierte Ansatz: Im selbstbestimmten und selbstbewußten Umgehen mit fachspezifischen Frageweisen und Methoden können Schüler ungefächerte gesellschaftlich-praktische Probleme in ein je eigenes Problembewußtsein umsetzen. [/S. 375:]
5. Kooperation, Integration, Eigenständigkeit
Kooperation, Integration und Eigenständigkeit sind nach der öffentlichen Diskussion der letzten Jahre als analytische Kriterien soweit abgeschliffen, daß sie zu partei- und standespolitischen Kampfbegriffen geworden sind. Sie bezeichnen aber nicht die unterschiedlich starke Verschmelzung von Fächern, sondern sie beziehen sich auf verschiedene Ebenen. Kooperation ist die Zusammenarbeit unterschiedlicher Personen. Es arbeiten Träger verschiedener Berufsrollen zusammen, die ihre Rollen in unterschiedlichen Sozialisationskontexten und Sozialisationsprozessen erworben haben. Diese Sozialisationskontexte (= Wissenschaften) beruhen weithin auf einer organisatorischen Abschottung voneinander. Die gelungene Berufsrolle ist gerade dadurch definiert, daß man sich von den anderen Kontexten aktiv absetzt (Verbot der theoretischen "Spekulation" in der Geschichtswissenschaft, Warnung vor "Soziologisierung", Verbot des hermeneutischen Verfahrens in den empiristischen Disziplinen etc.). Unabhängig davon, ob man die gerade praktizierte Arbeitsteilung für sinnvoll hält oder nicht, kommt man nicht um die Anerkennung wissenschaftlicher Arbeitsteilung überhaupt herum. Eine auf dem Verzicht der wissenschaftlichen Arbeitsteilung beruhende Integrationskonzeption muß unweigerlich wissenschaftliche Kompetenz in dilettierenden Common-sense überführen. Voraussetzung für Integration ist aber, daß verschiedene Personen unterschiedlicher wissenschaftlicher Kompetenz auf der Grundlage einer systematischen Gesellschaftsanalyse, die in der Lage ist, die verschiedenen gesellschaftlichen Probleme zu benennen, kooperieren. Im nächsten Schritt müssen dann die einzelnen Disziplinen ihren eigenständigen Frageweisen folgen können. Aus dem Gesagten ergibt sich die Abschlußthese: Die Begriffe "Kooperation", "Integration" und "Eigenständigkeit" stellen keine Alternativen oder graduellen Abstufungen dar. Die Problematiken, die diese Begriffe bezeichnen, sind [/S. 376:] auf verschiedenen Ebenen verortet: Kooperation bezeichnet das kommunizierende Zusammenarbeiten von Personen unterschiedlicher Fragerichtungen, die wissenschaftstheoretisch legitim distinkten Frageweisen setzen deren Eigenständigkeit voraus, und Integration bezieht sich auf das Problem- und Lösungswissen, das aus diesen Frageweisen, die ihre Impulse aus einer als problemhaltig begriffenen Gegenwart beziehen, resultiert.
Anmerkungen
(1) Zur besseren Darstellung der grundsätzlichen Probleme benutze ich die Begriffe "Integration" und "politische Bildung" im eingeschränkten Sinne:
- Die Frage nach der Zusammenlegung und Zusammenarbeit von Unterrichtsfächern (Integrationsproblematik) beschränke ich der besseren Übersicht wegen auf drei Fächer: Geschichte, Geographie und Sozialkunde.
- Da es eine Zweiteilung in politisch bildsame und unpolitische Fächer nicht gibt, also alle Fächer zur politischen Bildung beitragen, spreche ich, wenn nur die Fächer Geschichte, Geographie und Sozialkunde gemeint sind, von "politischer Bildung im engeren Sinne".
(2) Conze, Werner (1973), S. 16; Teppe, Karl (1976), S. 36.
(3) Schwarz, Richard (1974), S. 63.
(4) Daß Zukunft auch für die Geschichtswissenschaft eine erkenntnisleitende Kategorie ist, habe ich zusammen mit Klaus Bergmann an anderer Stelle gezeigt: Bergmann, Klaus; Pandel, Hans-Jürgen (1975).
(5) Fitterling, Dieter (1973), S. 223 ("Anmerkungen und Argumente" Bd. 6) [/S. 377:].
(6) Habermas, Jürgen (1976); Eder, Klaus (1976); Messelken, Karlheinz (1977).
(7) Waldmann, Peter (1971); Luhmann, Niklas (1973); Revers, Wilhelm Josef (1964); Barndt, Robert J. and Johnson, Donald M. (1955).
(8) Das Problem des scheinbar paradoxen Zusammentreffens von falschem Selbstverständnis und richtiger praktischer Verfahrensweise bei manchen Wissenschaftlern kann hier nicht erörtert werden.
(9) Koselleck, Reinhart (1972), S. 13
(10) Schaefer, Fred K. (1970), S. 52.
(11) Bartels, Dietrich (1970), S. 34.
(12) Hofmann, Werner (1969), S. 50.
(13) Lucas, Friedrich J. (1972a), S. 157.
(14) Himmerich, Wilhelm (1970), S. 78 ff.
(15) Pöppel, Karl-Gerhard (1976), S. 183.
(16) Holtmann scheint diesen Ansatz zu verfolgen, vgl.: Holtmann, Antonius (1977)
(17) Koppe, Franz (1976), S. 259.
(18) Oelkers, Jürgen; Riemer, Holger-Jens (1974), S. 90.
(19) Habermas, Jürgen (1973), Nachwort S. 378.
(20) Die Substratfrage, welche Realität den Ergebnissen geistiger Operationen zukommt, kann in diesem Rahmen leider nicht diskutiert werden.
(21) Lucas, Friedrich J. (1965a)
(22) Lucas, Friedrich J. (1972b), S. 226.
(23) ebenda
(24) Lucas, Friedrich J. (1965b), S. 285.
(25) vgl. dazu: Rüsen, Jörn (1976) und Koselleck, Reinhart; Mommsen, Wolfgang J.; Rüsen, Jörn (1977).
(26) Pandel, Hans-Jürgen (1975).
(27) Mandelbaum, Maurice (1975).
(28) In den allgemeinen Lernzielen lassen sich bis zu 4 fachspezifische Elemente feststellen.
(29) Diese Ergebnisse sind kein Spezifikum der Hessischen Rahmenrichtlinien Gesellschaftslehre. Die gleichen Befunde lassen sich bei der Analyse des "Grundkurses" von Rheinland-Pfalz feststellen.
(30) Wunderlich, Dieter (1970).
(31) Adorno, Theodor W. (1969), (Sammlung Luchterhand 1972), S. 39.
(32) Der Hessische Kultusminister (1973), S. 18. [/S. 379:]
(33) Dieser Tatbestand wird von den Verfassern der Richtlinien selbst angemerkt.
(34) Krippendorff, Ekkehard (1977), S. 27.
(35) Hentig, Hartmut von (1971), S. 861.
(36) Die Zusammenstellung der Themen erfolgte nach der Zeitschrift Geographische Rundschau.
(37) Thema von Heft 2, 3. Jg., 1977, der Zeitschrift Geschichte und Gesellschaft. Die Themen der Beiträge dieser Zeitschrift lesen sich häufig wie eine Auflistung didaktisch relevanter gesellschaftlicher Probleme.
(38) Zum Problem "Frauenbefreiung" hat Bodo von Borries jetzt einen Aufsatz vorgelegt, der genau in die von mir avisierte Richtung weist. Hier wird deutlich, wie der durch Gegenwartsprobleme und disziplinäre Gebundenheit erzeugte Zusammenhang geradezu eine Ergänzung durch andere Disziplinen herausfordert: Borries, Bodo von (1977).
(39) Vgl. dazu: Kuhn, Thomas S. (1967).
(40) ebenda, S. 154.
(41) ebenda, S. 152.
(42) Beier, Christel (1976), S. 137.
(43) Gadamer, Hans-Georg (1960), S. 283.
(44) Weinrich, Harald (1966), S. 54.
(45) Zur Kategorienfrage vgl.: Mayer, Ulrich; Pandel, Hans-Jürgen (1976).
(46) Lorenz, Kuno (1970), S. 14.
Literatur
Adorno, Theodor W. (1969): Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Neuwied. (Sammlung Luchterhand 1972)
Barndt, Robert J.; Johnson, Donald M. (1955): Time orientation in delinquents. In: The Journal of Abnormal and Social Psychology, Vol. 51, 343-345.
Bartels, Dietrich, Hg. (1970): Wirtschafts- und Sozialgeographie, Köln-Berlin.
Beier, Christel (1976): Zur Struktur des Totalitätsbegriffes in der kritischen Theorie Adornos. In: Ritsert, Jürgen, Hg. Zur Wissenschaftslogik einer kritischen Soziologie, Frankfurt/M.
Bergmann, Klaus; Pandel, Hans-Jürgen (1975): Geschichte und Zukunft. Didaktische Reflexionen über veröffentlichtes Geschichtsbewußtsein, Frankfurt/M.
Borries, Bodo von (1977): Frauenunterdrückung und Frauenbefreiung bei den Römern (1). In: Westermanns Pädagogische Beiträge 29, H. 10, 419-427.
Conze, Werner (1973): Die Bedeutung der Sozialgeschichte für die politische Bildung. In: Historischer Unterricht im Lernfeld Politik. Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung. Heft 96, Bonn, 21-25.
Eder, Klaus (1976): Die Entstehung staatlich organisierter Klassengesellschaften, Frankfurt/M.
Fitterling, Dieter (1973): Geschichte und gesellschaftswissenschaftlicher Unterricht. In: Ackermann, Paul , Hg. Curriculumrevision im sozialwissenschaftlichen Bereich der Schule, Stuttgart ("Anmerkungen und Argumente" Bd. 6).
Gadamer, Hans-Georg (1960): Wahrheit und Methode, Tübingen.
Habermas, Jürgen (1973): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt/M.
Habermas, Jürgen (1976): Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, Frankfurt/M.
Hentig, Hartmut von (1971): Interdisziplinarität, Wissenschaftsdidaktik, Wissenschaftspropädeutik. In: Merkur 25 (1971), H. 9.
Der Hessische Kultusminister, Hg. (1973): Rahmenrichtlinien Sekundarstufe 1. Gesellschaftslehre, Frankfurt/M.
Himmerich, Wilhelm (1970): Didaktik als Erziehungswissenschaft, Frankfurt/M.
Hofmann, Werner (1969): Wissenschaft und Ideologie. In: Hofmann, Werner. Universität, Ideologie, Gesellschaft, 4. Aufl., Frankfurt/M. 1969.
Holtmann, Antonius (1977): Thesen zu einem Versuch, politisches Lernen sozialisationstheoretisch zu begründen, wissenschaftstheoretisch zu legitimieren und methodologisch zu organisieren. In: Fischer, Kurt Gerhard, Hg. Zum aktuellen Stand der Theorie und Didaktik der Politischen Bildung, Stuttgart, 63-74.
Koppe, Franz (1976): Die historisch-hermeneutischen Disziplinen im System der Wissenschaften. In: Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie VII/2.
Koselleck, Reinhart (1972): Über die Theoriebedürftigkeit der Geschichtswissenschaft. In: Conze, Werner, Hg. Theorie der Geschichtswissenschaft und Praxis des Geschichtsunterrichts, Stuttgart.
Koselleck, Reinhart; Mommsen, Wolfgang J.; Rüsen, Jörn, Hg. (1977): Objektivität und Parteilichkeit. München.
Krippendorff, Ekkehard (1977): Internationale Beziehungen als Wissenschaft, Frankfurt/M.
Kuhn, Thomas S. (1967): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Frankfurt/M.
Lorenz, Kuno (1970): Elemente der Sprachkritik, Frankfurt/M..
Lucas, Friedrich J. (1965a): Das St[u]dium an der Justus-Liebig-Universität Gießen, Gießen.
Lucas, Friedrich J. (1965b): Zur Geschichts-Darstellung im Unterricht. In: GWU 16, H.5.
Lucas, Friedrich J. (1972a): Der Beitrag des Geschichtsunterrichts zur politischen Bildung. In: Süssmuth, Hans, Hg. Geschichtsunterricht ohne Zukunft? Stuttgart ("Anmerkungen und Argumente" Bd. 1.2).
Lucas, Friedrich J. (1972b): Der Bildungssinn von Geschichte und Zeitgeschichte. in Schule und Erwachsenenbildung. In: Süssmuth, Hans, Hg. Geschichtsunterricht ohne Zukunft? Stuttgart ("Anmerkungen und Argumente" Bd. 1.2).
Luhmann, Niklas (1973): Weltzeit und Systemgeschichte. Über die Beziehungen zwischen Zeithorizonten und sozialen Strukturen gesellschaftlicher Systeme. In: Ludz, Peter Christian, Hg. Soziologie und Sozialgeschichte, Opladen.
Mandelbaum, Maurice (1975): Gesellschaftliche Sachverhalte., In: Giesen, Bernhard; Schmid, Michael, Hg. Theorie, Handeln und Geschichte, Hamburg, 217-229.
Mayer, Ulrich; Pandel, Hans-Jürgen (1976): Kategorien der Geschichtsdidaktik und Praxis der Unterrichtsanalyse. Stuttgart.
Messelken, Karlheinz (1977): Zur Durchsetzung des Christentums in der Antike. Strukturell-funktionale Analyse eines historischen Gegenstandes. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 29, H. 2, 261-294.
Oelkers, Jürgen; Riemer, Holger-Jens (1974): Überlegungen zur Begründung einer kritischen Geschichtswissenschaft. In: Geiss, Imanuel; Tamchina, Rainer, Hg. Ansichten einer künftigen Geschichtswissenschaft, Bd. 1, München.
Pandel, Hans-Jürgen (1975): Gesellschaftslehre und Interdisziplinarität, 1975 (unveröffentlichtes Manuskript).
Pöppel, Karl-Gerhard (1976): Zum Verhältnis von Methode und Unterrichtsmethode. In: Vierteljahresschrift für Wissenschaftliche Pädagogik, 168-193.
Revers, Wilhelm J. (1964): Das Zeitproblem in der Psychologie. In: Archiv für die gesamte Psychologie, Bd. 116.
Rüsen, Jörn (1976): Für eine erneuerte Historik, Stuttgart-Bad Cannstatt.
Schaefer, Fred K. (1970): Exzeptionalismus in der Geographie. In: Bartels, Dietrich, Hg. Wirtschafts- und Sozialgeographie, Köln/Berlin.
Schwarz, Richard (1974): Interdisziplinarität der Wissenschaft als Problem und Aufgabe heute. In: Schwarz, Richard, Hg. Internationales Jahrbuch für interdisziplinäre Forschung, Bd. 1 (Wissenschaft als interdisziplinäres Problem. Teil 1). Berlin, 1-131.
Teppe, Karl (1976): Das deutsche Identitätsproblem. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 20-21/76 vom 22.5.1976.
Waldmann, Peter (1971): Zeit und Wandel als Grundbestandteile sozialer Systeme. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 23, 687-703.
Weinrich, Harald (1966): Linguistik der Lüge, Heidelberg.
Wunderlich, Dieter (1970): Tempus und Zeitreferenz, München.
Hinzufügung des Literaturverzeichnis sowie entsprechende redaktionelle Anpassungen der Anmerkungen durch sowi-online.
Beiträge 1980-1989
Bergmann, Klaus (1988): Gesellschaftslehre – aus der Sicht des Geschichtsunterrichts
Niemand wird es einem Geschichtsdidaktiker verdenken, wenn er auch historisch denkt, wenngleich seine eigentliche Betätigung das systematische Nachdenken über historisches Lernen und die Bildung von Geschichtsbewusstsein ist. Ich muss noch einmal zurück zur Ausgangsposition den kulturkampfähnlichen Auseinandersetzungen, die 1972 mit der ersten Vorlage der HRRL GL aufgebrochen sind. Wenige Begriffe haben damals die Gemüter der Gegner der RRL mehr bewegt und erregt als der des Gegenwartsbezuges der Geschichte.
Es ginge offenkundig darum, so die Gegner wörtlich, "die historische Bildung auf das Bereitstellen von Argumenten für gesellschaftliche Probleme der Gegenwart einzuschränken". Dies entspreche – so wörtlich – "totalitärem Denken". Um so mehr müsse – so wörtlich – "darauf hingewiesen werden, dass es eine typische Methode politischer Diktatursysteme ist, die Geschichtsbetrachtung auf das Herauspräparieren von historischen Belegstücken zu beschränken, die zur Untermauerung der eigenen Legende oder Weltanschauung dienen" (1).
Geschichte werde dadurch – so wörtlich – "zum Belegmaterial für Gegenwartsbezüge denaturiert" (2).
Oder die Geschichte – so wörtlich – "wird ebenso wie die Geographie zu einem Steinbruch der politischen Argumentation, aus dem man sich je nach Bedarf Belege für die eigene Gegenwartsdeutung holt" (3).
Es steht zu erwarten, besser: zu hoffen, dass die Verfasser solcher Vorwürfe heute anders über diesen zentralen Begriff der Geschichtstheorie und der Geschichtsdidaktik denken. An diesem Begriff kommt niemand, der über Geschichtsunterricht und über den Beitrag des Geschichtsunterrichts zur historisch politischen Bildung nachdenkt, vorbei. Und es kommt nach der intensiven erkenntnistheoretischen und geschichtsdidaktischen Diskussion, die in den letzten Jahren geführt worden ist, niemand daran vorbei, differenzierter die in diesem Begriff enthaltenen Implikationen und Konsequenzen zu sehen und zu beurteilen, als das 1972 und in den folgenden Jahren zum Zwecke politischer Argumentation und Agitation geschehen ist.
Ich stelle diesen Begriff, diese geschichtstheoretische und geschichtsdidaktische Kategorie in den Mittelpunkt meiner Überlegungen. Sie ist der Schlüsselbegriff, der eine geschichtsdidaktische Antwort auf die Frage nach der Vereinbarkeit der Selbständigkeit der Fächer mit der Forderung nach fächerübergreifendem Unterricht allererst ermöglicht.
- Ich werde diese Kategorie in einem ersten Teil aus geschichtstheoretischer Sicht besprechen. Geschichtstheorie ist diejenige Disziplin der Geschichtswissenschaft, die nach den Grundlagen, Voraussetzungen, Möglichkeiten historischer Erkenntnis fragt.
- In einem zweiten Teil werde ich die Kategorie Gegenwartsbezug aus der Sicht der Geschichtsdidaktik befragen. Geschichtsdidaktik ist diejenige Disziplin, die nach den Grundlagen, Voraussetzungen und Möglichkeiten von Bildungs und Selbstbildungsprozessen an und durch Geschichte fragt und sich der Frage nach der Bildung von Geschichtsbewusstsein widmet.
- Im dritten Teil werde ich mich der Frage zuwenden, welche Konsequenzen sich aus den Bestimmungen der geschichtstheoretischen und der geschichtsdidaktischen Kategorie für die historisch politische Bildung ergeben, um schließlich im
- vierten Teil Fragen zu stellen, die auf eine Zusammenarbeit der an historisch politischer Bildung beteiligten Fächer gerichtet sind.
1. Gegenwartsbezug aus geschichtstheoretischer Sicht
Geschichte ist gegenwärtiges Nachdenken über vergangenes menschliches Handeln und Leiden. Oder vielleicht deutlicher: Geschichte ist je und je gegenwärtiges Nachdenken über vergangenes menschliches Handeln und Leiden. Die Erforschung und Reflexion des Geschehenen erfolgen unter dem Einfluss von Traditionen, Gegenwartserfahrungen und Zukunftserwartungen, ja Zukunftshoffnungen. Der italienische Geschichtstheoretiker Benedetto Croce hat diesen unauflöslichen Zusammenhang wie folgt ausgedrückt: "Das praktische Bedürfnis, auf das sich jedes geschichtliche Urteil gründet, verleiht der Geschichte die Eigenschaft, "zeitgenössische Geschichte" zu sein, weil sie in Wirklichkeit – wie fern auch chronologisch die Tatsachen in der tiefsten Vergangenheit ruhen mögen – immer auf ein gegenwärtiges Bedürfnis, eine gegenwärtige Lage bezogen ist." (4)
Jakob Burckhardt hat den Zusammenhang auf die knappe Formel gebracht: "Unser Gegenstand ist diejenige Vergangenheit, welche deutlich mit Gegenwart und Zukunft zusammenhängt." (5) Ich füge erläuternd hinzu: Dieser Zusammenhang besteht nicht einfach in einem Ursachenzusammenhang.
Geschichtstheoretisch ist es schlechthin unbestreitbar, dass Geschichte als Rekonstruktion vergangenen menschlichen Handelns und Leidens erst entsteht, wenn ein gegenwärtiges zukunftsgerichtetes Interesse und Bedürfnis an Orientierung und Information vorliegt, das auf eine an erfolgversprechende Regeln gebundene Erinnerung drängt. Die wissenschaftliche Geschichte ist von solchen praktischen Interessen abhängig. Sie fallen ihr aus der sozialen Lebenswelt zu. Sie bedingen auch, dass Geschichte im Fortgang der Realgeschichte immer wieder umgeschrieben wird und werden muss.
"Dass die Weltgeschichte von Zeit zu Zeit umgeschrieben werden müsse, darüber ist in unseren Tagen wohl kein Zweifel übriggeblieben. Eine solche Notwendigkeit entsteht aber nicht etwa daher, weil viel Geschehenes nachentdeckt worden ist, sondern weil neue Ansichten gegeben werden, weil der Genosse einer fortschreitenden Zeit auf Standpunkte geführt wird, von welchen sich das Vergangene auf eine neue Weise überschauen und beurteilen lässt." (6) – So trotz des fatalen Sprachgebrauchs "Genosse" Johann Wolfgang von Goethe.
Geschichte, die aus praktischen, im Fortgang der Realgeschichte wechselnden Bedürfnissen immer neu geschrieben wird, hat für die Gesellschaft, in der sie entsteht, eine praktische Bedeutung. Ihre Ergebnisse können nicht ohne Schaden für vernunftgeleitetes Handeln übersehen und übergangen werden.
Dass Geschichte als Historie, als wissenschaftliche Geschichte gegenwärtiges, je und je gegenwärtiges Nachdenken über vergangenes menschliches Handeln und Leiden ist, ein Nachdenken, das unter dem Einfluss von Traditionen, Gegenwartserfahrungen und Zukunftserwartungen erfolgt, ist geschichtstheoretisch unstrittig, muss aber noch etwas genauer erläutert werden.
Traditionen, Gegenwartserfahrungen und Zukunftserwartungen durchdringen sich wechselseitig. Unsere Gegenwartserfahrungen werden durch Traditionen, die uns lebensgeschichtlich erreichen und prägen, mitbestimmt und durch Zukunftshoffnungen beurteilbar. Unsere Traditionen werden durch Gegenwartserfahrungen im Lichte von Gegenwartserfahrungen stets neu bedacht und auf uns bezogen, werden durch Zukunftshoffnungen kritisch gewürdigt, bestätigt oder neu erschlossen und neu sortiert; und unsere Zukunftserwartungen werden durch Traditionen, auf die wir uns beziehen, z.B. demokratische Traditionen, wie sie einmal Gustav Heinemann eingeklagt hat bestärkt, oder durch Traditionen, auf die andere sich beziehen, in Frage gestellt, durch Gegenwartserfahrungen enttäuscht oder als sinnvoll, vielleicht gar notwendig bestätigt.
So unterschiedliche, unterscheidbare zeitliche Dimensionen damit auch angesprochen sind, sie haben doch wieder gemeinsam, dass sie auf einer einzigen zeitlichen Ebene auftauchen und wirken: Traditionen, Gegenwartserfahrungen, Zukunftshoffnungen sind je und je Gegenwartsphänomene, die in die Orientierung und den Vollzug gesellschaftlichen Handelns in der Gegenwart eingehen und darin wirksam werden.
Sie entfalten ihre bestimmende Kraft, wenn wir in unserer Zeit – also der sogenannten Gegenwart – als Gesellschaft vor Problemen stehen. Probleme werden hier verstanden als Herausforderungen einer Gesellschaft, die innerhalb der Gesellschaft übereinstimmend gesehen, aber divergierend beurteilt werden.
Probleme werden zugleich verstanden als Herausforderungen der Gesellschaft, die wesentliche Momente des gesellschaftlichen Lebens betreffen, sie gefährden, bedrohen, in Frage stellen – nicht also bloß intime und private, bloß aktuelle (Reisepassverlängerung) und technisch oder administrative. Ich nenne ohne jede Vollständigkeit – ein brain storming unter uns würde eine Fülle weiterer Probleme ergeben:
- Umwelt
- Fortschritt (Technikfolgenabschätzung)
- Frieden und Abrüstung
- Arbeit
- Frauenbenachteiligung und -unterdrückung
- Dritte Welt
- Aids
- Demokratie in Anspruch und Wirklichkeit.
Gesellschaftliche Probleme sind gesellschaftliche Orientierungsschwierigkeiten. Dass sie übereinstimmend gesehen werden (oder vielleicht auch nur empfunden werden), ändert nichts daran, dass sie unterschiedlich beurteilt werden, und dass unterschiedliche Wege zur Lösung empfohlen werden, hängt mit gesellschaftlichen Interessengegensätzen zusammen: Unterschiedliche gesellschaftliche Standorte bedingen unterschiedliche gesellschaftliche, ökonomische, politische, kulturelle Interessen, die zugleich mit bestimmten Wertorientierungen verknüpft sind.
Gesellschaftliche Probleme verlangen oder rufen hervor: unterschiedliche Arten der Betrachtung, des Nachdenkens, der Analyse – und unter diesen eben die historische Betrachtungsweise.
Die Geschichtswissenschaft wendet sich in den Personen einzelner Geschichtswissenschaftler diesen gegenwärtigen Problemen zu – und zwar auf ihre spezifische Weise, mit der ihr als Wissenschaft eigentümlichen methodischen Rationalität der historischen Erkenntnis. Sie macht die gegenwärtigen Probleme zu ihrem Denkobjekt, das sie more historico, nach Art der Geschichte angeht. Sie ist als Fachwissenschaft eine objektiv mögliche und übliche Weise, die Wirklichkeit denkend zu betrachten, zu ordnen, zu begreifen und – aber erst sekundär – in Form je und je gegenwärtigen historischen Wissens das Ergebnis dieser Betrachtung. Sie ist eine Weise des Denkens, die bestimmte, von anderen Wissenschaften unterschiedene Fragestellungen, Aussageabsichten und Kategorien und Methoden erarbeitet hat und anwendet, Fragestellungen, Aussageabsichten, Kategorien und Methoden, die systematisch verfeinert worden sind, sich als ertragreich erwiesen haben und den Geltungsanspruch historischer Aussagen und Urteile begründen.
Die Geschichtswissenschaft produziert dabei Erkenntnisse über vergangenes menschliches Handeln und Leiden, geht aber nicht in den Wissensbeständen auf, die sie akkumuliert. Sie ist Denken über die erkennbare menschliche (und unmenschliche) Vergangenheit, das durch die Auskunftsbedürftigkeit der Gegenwart ausgelöst wird.
Diese Aussagen lassen sich an der Entwicklung der Geschichtswissenschaft, der empirischen Geschichtsforschung trefflich verfolgen, insbesondere an der sogenannten Historischen Sozialwissenschaft:
In unserer Zeit entwickelt sich die Geschichtswissenschaft zu einer problemorientierten, an gegenwärtigen Problemen orientierten, und zwar absichtsvoll orientierten und sich als solche ausweisenden Historischen Sozialwissenschaft oder – ein anderer Begriff – Gesellschaftsgeschichte. Diese Gesellschaftsgeschichte weist eine spezifische Option auf Vernunft auf. Sie versteht die ihr eigene Vernunft – die sogenannte Historische Vernunft – in zweifacher Hinsicht, und sie ist damit theoriebewusster, gesellschaftsbewusster, politikbewusster, als sie es je in der Geschichte der Geschichtswissenschaft in Deutschland war:
- Historische Vernunft als formale Bestimmung der methodischen Rationalität, die den Forschungen der Historie zugrundeliegt und den Geltungsanspruch ihrer Aussagen begründet.
- Historische Vernunft zeigt sich überall dort als inhaltliche Bestimmung, wo das historische Denken daraufgerichtet ist, historische Prozesse und Vorgänge der Humanisierung (und ihres Scheiterns) zu erinnern, zu vergegenwärtigen und wachzuhalten. Gesellschaftsgeschichte ist nach den Worten Hans Ulrich Wehlers "Erforschung der erkennbaren menschlichen und unmenschlichen Vergangenheit unter der leitenden Hinsicht eines Interesses an emanzipatorischen Entwicklungsprozessen, an der Durchleuchtung der Widerstände gegen sie und an der Vermehrung ihrer Durchsetzungschancen" (Wehler). (7)
2. Geschichtsdidaktik und Gegenwartsbezug
Das praktische Interesse, das die Geschichtswissenschaft anleitet, gegenwärtige Probleme und damit verbundene Orientierungsbedürfnisse auf ihre Weise anzugehen, berechtigt sie dazu, verpflichtet sie dazu, ihre Forschungsergebnisse als ihre Antwort auf die Orientierungsbedürfnisse dorthin zu vermitteln, wo sie entstanden sind: in die Lebenswelt, in die Lebenspraxis der Gesellschaft.
Die Geschichtsdidaktik ist die Disziplin, die darüber nachdenkt, wie Geschichte Geschichte als Denkform und Geschichte in Form von lebensweltlich, gesellschaftlich angeregten Forschungsleistungen – in die Lebenswelt zurückvermittelt werden kann. Das "Wie" ist dabei auf den ersten Blick missverständlich. Sie fragt nach der "Orientierungsrelevanz" des Faches als Denkform; sie fragt nach der Orientierungsrelevanz historischer Forschungsergebnisse in einer Gegenwart, die von den Problemen geprägt ist, der die Geschichtswissenschaft ihre Fragen an die erkennbare menschliche (und unmenschliche) Vergangenheit entnimmt.
Die Geschichtsdidaktik fragt also – ich zitiere W. Hilligen – nach dem "Bedeutsam-Allgemeinen" der Geschichte für die Gegenwart und Zukunft von Schülerinnen und Schülern: Sie ist nicht "Abbilddidaktik". Sie befragt die selber von Gegenwartserfahrungen und Zukunftserwartungen ausgehende Geschichtswissenschaft daraufhin,
- welchen Beitrag sie durch ihre Forschungsleistungen zur Aufklärung gegenwärtiger und voraussichtlich zukünftiger Probleme leisten kann und
- inwieweit Geschichte als eine bestimmte Denkform Schülerinnen und Schüler befähigen kann, Gegenwartsprobleme more histerico anzugehen.
Da Schule, Unterricht, Schulfächer – und vor allem andern die an politischer Bildung im engeren Sinne beteiligten Schulfächer – auf vernünftige Orientierung in der Gesellschaft und auf vernünftiges gesellschaftliches Handeln vorbereiten sollen, sollen Schüler nach gesellschaftlicher Übereinkunft in ihnen lernen, Probleme der gesellschaftlichen Praxis vernünftig anzugehen. Dazu gehört nicht nur die Fähigkeit, bereits seit langem existierende, strukturelle gesellschaftliche Probleme also Probleme, deren Problemhaltigkeit seit langem bekannt ist zu kennen und Lösungsmöglichkeiten kennenzulernen und zu kennen.
Dazu gehört vielmehr auch, mit neu auftauchenden Problemen umgehen zu lernen, also Verfahren zu lernen, erprobte, bewährte, im historischen Lernprozess der Gattung als unverzichtbar erkannte Fragestellungen und zugehörige Denkmethoden zu erlernen, die einen vernünftigen Umgang mit Problemen und gerade auch mit neu (oder wieder neu) auftauchenden Problemen ermöglichen.
3. Folgerungen
Die Gegenwartsbezogenheit (und Zukunftsbezogenheit) historischen und geschichtsdidaktischen Denkens – so lässt sich zusammenfassen – kann nicht als wissenschaftsfremdes und illegitim politisches Element aufgefasst werden, schon gar nicht als Ausfluss "totalitären Denkens": Sie folgt aus der inneren Logik der historischen Erkenntnis und des geschichtsdidaktischen Denkens.
Die Gegenwartsbezogenheit (und Zukunftsbezogenheit) äußert sich in konkreten Gegenwartsbezügen. Und damit kommen wir zu einem eminent wichtigen Befund, zu einem Befund, der nun einmal in jede Lehrplanplanung eingehen muss, will sie denn den Anspruch haben, zeitgemäss wissenschaftlich begründet zu sein. Es geht in der historisch-politischen Bildung politische Bildung ist keine politische Bildung, wenn sie nicht als historisch politische Bildung angelegt ist – primär immer um gegenwärtige, im weitesten Sinne ethisch politische Probleme. Im Geschichtsunterricht wird danach gefragt, wie historisches Denken im Sinne eines Ensembles von Frageweisen, Denkweisen und Ergebnissen dazu beitragen kann, gegenwärtige Probleme so vernünftig zu betrachten und betrachten zu lernen, dass daraus eine nach Maßgabe des Möglichen vernünftige Praxis sich ergibt.
Der Clou für die historisch politische Bildung besteht eben darin, dass der Geschichtsunterricht von den gleichen gegenwärtigen Problemen ausgeht oder zumindest prinzipiell ausgehen kann, die auch den Politikunterricht bestimmen. Die Gemeinsamkeit der Probleme begründet die Idee des fächerübergreifenden Unterrichts: Bei diesem Unterricht bringen die an historisch politischer Bildung beteiligten Fächer ihre je eigenen Frageweisen, Denkweisen und Kategorien ein, um das ihnen gemeinsame Problem zu betrachten, zu bedenken. Und sie kommen aus ihrer Sicht zu Ergebnissen, die dabei helfen, dass gemeinsame Problem differenzierter – aus der Sicht der Geschichtsdidaktik: erfahrungsgesättigter und mit empirisch erworbener historischer Phantasie und Alternativität – zu betrachten.
Bezogen auf den Geschichtsunterricht heißt das mitnichten, dass dabei aus der Geschichte Belegmaterial für vorgefasste Meinungen herangezogen wird – wie das die Gegner der Rahmenrichtlinien beschworen haben. Der Geschichtsunterricht ist auf die methodische Rationalität der Geschichtswissenschaft festgelegt. Er kann das gegenwärtige Problem nur dann historisch vernünftig angehen, wenn die Frage an die erkennbare menschliche und unmenschliche Vergangenheit für alle Antworten offen ist.
Einer solchen Orientierung der Geschichtsdidaktik an der Gegenwartsbezogenheit steht die traditionelle Darstellungsform des Geschichtsunterrichts – der sogenannte chronologische Durchgang – mit traditionellen Unterrichtsinhalten, dem sogenannte Kanon (Kanon ist übrigens Bildung durch Auslassung!), scheinbar entgegen. Ich spreche hier gegen die absolute Dominanz der Chronologisierung der Geschichte. Sie macht den im Diskurs der Historiker praktisch wirksamen und in ihre Forschungsleistungen je und je eingebrachten und deutlich beobachtbaren Gegenwartsbezug in der Regel fast unerkennbar. Sie widerspricht weiterhin in eklatanter Weise den Interessen, die Schülerinnen und Schüler an Geschichte haben. Und diese Interessen sind nicht gering zu schätzen, nicht so sehr, weil die Schüler ungeheuren Frustrationserfahrungen ausgesetzt sind, sondern vor allem deshalb, weil die absolute Dominanz des chronologischen Durchgangs langfristig demotiviert und gerade das verhindert, ja vernichtet, was Geschichtsunterricht anstrebt: Interesse am historischen Denken und an der Bildung eines vernünftigen, reflektierten Geschichtsbewusstseins. Ich spreche also zwar gegen die klassische Darstellungsform von Geschichte, nicht aber gegen alle traditionellen Unterrichtsinhalte. Sie bilden ein wichtiges kommunikatives Element in unserer Gesellschaft, die nur um den Preis des Kommunikationsabbruches zwischen den Generationen aus dem Geschichtsunterricht ausgeblendet werden könnten. Diese Themen haben aber ihren Wert nicht an sich, sondern nur für uns. Sie sind aus keinem anderen Grund klassische Themen des Geschichtsunterrichts, weil sie in jeder Gegenwart, aus jeder Gegenwart neu betrachtet und mit Gewinn für diese Gegenwart neu befragt werden können, immer neu im doppelten Sinne fragwürdig.
Ich spreche entschieden für die Erkennbarkeit des Gegenwartsbezugs im Geschichtsunterricht und spreche damit zugleich entschieden gegen den objektivistischen Trugschluss, die Geschichte sei einfach die Summe aller vergangenen Handlungen, ihrer Voraussetzungen, Bedingungen, Absichten und Folgen, die rein für sich, also unabhängig von den Absichten gegenwärtigen Handelns ("wertfrei"), erforscht und dargestellt werden könnten.
4. Fragen
Aus den bisherigen Überlegungen können sich einige Fragen ergeben:
Aus welchem Grunde sollte es unmöglich oder nicht sinnvoll sein, die an politischer Bildung beteiligten Fächer zu der Benennung gemeinsam interessierender gesellschaftlicher Herausforderungen zusammenwirken zu lassen? Aus welchem Grunde sollte es unmöglich sein, Fächer darauf zu verpflichten, die ihnen gemeinsamen Probleme auf ihre je eigene Art anzugehen und an ihnen ihre Eigenständigkeit voll zur Geltung zu bringen – ihre Eigenständigkeit, die darin besteht, dass sie ihre fachspezifischen Errungenschaften einsetzen, um sozialkundliche, geographische und historische Antworten auf das gemeinsame Problem zu geben?
Warum sollte es nicht möglich sein, Lehrpläne so zu konzipieren, dass Zeit und Raum bleibt, um die Kooperation zu ermöglichen und die Fächer nicht völlig isoliert voneinander arbeiten zu lassen?
Warum sollte es nicht möglich sein, die traditionellen Bildungsinhalte im Lehrplan so zu streuen, dass sie allesamt zwar "durchgenommen" werden müssen, ohne doch in der traditionellen Darstellungsform des chronologischen Durchgangs behandelt werden zu müssen?
Warum sollte es nicht möglich sein, die lebensweltlich entstandenen und aufbrechenden Interessen der Schüler an Geschichte und an bestimmten Inhalten des Geschichtsunterrichts variabel zu befriedigen, d.h. dann, wenn sie aufbrechen? Warum sollte es nicht möglich sein, das auch bei Schülerinnen und Schülern wirkende Ensemble von Traditionen, Gegenwartserfahrungen und Zukunftserwartungen, das allererst zur Auseinandersetzung mit vergangenem menschlichen Handeln und Leiden reizt, durch entsprechende Konzeption des Lehrplans und Hinweise auf organisatorische Möglichkeiten zu berücksichtigen? Die Zeitgenossenschaft von Schülerinnen und Schülern, aus der das Interesse an Geschichte als einer bestimmten Frage und Denkweise resultiert, ist eine generationsspezifisch wache Zeitgenossenschaft, die zu ertragreichen, spannenden Anfragen an die Geschichte führt und – wenn es befriedigt wird – das Interesse an Geschichte nicht abtötet.
Die Folgerungen können m. E. nur lauten für die Fächer bzw. Fachvertreter – ich sage damit nichts Neues (8):
- Kooperation, unbedingte Kooperation bei der Benennung gemeinsam interessierender gesellschaftlicher Herausforderungen; Kooperation heißt dabei Kooperation der Fachvertreter von Sozialkunde, Geographie und Geschichte. Kooperation heißt Suche nach gemeinsam interessierenden, für Gegenwart und voraussehbare Zukunft bedeutenden, gesellschaftlichen Herausforderungen.
- Eigenständigkeit, unbedingte Eigenständigkeit in der Vermittlung der je facheigenen Fragestellungen, Kategorien und Denkmethoden, die eine – ich betone: eine – je eine Zugangsmöglichkeit zum betreffenden Problem darstellen.
- 3. Die Integration der dabei innerhalb der einzelnen Fächer erbrachten, erarbeiteten Ergebnisse zu einer vernünftigen, vielseitigen Problemwahrnehmung und Handlungsperspektive ist das Resultat von Kooperation und Eigenständigkeit.
Kooperation, Eigenständigkeit, Integration sind Phasen der Planung und Durchführung von Unterricht. Es geht dabei nicht nur um die Ergebnisse. Wichtig ist vor allem, dass die verschiedenen Zugangsmöglichkeiten, die durch die verschiedenen Fächer repräsentiert werden, eingeübt werden, und dass die Integration der fachspezifischen Ergebnisse erkennbar durch die Fachvertreter hilfreich angeleitet wird. Mündigkeit kann nur heißen, dass die Schülerinnen und Schüler in einem durch die Fachvertreter angeleiteten Prozess lernen, die Frage und Denkweisen der Fächer und ihre Ergebnisse anzuwenden.
Gesellschaftslehre als Lernbereich war und ist kein "Flop", sondern ein zukunftsweisender Ansatz. Denn sie fordert nur, was wissenschaftlich allenthalben zu beobachten ist: gemeinsame Problemwahrnehmung und Problembenennung, Konstituierung von entsprechenden Forschungsbereichen – Ökologie, Friedensforschung, Frauenforschung z.B. –, die mit den Frage und Denkweisen der traditionellen Fächer angegangen, bearbeitet werden und in den Fächern zu Ergebnissen führen, die zu einer differenzierten Einschätzung des Problems führen und zu einem Zusammenhangwissen. Ökologie, Friedensforschung, Frauenforschung z.B. sind dabei keine Fächer, sondern Forschungsbereiche, die durch Fächer bearbeitet werden, die etwas zu fragen und zu sagen haben und deren Ergebnisse zu einer differenzierten Sicht integriert werden.
Im übrigen ist unmittelbar einsichtig, dass neue Inhalte des Geschichtsunterrichts – so z.B. die politische Argumentation mit historischen Sachverhalten und Erfahrungen ("Geschichte als politisches Argument") oder die Werbung mit Geschichte ("historisierende Werbung") – in einem fächerverbundenen Unterricht besser zu besprechen sind als in einem traditionellen Fachunterricht.
5. Abschließende Bemerkungen
Wenn Fächerautonomie heißen sollte, dass die an historisch politischer Bildung beteiligten Fächer – statt selbst zu bestimmen, wie es ja im Wort steckt, dazu bestimmt werden, unabhängig voneinander, isoliert nebeneinander, nicht durch das Interesse an gemeinsamen gegenwärtigen Problemen miteinander verbunden, ihre traditionellen didaktischen Darstellungsformen – im Geschichtsunterricht der chronologische Durchgang – zu verwenden und dann vielleicht auch noch vorrangig auf eine krude nationale Identität abzuheben, dann wäre dies gegenüber dem Erkenntnisstand von Geschichtstheorie und Geschichtsdidaktik eine denkgeschichtliche Regression.
Das muss auch deshalb in dieser Schärfe gesagt werden, weil es zu Lasten von Schülerinnen und Schülern geht, die in der Geschichtsdidaktik wie in anderen Fachdidaktiken auch als anspruchsberechtigte Subjekte gesehen werden – als Subjekte, die zum Anspruch berechtigt sind, in der Schule nach Maßgabe des der Schule Möglichen zu Selbstbestimmung fähig zu werden, selber denken zu lernen, wie gesellschaftliche Herausforderungen vielfältig analysiert werden müssen, um die Ergebnisse der Analyse zu einem Zusammenhangwissen zu integrieren, das ein vernünftiges Handeln anleitet.
Anmerkungen
(1) Broschüre der CDU Hessen 1973: "Marx statt Rechtschreibung", abgedruckt in: Bergmann, Klaus; Pandel, Hans-Jürgen. Geschichte und Zukunft, Frankfurt/M. 1975, S. 187
(2) CDU Abgeordneter Sälzer im Landtag 29.03.1973, abgedruckt in: Bergmann/Pandel, a.a.O., S. 189
(3) Hartmut Müller Kinet 1973, abgedruckt in: Bergmann/Pandel, a.a.O., S. 269
(4) Benedetto Croce, Die Geschichte als Gedanke und als Tat, Bonn 1944, S. 41
(5) Jakob Burckhardt, Historische Fragmente, hg. von E. Dürr, Stuttgart 1957, S. 1
(6) Johann Wolfgang von Goethe, Erfahrung der Geschichte. Historisches Denken und Geschichtsschreibung in einer Auswahl, hrsg. von Horst Günther, Frankfurt/M. 1982, S. 208
(7) Hans Ulrich Wehler, zitiert nach: Christian Meier, Klio als Klatschbase, in: Kursbuch 91: Wozu Geisteswissenschaften?, März 1988, S. 54
(8) Vgl. dazu H. J. Pandel, Integration durch Eigenständigkeit?, in: Rolf Schörken (Hrsg.), Zur Zusammenarbeit von Geschichts und Politikunterricht, Stuttgart 1978. S. 346 ff.
Literatur
Broschüre der CDU Hessen (1973): "Marx statt Rechtschreibung", abgedruckt in: Bergmann, Klaus; Pandel, Hans Jürgen. Geschichte und Zukunft, Frankfurt/M.
Burckhardt, Jakob (1957): Historische Fragmente. Hg. von E. Dürr, Stuttgart.
CDU Abgeordneter Sälzer im Landtag 29.03.1973 (1973): abgedruckt in: Bergmann, Klaus; Pandel, Hans-Jürgen. Geschichte und Zukunft, Frankfurt/M.
Croce, Benedetto (1944): Die Geschichte als Gedanke und als Tat. Bonn.
Müller Kinet, Hartmut (1973): abgedruckt in: Bergmann, Klaus; Pandel, Hans-Jürgen. Geschichte und Zukunft, Frankfurt/M.
Goethe, Johann Wolfgang von (1982): Erfahrung der Geschichte. Historisches Denken und Geschichtsschreibung in einer Auswahl. Hg. Von Günther, Horst, Frankfurt/M.
Pandel, Hans-Jürgen (1978): Integration durch Eigenständigkeit? In: Schörken, Rolf. Hg. Zur Zusammenarbeit von Geschichts und Politikunterricht. Stuttgart.
Wehler, Hans Ulrich, zitiert nach: Meier, Christian (1988): Klio als Klatschbase. In: Kursbuch 91: Wozu Geisteswissenschaften?
Bergmann, Klaus (1988): Zeitgeschichte in der politischen Bildung
1. Geschichte und Zeitgeschichte
Geschichte als Historie ist gegenwärtiges Nachdenken über vergangenes menschliches Handeln und Leiden. Erforschung und Reflexion des Geschehenen erfolgen unter dem Einfluss von Traditionen, Gegenwartserfahrungen und Zukunftserwartungen. So ist alle Geschichte Zeit Geschichte. Und so ist Geschichte als gegenwarts und zukunftsbezogene Auseinandersetzung mit der erkennbaren menschlichen und unmenschlichen Vergangenheit unabdingbarer Bestandteil aller politischen Bildung. Im engeren, gebräuchlichen und hier gemeinten Sinn ist Zeitgeschichte eine Bezeichnung für die jüngste Vergangenheit und zugleich für die mit ihr befasste Disziplin der Geschichtswissenschaft. Die Zeitgeschichte ist nicht allgemein datierbar. Als "die Geschichte der Zeit dessen, auf den das Wort bezogen ist" (Jäckel 1975, 71), ist sie nur in Hinsicht auf den oder die Betrachtenden zeitlich je und je ungefähr begrenzbar. Sie ist immer das zur Lebensgeschichte des erkennenden Subjekts zeitgleich verlaufende Geschehene und doch auch mehr: Sie umgreift zudem jene nicht selber erlebte Geschichte, die im Gespräch mit Zeitgenossen (oral history) vergegenwärtigt werden kann.
Die Zeitgeschichte macht den der Geschichte eigenen Bezug auf die Lebenspraxis in besonderer, oft unvermittelter Weise erkennbar. Es ist ein wesentliches Merkmal der jüngsten Vergangenheit, dass ihre materiellen und ideologischen Grundlagen, ihre herrschaftlichen Verhältnisse und mentalen Strukturen jenem Handlungsrahmen unmittelbar ähnlich sind, der gegenwärtigem und voraussehbar zukünftigem Handeln vorgegeben ist. Die Besonderheit der Zeitgeschichte kann auch für das moralische Interesse der wissenschaftlichen Zeitgeschichte stehen das Interesse, die in der jüngsten Vergangenheit offenbar gewordenen Gefährdungen der Menschlichkeit und Möglichkeiten der Unmenschlichkeit (totaler Staat, totaler Krieg, Holocaust, technische Möglichkeiten der Beeinflussung, Beherrschung, Unterdrückung und Vernichtung), ja endlich der Vernichtung der Menschheit (Hiroshima, atomares Wettrüsten, ökologische Katastrophen) in ihren Voraussetzungen und Bedingungen zu erkennen und bekämpfen zu helfen. [/S. 550:]
Die Geschichtswissenschaft kann der Eigentümlichkeit, dass die jüngste Vergangenheit der Gegenwart in ihren Strukturen ähnlicher ist als frühere Vergangenheiten, besser gerecht werden, seit sie sich von einer vordergründigen politischen Ereignisgeschichte abgewandt und das Konzept einer "Historischen Sozialwissenschaft" oder "Gesellschaftsgeschichte" entworfen hat. Ein wesentlicher Teil der Geschichtswissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland bekennt sich zum "moralischen Beruf" der Historie und zu Geschichte als einer kritischen Gesellschaftswissenschaft, die in ihrem wissenschaftlichen Bemühen um die Vergangenheit von "konkreter Utopie", von der "Hoffnung auf eine grundlegende Verbesserung der menschlichen Existenz"(Wehler im Anschluss an Horkheimer) angeleitet wird. Eine kritische historische Gesellschaftswissenschaft, die sich Marx näher als Ranke weiß, eröffnet den Blick auf grundlegende Herrschaftszusammenhänge und ideologische Strukturen der Zeitgeschichte, die der traditionellen Historie verschlossen waren, und schärft den Blick für die historisch je und je unnötige Kluft zwischen Möglichem und Wirklichem.
Didaktisch nicht weniger bedeutsam ist die gerade bei der Erforschung der jüngsten Vergangenheit beobachtbare Zuwendung zur "Alltagsgeschichte" (Bergmann/Thurn 1985). Alltagsgeschichte ist an einer Historie interessiert, in der die historisch gleichsam stummen Gruppen etwa Frauen, Arbeiter, Angehörige von Unterschichten ihre historische Sprache finden und zu Wort kommen; sie zielt zugleich darauf, dass diese Gruppen sich die ihnen nicht bewusste, ihnen enteignete oder verlustig gegangene eigene Geschichte selber aneignen können, indem sie befähigt werden, ihren historischen Verstand eigenständigen gebrauchen und vorgesetzten Geschichtsdarstellungen kritisch zu begegnen. Die bevorzugt angewandte Methode ist für den Bereich der Zeitgeschichte das Verfahren der oral history, der mündlichen Befragung von Zeitgenossen in zwanglosen Gesprächssituationen, die für beide beteiligten Seiten als Lernsituationen gedacht sind.
Wenn es der Alltagsgeschichte gelingt, ihre Kenntnisse und Erkenntnisse darüber, wie Menschen unserer Zeit Geschichte erfahren, erlitten und wahrgenommen haben, mit der Gesellschaftsgeschichte und ihren Kenntnissen und Erkenntnissen darüber, welche Faktoren struktureller Art sich gleichsam hinter dem Rücken und gegen die Absichten der Menschen durchgesetzt haben, zu vermitteln, werden wichtige Lernprozesse möglich: Die Spannung zwischen dem, was Historiker über die bedingenden Strukturen und das Gesetz der unbeabsichtigten Wirkungen wissen, und dem, wie nach Einsicht der Alltagshistorie die Menschen die Strukturen und die aus ihnen hervorgehenden politischen Vorgänge erlebt, gesehen, wahrgenommen und auf sie handelnd einzuwirken versucht haben, fordert Fragen und Nachdenken heraus und fördert Einsichten in politisches Handeln.
2. Zeitgeschichte in der politischen Bildung
Es geht in der politischen Bildung primär um gegenwärtige Probleme, denen eine dauerhafte, nicht bloß aktuelle gesellschaftliche Bedeutung zugesprochen werden kann. Es geht auch im Geschichtsunterricht primär immer um gegenwärtige, im weitesten Sinne politische Probleme; es wird gefragt, wie historisches Denken dazu beitragen kann, gegenwärtige Probleme so zu betrachten, dass daraus eine vernünftig begründbare politische Praxis folgt. Der Geschichtsunterricht, der den Unterricht in Zeitgeschichte einschließt, geht dabei von den gleichen [/S. 551:] gegenwärtigen Problemen aus, die auch den Politikunterricht bestimmen. Die Gemeinsamkeit der Probleme begründet die Idee des kooperativen Unterrichts: Bei diesem Unterricht bringen die an politischer Bildung beteiligten Fächer ihre je eigenen Denkweisen ein, um das ihnen gemeinsame Problem mit unterschiedlichen Fragestellungen und Methoden zu betrachten. Die Rolle der Zeitgeschichte hängt davon ab, ob sie innerhalb des kooperativen Unterrichts dem Politik , Geographie oder einem anderen Fachunterricht Dienstleistungen erbringt oder ob sie innerhalb des Geschichtsunterrichts die eigene Denkweise zur Geltung kommen lässt.
2.1 Zeitgeschichte als Dienstleistung
Im Rahmen des Politikunterrichts oder eines anderen Fachunterrichts wird Zeitgeschichte oft benutzt, um den Lernenden Sachinformationen über die historische Gewordenheit des gegenwärtig anstehenden Problems zu vermitteln. Die Kenntnis dieser in den Lernprozess gleichsam von außen eingegebenen Informationen über die historischen Ursachen und Prägungen ist für ein der Problemlage angemessenes politisches Bewusstsein und Handeln unabdingbar. In diesem Sinne stellt die Zeitgeschichte Wissen über Daten, Fakten, Personen, Institutionen oder Zusammenhänge bereit, das im Politikunterricht oder im Unterricht anderer Fächer gebraucht wird und abgerufen werden kann.
Darüber hinaus liefert die Zeitgeschichte historische "Fälle", auf die bei der Besprechung politologischer, ökonomischer oder soziologischer Systembegriffe und struktureller Regelmäßigkeiten unserer Zeit beispielhaft oder ergänzend verwiesen werden kann. Auch dies ist ein Beitrag, zu dem die Zeitgeschichte für Zwecke politischer Bildung innerhalb des Unterrichts anderer Fächer herangezogen werden kann. Er erfordert in diesen Fällen keinen eigenständigen Zeitgeschichte Unterricht, da er in der Vermittlung oder Benutzung eines isolierten und nicht selbständig ermittelten Wissens sich erschöpft.
2.2 Zeitgeschichte und Historisches Denken
Im Rahmen des kooperativen Unterrichts lehrt die Zeitgeschichte als Bestandteil des Geschichtsunterrichts ein gegenwärtiges Problem nach Art der Historie zu betrachten und mit den Mitteln des historischen Denkens anzugehen. Wo an der Zeitgeschichte historisches Denken gelernt werden soll, heißt dies zunächst, das Fragen nach Ursachen und das Erkunden von Ursachen zu lernen, die die gegenwärtige Entscheidungssituation maßgeblich herbeigeführt haben. Dies ist der selbstverständlichste Anteil, den zeithistorisches Lernen an politischer Bildung hat: Lernende zu befähigen, historische Informationen eigenständig zu erheben und narrativ zu verknüpfen.
Historisches Lernen an der Zeitgeschichte geht nicht in dieser selbständigen Ermittlung der Ursachen des gegenwärtigen Problems auf. Die Zeitgeschichte erschließt darüber hinaus in konkret genetischer Betrachtung den Lernenden Erfahrungen, die in der jüngsten Vergangenheit Menschen unserer Zeit in Situationen und mit Problemen gemacht haben, die mit den gegenwärtigen Situationen und Problemen vergleichbar sind. Wenn z.B. Arbeitslosigkeit ein wesentliches gesellschaftliches Problem unserer Zeit und der nächsten Zukunft ist, dann ist es sinnvoll, danach zu fragen, wie Menschen in der jüngst zurückliegenden Vergangenheit in vergleichbaren Situationen sich verhalten haben; es bietet sich eine Untersuchung darüber an, wie Menschen in der Weltwirtschaftskrise von 1929 und den folgenden Jahren oder in der Rezession der [/S. 552:] 60er Jahre als bedingt vergleichbaren Situationen in die Arbeitslosigkeit geraten sind, was sie gedacht, gewollt und getan haben, um mit dieser Situation fertig zu werden und welche auch unbeabsichtigten Folgen ihr politisches Handeln und Unterlassen gehabt haben.
Schüler und Erwachsene lernen dabei nicht nur in einer Anschaulichkeit und Dichte, die "betroffen" machen kann Erfahrungen kennen, die Zeitgenossen im Laufe der Zeit gemacht haben und ihnen in Erzählungen noch vermitteln können. Sie lernen auch ihnen fremde oder ihnen in etwa geläufige Wertorientierungen kennen, an denen sie sich reiben und mit denen sie sich auseinandersetzen können, um ihre eigenen Wertvorstellungen, ihre spontanen Identifikationen oder Distanzierungen zu überprüfen, zu verändern, abzuwandeln oder kritisch zu bestätigen. Sie erweitern der Möglichkeit nach ihre von gegenwärtigen Selbstverständlichkeiten geprägten Vorstellungen und Denkmuster durch "historische Phantasie": Wie in der "früheren" Geschichte gibt es auch im Umkreis der Zeitgeschichte gedachte und gelebte, antizipierte und gescheiterte Möglichkeiten menschlich gesellschaftlicher Existenz zu entdecken, vor dem Vergessen zu bewahren und neu zu bedenken. Der Zeitgeschichte Unterricht beugt damit einem "Verlust der Geschichte" vor, wobei hier nicht der bildungsbürgerliche Klageruf über die angebliche Abnahme einer bestimmten Form historischer Bildung gemeint ist, sondern vielmehr dass gerade im Bereich der Zeitgeschichte die Bereitschaft zu Erinnerung und kritisch selbstkritischer Rückschau überlagert werden kann durch die Bereitschaft zu vergessen, zu verdrängen, zu beschönigen oder Schuld buchhalterisch aufzurechnen.
Darüber hinaus erhalten die Lernenden im Zeitgeschichte Unterricht an konkret nachvollziehbaren Abläufen grundlegende Einsichten in politisches Handeln: Sie erkennen, dass politisches Handeln der Versuch einer sinnvollen Reaktion auf vorgefundene und vorgegebene Umstände ist, auf Wertvorstellungen, Sinngebungen oder sehr handfesten materiellen Interessen beruht, erfolgreich sein oder scheitern und unbeabsichtigte Nebenwirkungen haben kann oder dass es Diskrepanzen zwischen früheren Ansprüchen und gegenwärtiger Wirklichkeit geben kann, die aufgeklärt werden können. Im Zeitgeschichte-Unterricht werden solche Einsichten nicht abstrakt aufgesetzt und vermittelt, sondern an konkreten historischen Handlungsverläufen ermittelt, erkannt und auf den sozialwissenschaftlichen Begriff gebracht. Letztlich lernen die Erwachsenen und Schüler eine bestimmte Form des Denkens das historische Denken, das den durch menschliches Handeln ausgelösten Veränderungen in der Zeit mit bestimmten Fragestellungen, Methoden und Kategorien nachgeht.
3. Zeithistorisches Denken und Lebenspraxis
Historisches Denken als ein besonderes Vermögen, die Wirklichkeit vernünftig zu betrachten, ist eine in der alltäglichen Lebenspraxis oft benötigte Fähigkeit. Die Lebensgeschichte eines jeden Menschen ist mit der allgemeinen Geschichte seiner Zeit eng verwoben. Historisches Denken kann helfen, die je eigene Lebensgeschichte in den Zusammenhang der Zeitgeschichte einzuordnen, die erlebte Geschichte kritisch zu erinnern und im Gedächtnis zu halten und die geschehende Geschichte mit den erlernten Fragestellungen und Methoden zu betrachten, um so die Lebensgeschichte nicht als bewusstlose und unbegriffene Leidensgeschichte zu erfahren. Der Zusammenhang von Lebensgeschichte und Zeitgeschichte muss daher [/S. 553:] in Lernprozessen an den Biographien der Lernenden und Lehrenden ausdrücklich besprochen werden. Dabei gibt es zwischen Schulunterricht und Erwachsenenbildung einen wesentlichen Unterschied: In der Schule geht es um eine Geschichte, die von den Schüler(inne)n selbst nicht bewusst erlebt worden ist, die aber ihre Kindheit und Jugend geprägt hat oder vor ihrer Zeit lag. In der Erwachsenenbildung geht es um eine Geschichte, in die die Erwachsenen handelnd und leidend verstrickt waren (und noch sind) und die nunmehr kritisch aufgeklärt und begriffen werden soll.
Als das artgemessenste und im Sinne politischer Bildung ertragreichste Verfahren hat sich dabei das "entdeckende Lernen" erwiesen, das in den letzten Jahren von Schüler(inne)n in Archiven und bei oral history Gesprächen mit Zeitzeugen erprobt worden ist. Auch im Bereich der Erwachsenenbildung und Selbst bildung in Geschichtsvereinen, Geschichtswerkstätten oder in der gewerkschaftlichen und politischen Bildungsarbeit kommt das Prinzip des entdeckenden Lernens erfolgreich zur Geltung. Das dabei auftauchende Problem, dass in der Regel die Zeitzeugnisse, die Befragten und Beteiligten von ihrem jeweiligen Standort her die Vergangenheit als eine Geschichte erzählen, die sich von den Geschichten der anderen Befragten und Beteiligten unterscheidet, ist kein Lernhemmnis, sondern ermöglicht einen wichtigen Schritt auf dem Weg des Erlernens des historischen Denkens: Die Lernenden müssen erfahren, dass die unterschiedlichen Geschichten, die von einer gemeinsam erlebten oder ermittelten Vergangenheit erzählen, nicht einfach voreinander "falsch" sind. Sie müssen vielmehr "für die Problematik differenter Geschichten sensibilisiert werden und Methoden erlernen, wie unterschiedliche Versionen von Geschichten auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft" (Becher 1979, 304), nach Maßgabe des Möglichen miteinander vermittelt und in den gesellschaftlichen Zusammenhang der allgemeinen Zeitgeschichte eingeordnet werden können.
Historisches Denken ist auch da gefragt, wo zeithistorische Sachverhalte in unterschiedlichen Formen und Absichten in der Öffentlichkeit präsentiert werden. Wo immer Zeitgeschichte ob in politischer oder in scheinbar bloß unterhaltsamer Absicht "unters Volk gebracht" wird, droht die Übermächtigung des Laienpublikums durch vormündige Geschichtsdarstellungen. In Lernprozessen müssen daher an Fallbeispielen zeitgeschichtliche Sendungen der Rundfunk und Fernsehanstalten, zeitgeschichtliche Artikel in der Presse, der Gebrauch und Missbrauch von Zeit-"Geschichte als Argument" (Calließ) in der politischen Debatte, die Verwendung zeitgeschichtlicher Klischees in der Werbung, die Behandlung und Misshandlung von Zeitgeschichte bei Gedenkveranstaltungen oder zeitgeschichtliche Versatzstücke in Stammtischparolen methodisch kritisch, vor allem ideologiekritisch betrachtet werden, um in Zukunft der öffentlichen Verwendung von Geschichte nicht unberaten und unbedarft ausgesetzt zu sein.
Wird historisches Denken an zeitgeschichtlichen Sachverhalten eingeübt, kann vielleicht verhindert werden, dass die Lernenden in Lernprozessen und in der Lebenspraxis nur mehr "betroffen" reagieren. Die vielberedete "Betroffenheit" ist kein Ziel des zeitgeschichtlichen Unterrichts, allerdings ein wichtiger Gegenstand des Nachdenkens. Es geht nicht um die Abstützung gefühliger Identitäten, sondern darum, mit den Mitteln vernünftigen historischen Denkens von Betroffenheit zu Aufklärung, von Reflexen zu Reflexion, von naiver Identifikation zu überlegter Identität, von unüber[/S. 554:]legter Parteinahme zu kritischem Engagement zu kommen und jenseits des Unterrichts von spontaner Reaktion zu einem politischen Handeln, das bei dem Versuch, soziale Ungerechtigkeiten aufzuheben, Gefährdungen der Menschlichkeit und der Menschheit zu bekämpfen und das Mögliche wirklich werden zu lassen, die Voraussetzungen und Bedingungen vernünftig einschätzt.
Literatur
Becher, Ursula (1979): Zeitgeschichte und Lebensgeschichte. In: Geschichtsdidaktik, 4/1979.
Bergmann, Klaus; Thurn, Susanne (1985): Didaktik der Alltagsgeschichte. In: Bergmann, Klaus; Kuhn, Annette; Rüsen, Jörn; Schneider, Gerhard (Hrsg.): Handbuch der Geschichtsdidaktik, Bd. 1. 3. Aufl. Düsseldorf.
Bracher, Karl Dietrich (1987): Zeitgeschichtliche Erfahrungen als aktuelles Problem. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B11/1987.
Galinski, Dieter; Herbert, Ulrich; Lachauer, Ulla (Hrsg.) (1982): Nazis und Nachbarn. Schüler erforschen den Alltag im Nationalsozialismus. Reinbek.
"Geschichte erfahren" (1986): Schwerpunktthema von: Geschichtsdidaktik 1/1986.
"Geschichtsbewusstsein" (1987): Themenheft von: Geschichtsdidaktik 2/1987.
Giesecke, Hermann (1978): Skizzen zu einer politisch begründeten historischen Didaktik. In: Neue Sammlung, 1/1978.
Heer, Hannes; Ullrich, Volker (Hrsg.) (1985): Geschichte entdecken. Erfahrungen und Projekte der neuen Geschichtsbewegung. Reinbek.
"Historikerstreit"(1987): Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung. München, Zürich.
Jäckel, Eberhard (1975): Begriff und Funktion der Zeitgeschichte. In: ders.; Weymar, Ernst (Hrsg.) Die Funktion der Geschichte in unserer Zeit. Stuttgart.
Lucas, Friedrich J. (1966/1972): Der Bildungssinn von Geschichte und Zeitgeschichte in Schule und Erwachsenenbildung. In: ders., Geschichte als engagierte Wissenschaft. Stuttgart.
"Oral History – Kommunikative Geschichte" (1984): Schwerpunktthema von: Geschichtsdidaktik 3/1984.
Paul, Gerhard; Schossig, Bernhard (Hrsg.) (1986): Die andere Geschichte. Geschichte von unten. Spurensicherung, ökologische Geschichte, Geschichtswerkstätten. Köln.
Schörken, Rolf (Hrsg.) (1978): Zur Zusammenarbeit von Geschichts- und Politikunterricht. Stuttgart.
Schörken, Rolf (Hrsg.) (1981): Der Gegenwartsbezug der Geschichte. Stuttgart.
Sutor, Bernd (1986): Zeitgeschichte und Politikunterricht. In: Katholische Bildung, 7-8/1986.
Sygusch, Frank (1987): Auswahlbibliographie zum "Historiker-Streit" (Stand Juli 1987). In: Gerstenberger, Heide; Schmidt, Dorothea (Hrsg.) Normalität oder Normalisierung. Geschichtswerkstätten und Faschismusanalyse. Münster.
Wehler, Hans Ulrich (1976): Bismarck und der Imperialismus. 4. Aufl. München.
"Zeitgeschichtsunterricht": Ständiges bibliographisches Stichwort in der Zs. "BIBreport" und in den (daraus zusammengestellten) Jahresbänden "ADIEU. Duisburg.
Zitzlaff, Dietrich (1987): Das neue Geschichtslernen. Themen, Formen, Impulse. Eine Auswahlbibliographie. In: Politisches Lernen (DVPB-NRW), 3/1987.
Redaktionelle Änderungen durch sowi-online: Abkürzungen für "Zeitgeschichte" und "politische Bildung" ausgeschrieben; Form der Literaturangaben geändert, Literaturverzeichnis vervollständigt (Vornamen; ergänzt: Wehler). Seitenangaben zu Aufsätzen und Quelle Calließ fehlen im Original.
Hilligen, Wolfgang (1985): Zur Kooperation zwischen Politischem Unterricht und Nachbarfächern, zumal der Geschichte
Das Verhältnis von Politischem Unterricht und Geschichte (wie auch Erdkunde) im Rahmen der Politischen Bildung ist bisher noch nirgendwo in Übereinstimmung zwischen Sozialwissenschaftlern und Historikern praktikabel gemacht worden. Die Saarbrücker Rahmenvereinbarung aus den 60er Jahren z. B., in der die drei Fächer unter dem Begriff Gemeinschaftskunde für die Sek. II zusammengefasst worden waren, wurden additiv gehandhabt, mit harten Auseinandersetzungen um Anteile und Prioritäten. In diesem Kapitel soll die These begründet werden, daß die - eigenständigen - Fächer auf Kooperation angewiesen sind und daß hierfür didaktische Instrumente (Leit- bzw. Schlüsselfragen) notwendig, zumindest hilfreich sind. Ausgehend von Materialien zu einem Überblick über die Entwicklung des Verhältnisses der Fächer Politischer Unterricht und Geschichte (2.5.0) und von Thesen für die Kooperation (2.5.1) werden didaktische Vorschläge (2.5.2) skizziert. Diese werden sowohl in Leitfragen (2.5.3) als auch in einem Unterrichtsbeispiel und Hinweisen für die Auswahl im Zusammenhang mit der Matrix konkretisiert (2.5.4, 2.5.5)
2.5.0 Überblick über Möglichkeiten und Entwicklung des Verhältnisses von Politischem Unterricht und Geschichte
Grundsätzlich lassen sich etwa die folgenden Möglichkeiten unterscheiden:
- Mit der historischen Bildung ist die politische im wesentlichen geleistet (zumal mit der Geschichte der jüngsten
Vergangenheit).
In den meisten Bundesländern herrschte mindestens bis zum Ende der 50er Jahre diese Auffassung
vor. - Geschichtsunterricht und politischer Unterricht (Sozialkunde) werden so gut wie unabhängig voneinander geplant
und/oder erteilt.
Das ist in der Mehrzahl der Geschichts- und Politikstunden noch die Regel. - Der Geschichtsunterricht wird (mehr oder weniger) in den politischen Unterricht integriert.
Diese Konzeption wurde z.
B. in den Hessischen Rahmenrichtlinien "Gesellschaftslehre" von 1972 vertreten. Geschichtsunterricht beschränkte
sich im wesentlichen auf Vorgeschichte der Gegenwart, auf das Erfahrbarmachen von Veränderungen und auf die
ideologiekritische Betrachtung historischer Zeugnisse.
An dieser Verkürzung der historischen Dimension entzündete
sich der Widerstand der (gut organisierten) Historiker und Geschichtslehrer und trug wohl mit dazu bei, diese zur Entwicklung
eigener und neuer didaktischer Konzepte herauszufordern. Nach dem Hessischen Oberstufenurteil von1981 wird diese Lösung
nicht mehr offiziell vertreten. [/S. 242] - Neuerdings zeichnet sich eine Tendenz ab, eine sozialgeschichtlich angereicherte historische Betrachtungsweise so stark zu
betonen, dass nicht nur das Gewicht des politischen Unterrichts zurückgedrängt, sondern seine Eigenständigkeit
gefährdet wird. - Eine Kooperation der Fächer (seltener: ihrer Betrachtungsweisen) wird zwar immer wieder gefordert (z. B. in den
Richtlinien von Nordrhein-Westfalen von 1972/73); Lösungsvorschläge beschränken sich aber, soweit ich sehe, auf
organisatorische Regelungen.
2.5.1 Thesen zur Kooperation
1. Kooperation setzt voraus, dass in jedem und von jedem Fach aus neben der eigenen auch die Sicht- und Frageweise des anderen gepflegt und vermittelt wird: in der Geschichte neben (oder auch nach) der diachronischen, wo immer möglich, die systematische; in den Sozialwissenschaften neben der systematischen auch die häufig retrospektive (zurückblickende), diachronische. Dort steht die Einzigartigkeit der zu verstehenden Geschehnisse und Gestalten im Vordergrund, hier das Verallgemeinerungsfähige und Strukturelle:
Ohne historische Methoden und Fragestellungen können Lernende nicht die Einzigartigkeit von Personen und Ereignissen erfahren und nicht verstehen, warum Menschen je verschieden sind; ohne systematische, synchronische (die Zeiten zusammenschauende) Methoden und Betrachtungsweisen können sie nicht erkennen, was an den Menschen menschlich ist und welchen vergleichbaren Aufgaben sie sich trotz aller Andersartigkeit der Bedingungen je gegenübergestellt sehen.

Das heißt: "Geschichte ohne Soziologie ist blind, Soziologie ohne Geschichte ist leer" (Topitsch)*: "Social Sciences without History have no root, History without Social Sciences bears no fruit" (Hermann Finer) (Zit. nach Beyme von 1970, 19). Diesen in den beiden Wissenschaften unbestrittenen Satz müssten sich die Lehrenden beider Fächer zueigen machen.
2. Wie die doppelte Blickrichtung im Unterricht wirksam wird, hängt nicht von perfekten Richtlinien ab, sondern davon, dass Lehrer über "Methoden" - über heuristische Instrumente! - verfügen, mit deren Hilfe sie den Wechselbezug bei geschichtlichen wie bei politischen Themen herstellen können.
Vergleichbares gilt für das Fach Erdkunde. Einige Didaktiker der Geographie benutzen heute zur Beurteilung der gesellschaftlichen Bedeutung geographischer Faktoren den Begriff "Daseinsgrundfunktionen". Die Nähe zum Begriff "Überleben" und zum Begriff "Bedürfnisse" ist deutlich. Als Daseinsgrundfunktionen werden Essen, Sich-Kleiden, Wohnen, Vorsorge, in Gesellschaft leben und Fortpflanzung bezeichnet (vgl. Geographische Rundschau, Heft 12/1974). [/S. 243]
Die Bedrohung der Lebensgrundlagen verlangt heute im politischen Unterricht auch die Kooperation mit der Biologie: bei Aufgaben des Umweltschutzes im weitesten Sinne, aber auch für die Erkenntnis, dass sich die Evolution nicht mehr allein mit Ergebnissen der Fitnesskonkurrenz erklären lässt, dass ein Überleben der Gattung Mensch nur möglich ist, wenn sich die Gattung fähig erweist, innerhalb der Grenzen der Biosphäre zu kooperieren (vgl. Markl, 2.2.5.2).
2.5.2 Zusammengefasste didaktische Vorschläge für die Kooperation von Politischem Unterricht und Geschichte
1. Ausgangspunkt und oberstes Auswahl- und Wichtigkeitskriterium für beide Fächer/Aspekte ist die aufs Existentielle zielende didaktische Frage:
Wie können wir durch Geschichts- und Politikunterricht dazu beitragen, Schüler für die menschenwürdige Bewältigung von Situationen auszustatten, von denen wir heute und voraussichtlich morgen betroffen sind; wie können wir sie ausstatten für die Wahrnehmung von Chancen und die Bewältigung von Gefahren unserer geschichtlichen Situation?*
2. Weil Fragen an Geschichte, Gegenwart und Zukunft (wie sie von Historikern, Gesellschaftswissenschaftlern, Fachdidaktikern, Politikern gestellt werden), als perspektivisch erkannt worden sind (d. h. dem oft unbewussten Vorverständnis und/oder den bewussten Interessen und Absichten der Fragenden erwachsen), ist es notwendig, diese Perspektiven (Vorentscheidungen, Wert- und Zielvorstellungen) offenzulegen und Kontroversen darüber zum Thema zu machen - wenn man nicht einem "geheimen Curriculum" verfallen will.
Zunehmend wird die Perspektivität historischer Aussagen von Geschichtsdidaktikern wie von Historikern (und zwar nicht nur von solchen, die der Kritischen Theorie mehr oder weniger nahestehen) betont. Zumal Mommsen weist eindringlich nach, in welcher Weise leitende Gesichtspunkte (metatheoretische Fragestellungen) unvermeidbar in den Erkenntnisprozess einspielen. Er folgert daraus, daß die Prämissen offengelegt und gegenüber einer intersubjektiven Überprüfung offen bleiben müssen (dtv WR 4281, 444f.); Annette Kuhn zitiert Kocka mit dem Satz: "Aussagen über die Vergangenheit sind von Einschätzungen der Gegenwart und von Stellungnahmen zur wünschenswerten Zukunft durchsetzt" (Schörken 1978, 123).
Wie Rohlfes sagt, entstehen historische Sachverhalte "aus den Fragen der Historiker an die historische Überlieferung, sind also nicht die vergangene Wirklichkeit selbst". Er fährt dann fort: "Ebensowenig sind sie beliebige Konstrukte, die ihr Dasein lediglich gegenwärtigen Erkenntnisinteressen verdanken. Solche Erkenntnisinteressen sind zwar der Rahmen, innerhalb dessen das historische Material ausgewählt, analysiert, interpretiert und bewertet wird, aber wie dieser Rahmen ausgefüllt wird, das liegt nicht mehr in der Reichweite des Erkenntnisinteresses, sondern hängt allein von den Aussagen des zur Verfügung stehenden Erkenntnismaterials ab - zumindest innerhalb eines Wissenschaftsverständnisses, dem Objektivität eine Tugend und nicht ein Aberglaube ist" (Schörken 1978, 24).
In dieser Konzeption werden die Perspektiven, - die Prämissen für die Wertungen - in den Optionen formuliert. Didaktisch fungieren die Optionen in beiden Fächern:
- als Ergebnisse der Geschichte, hinter die wir nicht zurückfallen dürfen;
- als Ziele, denen durch Politik und Erziehung Geltung verschafft werden muss;
- als Inhalte (die freilich, wenn sie nicht Leerformeln bleiben sollen, nicht irgendwann [/S. 244] einmal zu vermitteln bzw. zu lernen sind, sondern die immer wieder an konkreten historischen und gegenwärtigen Situationen thematisiert werden müssen, indem ihre Konsequenzen für menschenwürdiges Überleben verdeutlicht werden);
- und damit vor allem: als Wertperspektiven, die bei Antworten auf Fragen an historische und gegenwärtige Entwicklungen und Ereignisse angelegt werden.
3. (Kernthese) Kooperation wird vor allem dadurch hergestellt, dass man an Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft im Geschichtsunterricht und im politischen Unterricht grundsätzlich gleiche, zumindest vergleichbare Fragen richtet. Im gesellschaftswissenschaftlich-politischen Bereich geht es um systematische Antworten als Voraussetzung für eine schärfere Erfassung von Zusammenhängen; im historischen Bereich geht es um Antworten, mit deren Hilfe sich der Schüler in die Vielfalt, Eigenständigkeit und Widerständigkeit historischer Situationen hineinleben kann.
2.5.3 Vorschläge für didaktische Leitfragen für die Kooperation
Die Leitfragen sollen dazu dienen, Einzelfragen und Unterrichtsgegenstände so auszuwählen und zu gewichten, dass sie als Antwort auf Probleme von allgemeiner Bedeutung erkannt werden können. Mit ihrer Hilfe können geschichtliche, erdkundliche und Themen der politischen Bildung als verschiedene Aspekte gleicher Fragestellungen begriffen werden. In ihrer allgemeinen Form zielen sie auf Überleben und menschenwürdiges Leben ab; ihre Beantwortung soll für die Bewältigung (für Erkennen, Urteilen, Handeln) von und in Situationen qualifizieren, von denen Schüler subjektiv und objektiv betroffen sind. So gesehen lassen sich alle Themenbereiche der drei Fächer in vier zentrale Themen- bzw. Fragenkomplexe gliedern:
- Erarbeitung, Sicherung, Verbesserung des Lebensunterhaltes
In welcher Weise und in welchem Ausmaß waren/sind Menschen je von der Natur abhängig? Wovon und von wem hing/hängt es ab, ob Bedürfnisse befriedigt werden können? - Verteilung von Eigentum und Macht; Regelungen des Zusammenlebens
Wie waren/sind Eigentum, Besitz, Macht, Ansehen verteilt? Wie kamen/kommen verbindliche Entscheidungen zustande? Wie wurden/werden sie durchgesetzt? Gab/gibt es Rechte der Person? für alle? - Austrag von Konflikten
Wie (mit welchen Mitteln) wurden/werden Konflikte ausgetragen? Welche Regelungen gab/gibt es dafür? - Rechtfertigung, Sinngebung, Normen; Möglichkeiten und Formen menschlicher Kommunikation
Wie wurde/wird die staatlich gesellschaftliche Ordnung begründet, gerechtfertigt, infrage gestellt? Wie wurde/wird die Frage nach dem Sinn des Daseins beantwortet? Wie erhielten/erhalten die Menschen Informationen?
Schon diese allgemeinen Fragen können sowohl auf historische als auch auf gegenwärtige Themen, Situationen und Probleme angewendet werden, einschließlich der politisch bedeutsamen geographischen Themen. [/S. 245]
Für die Geschichte lassen sie sich weiter konkretisieren, indem zum Beispiel gefragt wird:
- Zu 1.:
Welche Fortschritte in der Beherrschung der Natur wurden erzielt? Auf Kosten welcher Gruppen? Welche Einbussen waren damit verknüpft? Welche Abhängigkeiten wurden vermindert, vermehrt? - Zu 2.:
Welche Fortschritte bei der Überwindung von sozialen Ungleichheiten, bei der Sicherung der Personrechte, der Lösung von Problemen der Daseinsvorsorge wurden zu jener Zeit erzielt? Welche Gruppen waren daran beteiligt? - Zu 3.:
Welche Regelungen/Institutionen gab es für den Austrag von Konflikten zwischen Gruppen? Zwischen Völkern? - Zu 4.:
Welche Begründungen dienten der Aufrechterhaltung der jeweiligen Ordnung? Mit welchen Gründen wurde sie infragegestellt? Welche Möglichkeiten hatten die Menschen (hatten Gruppen) sich zu informieren?
In der Politischen Bildung wird in Bezug auf die Beteiligung an zustimmungswürdigen Entscheidungen zusammengebracht, was in den sozialwissenschaftlichen Disziplinen, aber auch in den Fächern Geschichte (zeitlich) und Erdkunde (räumlich) getrennt erscheint. Im Zusammenhang mit Situationen kann gefragt werden:
- Zu 1.:
Welche langfristigen Lösungen sind angesichts des Widerspruchs zwischen technisch Möglichem einerseits und Ressourcenknappheit, Umweltbelastung, Stress in Arbeit und Freizeit anderseits zustimmungswürdig? - Zu 2.:
Welche Möglichkeiten der Beteiligung sind in einer konkreten Situation gegeben? Müssten neue geschaffen werden? Trägt diese mögliche Lösung dazu bei, Freiheit der Person, soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit zu fordern? Welche politische Aufgabe bleibt ungelöst, weil sie nicht erkannt wird? weil Gruppen die Macht besitzen, ihre Lösung zu blockieren? Was können Einzelne, Gruppen und Staat zur Lösung beitragen? - Zu 3.:
Welche Möglichkeiten bestehen in einem konkreten Konflikt, vernünftige Lösungen gewaltfrei durchzusetzen? Welche müssten geschaffen werden? - Zu 4.:
Wie lässt sich durch Aufklärung und Information bewirken, was früher durch unmittelbare Erfahrung in Gang gesetzt wurde?
Ein zweiter (zangenartiger) Frageansatz dient dazu, die Themen (Probleme), historische und gegenwärtige Inhalte und die Situation der Schüler bei der Planung und im Unterricht miteinander in Verbindung zu bringen:
Es wird gefragt:
- von der jeweiligen historischen Situation aus:
Welche Probleme, die Menschen damals beschäftigten, die sie damals zu lösen hatten, spielen heute (und - so weit wir wissen - voraussichtlich auch morgen) eine wichtige Rolle?
Welche damaligen Probleme sind durch die Entwicklung überholt?
Welche Lösungen müssen aufgrund neuer Bedingungen anders lauten?
Welche damaligen Ansätze sind verkümmert?
Welche Probleme wurden in zustimmungsfähiger Weise gelöst? - von gegenwärtigen Situationen und Problemen aus:
Für welche dringenden gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit enthält die jeweilige historische Epoche Vergleichbares? [/S. 246]
Wo zeigen sich Veränderungen, Unterschiede?
Wodurch sind sie hervorgerufen worden? - von den Lernenden aus:
Bei welchen vergangenen und gegenwärtigen Problemen kann eine primäre (unmittelbare, subjektive) Betroffenheit bei Schülern vorausgesetzt werden?
Bei welchen Problemen muss der Zusammenhang zwischen vergangenen und gegenwärtigen Tatbeständen einerseits und existentieller Betroffenheit andererseits didaktisch erst bewusst gemacht werden?
Leitfragen für die Erdkunde lassen sich nicht durchgängig auf alle erdkundlichen Themen anwenden.
Mit dem Begriff "Daseinsgrundfunktionen" (Essen, Sich Kleiden, Wohnen) kann gefragt werden, inwieweit diese Funktionen je von klimatischen, räumlichen Bedingungen abhängig sind. Aber diese Fragestellung greift zu kurz, wenn nicht zugleich nach den historischen und politischen Bedingungen für die Entwicklung der räumlichen Faktoren gefragt wird. Daneben ist aufzuzeigen, dass in der Erdkunde als gleichzeitig, aber räumlich getrennt, erfahren werden kann, was historisch "ungleichzeitig" ist.
Für die Kooperation der Fächer Erdkunde und Politische Bildung kann gefragt werden:
- Von der Erdkunde aus:
Welche räumlichen Bedingungen sind den bei uns herrschenden vergleichbar? Welche Folgen haben Eingriffe in die Natur für uns? Welche Lösungen, die dort entwickelt worden sind, können eine Hilfe für die Beurteilung und Lösung unserer Probleme leisten? - Von unserer Situation aus:
Wie lässt sich regionale Disparität (zwischen Regionen innerhalb unseres Landes, Europas, der Welt) ausgleichen? Welche unserer politischen Formen und welche Wertvorstellungen können auch von anderen Völkern anerkannt werden? unter welchen Bedingungen?*
2.5.4 Beispiel zum Gegenwartsbezug historischer Themen
Hierzu das Protokoll eines Sozialwissenschaftlers, der ein Praktikum betreute:
"Es handelt vom Probeunterricht einer Studentin in einer Dorfschule, den der Verfasser als 'Tutor' miterlebte. Das Stundenthema lautete: Albrecht der Bär besiedelte die Mark Brandenburg. Die Studentin berichtete, wie Albrecht der Bär Siedler ins Land holte, das 'menschenleer' war. Die Siedler kamen aus übervölkerten westlichen Gauen des Reiches; die Studentin erzählte, wie in diesen Gauen die Bauern ihre kinderreichen Familien kaum mehr ernähren konnten und wie dann die jüngeren, landlosen Söhne in die Weiten des freien Ostens aufbrachen. Der Verfasser griff ein und fragte, wie man denn eigentlich heute mit dem Problem fertig werde. Verblüfftes Schweigen. Aber auf weitere Fragen kam dann - wie zu erwarten - zutage, dass die meisten Väter der Kinder dieses Dorfes nicht mehr in der Landwirtschaft, sondern in der nahegelegenen Stadt arbeiteten. Und schließlich brachten die Kinder heraus: "Wir lösen das Problem nicht mehr, indem wir neues Land erobern, sondern durch neue Arbeitsplätze in der Industrie."
Darauf folgte noch eine Frage: Wie ist es nun aber in den Ländern, wie beispielsweise Indien, das gerade im Erdkundeunterricht behandelt worden war, in denen das Land auch nicht mehr für die vielen Menschen ausreicht, in denen es aber noch so gut wie keine Industrie gibt? Die Kinder diskutierten die Frage und kamen nun selbst zu dem Ergebnis, dass nur drei Möglichkeiten bestehen:
- Hunger und Seuchen begrenzen die Bevölkerung.
- Man führt einen Eroberungskrieg gegen die Nachbarn, um neues Land zu gewinnen.
- Das Gebiet wird so schnell wir möglich wirtschaftlich entwickelt" ( Krockow 1969, 30).
Es wird deutlich, 1., dass es sich beim Dozenten nicht etwa um einen methodischen Vorsprung [/S. 247] handelt, sondern darum, dass er als didaktisch denkender Sozialwissenschaftler die historische Situation auf eine fundamentale Erkenntnis hinbezieht; und 2., dass dieses Beispiel zugleich zum Transfer anregt:
Der Sachverhalt, dass sich durch Technisierung, durch "Massenproduktion", Bedingungen des Lebens im Raum verändert haben, lässt sich auf andere Situationen übertragen.
2.5.5 Weitere Instrumente
"Abhängig - wovon und von wem?"
Hier wird die fundamentale Erkenntnis systematisiert, dass anstelle der Abhängigkeit von den natürlichen Bedingungen zunehmend - und heute im besonders hohen Maße - die von den Mitmenschen, von den Vorkehrungen der Gesellschaft getreten ist.
Es geht darum, die Vorstellung vom "Volk ohne Raum" (H. Grimm) als Irrtum zu enthüllen. Tolstois Erzählung "Wieviel Erde braucht der Mensch" kann ergänzend gelesen werden.
| Sammler und Jäger | Ackerbau | Ägypter | heute | |
| Nahrung | Geschichtlichkeit "Jagdgründe" Zufall |
genügend Boden Vieh Ungestörtheit |
Ausbau der Kanäle und Dämme - Wetter und Wasserstand (Vorratshäuser) |
funktionierender Handel und Transport in der ganzen Welt |
| Kleidung | erlegte Tiere mit geeignetem Fell | Arbeitskraft, Zeit für die Webarbeit Geräte |
Anspruch auf die Erzeugnisse der Handwerker durch Arbeit - nur wer zum Dorf gehörte, bekam etwas |
Kleidung wird maschinell hergestellt; immer mehr kaufen nicht, was sie brauchen, sondern was "modisch" ist |
| Wohnung | natürliche Gegebenheiten, z. B. Höhlen | jede Familie erbt oder baut sich ihr Haus | Wer in der Dorfgemeinschaft mitarbeitet, erhält Bauplätze | immer mehr Eigenheime, aber immer noch in den Städten am meisten Miet-Wohnungen |
| Gefahren | jeder aus einer anderen Sippe ist "Feind" | Eroberervölker (Nomaden) | lange Zeiten ohne äußere Gefahren | jeder Krieg - Diktatur - aber auch Verkehr |
| Wünsche | auf die Urbedürfnisse beschränkt für wenige werden Schmuck, Wohnkultur, kunstvolle Gegenstände möglich | |||
Die Voraussetzung einer nur von den gesellschaftlichen Bedingungen abhängigen Produktion muss relativiert werden, und zwar im Bezug auf die Erde als Ganzes. Das verlangt in der Tabelle eine neue Spalte. In dieser Spalte Morgen muss sich bei allen in der Waagerechten aufgeführten Bedürfnissen die Begrenztheit der Ressourcen und die Gefährdung des Ökosystems niederschlagen. [/S. 248]
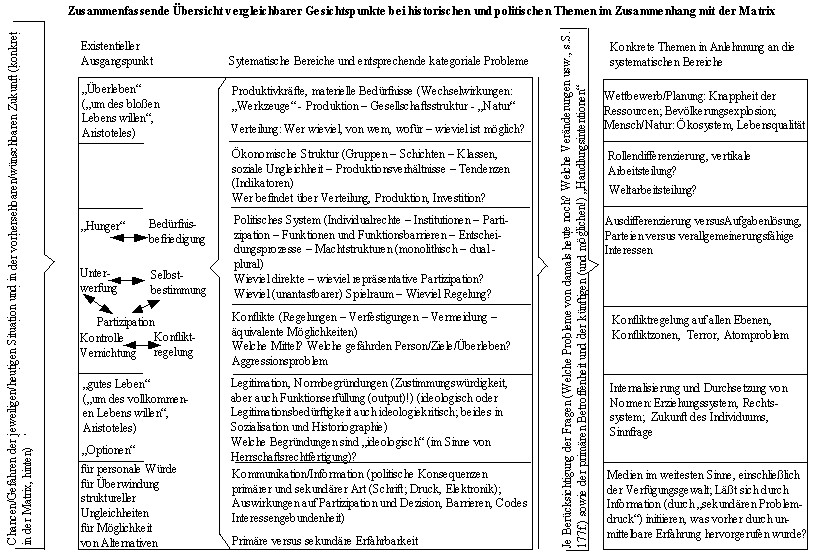
2.5.6 Literaturhinweise
- Benutzte Literatur
Beyme, Klaus von (1970): Die parlamentarischen Regierungssysteme in Europa. München: Piper.
Hilligen, Wolfgang (1981): Zur Kooperation von Geschichte und Politischem Unterricht. In: 25 Jahre Politische Bildung in Hessen. Protokoll Nr. 06/103/1981 des Hess. Instituts für Lehrerfortbildung.
Hilligen, Wolfgang (1976): Zum Verhältnis von Geschichte und Sozialkunde. In: Zur Didaktik des politischen Unterrichts II. Schriften 1950-1975, kommentiert 1975. Ein Supplement. Opladen: Leske, Seite 165-188.
Krockow, Christian von (1969): Sozialwissenschaften, Lehrerbildung und Schule. Opladen: Leske.
Markl, Hubert (1980): Ökologische Grenzen und Evolutionsstrategie Forschung. In: Mitteilung der DFG (3); in einer verkürzten Fassung in: FAZ, Dezember 1980.
Mickel, Wolfgang (Hg.) (1979): Politikunterricht im Zusammenhang mit seinen Nachbarfächern. Mit Beiträgen von Behrmann, Böttcher, Cube, Grosser und Sutor, München: Ehrenwirth.
Mommsen, Wolfgang J. (1977): Der perspektivische Charakter historischer Aussage und das Problem von Parteilichkeit und Objektivität historischer Erkenntnis. In: Koselleck, Reinhart (Hg.): Objektivität und Parteilichkeit in der Geschichtswissenschaft. München: dtv, WR 4281.
Schörken, Rolf (Hg.) (1978): Zur Zusammenarbeit von Geschichts- und Politikunterricht. Anmerkungen und Argumente 20. Stuttgart: Klett.
Schörken, Rolf (1977): Der lange Weg zum Geschichtscurriculum. In: Geschichtsdidaktik, Jg. 2 ( 3-4).
Tibi, Bassam (1980): Akkulturation und interkulturelle Kommunikation. Ist jede Verwestlichung kulturimperialistisch? In: Gegenwartskunde/GSE. Jg. 29 (2). Seite 173-189.
- Neuere Schriften zur Didaktik der Geschichte
Die Geschichtsdidaktik hat im vergangenen Jahrzehnt (im Vergleich zur Entwicklung der Didaktik des Politischen Unterrichts: etwa ein Jahrzehnt verspätet) eine neue Entwicklung genommen. Einige wichtige Schriften:
Behrmann, Günter; Jeismann, Karl-Ernst; Süssmuth, Hans (1978): Geschichte und Politik. Didaktische Grundlegung eines kooperativen Unterrichts (Studien zur Didaktik, B. 1) Paderborn: F. Schöningh.
Bergmann, Klaus; Kuhn, Annette; Rüsen, Jörn; Schneider, Gerhard (Hg.) (1979): Handbuch der Geschichtsdidaktik. Bd. 1 und 2. Düsseldorf : Schwann.
Bergmann, Klaus; Rüsen, Jörn (Hg.) (1978): Geschichtsdidaktik: Theorie für die Praxis. Düsseldorf: Schwann.
Kuhn, Annette (1974): Einführung in die Didaktik der Geschichte. München: Kösel.
Kuhn, Annette; Rothe, Valentine (1980): Geschichtsdidaktisches Grundwissen. Ein Arbeits- und Studienbuch. München: Kösel.
Mayer, Ulrich; Pandel, Hans-Jürgen (1976): Kategorien der Geschichtsdidaktik und Praxis der Unterrichtsanalyse. Anmerkungen und Argumente 13. Stuttgart: Klett.
Süssmuth, Hans (Hg.) (1973): Historisch-politischer Unterricht. Stuttgart: Klett.
2.5.7 Anmerkungen
* Formuliert in Analogie zu Kants Aussage: Anschauung ohne Begriffe ist blind, Begriffe ohne Anschauung sind leer.
* Auf die Tragfähigkeit des existentiellen Ansatzes bei Chancen und Gefahren für den Geschichtsunterricht hat Rolf Schörken (1977, 344) nachdrücklich hingewiesen.
* Zu dieser schwierigen Frage vgl. Bassam Tibi: Akkulturation und interkulturelle Kommunikation. Ist jede Verwestlichung kulturimperialistisch? In: Gegenwartskunde/GSE, Jg. 29 (2), 1980, 173ff.
Pandel, Hans-Jürgen (1987): Dimensionen des Geschichtsbewusstseins. Ein Versuch, seine Struktur für Empirie und Pragmatik diskutierbar zu machen
Der extensive Gebrauch des Begriffs Geschichtsbewusstsein in der politisch-publizistischen Alltagspraxis wie in der Geschichtsdidaktik täuscht über den geringen Grad seiner theoretischen Elaboriertheit. Diese Tatsache macht es notwendig, sich einmal näher damit zu beschäftigen, was gegenwärtig unter Geschichtsbewusstsein genauer zu verstehen ist. Die aktuelle Diskussion um "Endlagerung des Faschismus" und "Geschichte als Schadensabwicklung" sowie der zunehmend erneute Gebrauch von historischen Gesten und Ritualen verlangt Aufklärung über die Struktur des Geschichtsbewusstseins. Ich sehe noch nicht, dass in der Geschichtsdidaktik ein konsensfähiger Begriff von Geschichtsbewusstsein besteht. Wir müssen aber ein gewisses Vorverständnis haben, welche Momente eigentlich jene Struktur ausmachen, die wir Geschichtsbewusstsein nennen, um seine Wirkungsweise erklären zu können. Erst danach können wir drei Aufgabengebiete der Bewusstseinsforschung erfolgreich angehen: empirische Forschung, Geschichtsschreibung und geschichtsdidaktische Pragmatik. Wir können dann eine "Morphologie" (Jeismann) des gegenwärtigen Geschichtsbewusstseins erstellen sowie eine Zeitgeschichte der Mentalitäten schreiben. Diese empirischen Aufgaben - wohl die wichtigsten der Geschichtsdidaktik - werden die Grundlage dafür darstellen können, geschichtsdidaktisch begründet handeln zu können. Eine geschichtsdidaktische Pragmatik, d. h. eine geschichtsdidaktische Handlungstheorie, wird aber nicht so lange warten können, sondern wird gleichzeitig ansetzen müssen. Aus diesem Grund wäre eine Diskussion um die Struktur von Geschichtsbewusstsein dringend erwünscht.
1. Normativität, Komparatistik, Transformation
a) Ein solcher Versuch, der eine Dimensionierung des Geschichtsbewusstseins vornimmt, um seine Struktur zu erkennen, muss sich dem Problem der Normativität stellen. Er muss sagen und auch "fest"-legen, was er als Geschichtsbewusstsein ansehen will. Es wäre ein problematisches Verständnis, nur eine bestimmte Ausformung von Geschichtsbewusstsein allein als Geschichtsbewusstsein anzusprechen, an dem dann alle anderen Formen gemessen werden, ob sie auch orthodox genug seien, um als Geschichtsbewusstsein approbiert zu werden. Diesen dogmatischen Umgang finden wir im politisch-publizistischen Alltag. Wenn einer beim anderen nicht die Bewusstseinselemente seines eigenen Geschichtsbewusstseins wiederfindet, so wird ihm fehlendes oder mangelndes Geschichtsbewusstsein unterstellt. Eine nichtnormative Theorie des Geschichtsbewusstseins, die sowohl für Zwecke der empirischen Forschung wie auch für eine geschichtsdidaktische Pragmatik brauchbar ist, muss auf der einen Seite sehr wohl bestimmen, welche Bewusstseinsformen sie als Geschichtsbewusstsein ansprechen will, auf der anderen Seite darf sie aber doch nicht in dem Sinne normativ verfahren, dass sie nur bestimmte Ausformungen für "richtiges" Geschichtsbewusstsein hält und alle anderen vorfindbaren Erscheinungsformen als nicht vorhandenes oder als falsches Geschichtsbewusstsein ausgibt. Eine Theorie von Geschichtsbewusstsein muss deshalb eine kategoriale Verfasstheit von Geschichtsbewusstsein ausweisen, um Geschichtsbewusstsein empirisch als Geschichtsbewusstsein zu identifizieren und um einen Vergleich zwischen verschiedenen Ausformungen von Geschichtsbewusstsein anstellen zu können.
b) Eine solche Strukturbestimmung, die sich des Problems der Normativität bewusst ist, lässt dann auch vergleichende Forschung möglich werden. Komparatistik ist deshalb notwendig, weil Geschichtsbewusstsein in Pluralität erscheint. Wir wissen, dass Geschichtsbewusstsein sozialisationsabhängig ist. Das alltäglich-vorschulische und außerschulische Geschichtsbewusstsein ist gleichfalls sozialisationsabhängig. Ob es das ausschließlich ist, versucht von Borries in diesem Heft zu erörtern. In den verschiedenen sozialen und historischen Kontexten, den nach sozialen Schichten und parteipolitisch geprägten Gruppen ausgerichteten Lebenswelten, verläuft historische Sozialisation ebenso unterschiedlich wie in verschiedenen historischen Regionen. Wir sprechen sogar von regionalem Geschichtsbewusstsein. Geschichtsbewusstsein erscheint in verschiedenen Ausprägungen. Will man diese unterschiedlichen Ausprägungen nicht im Sinne einer Defizithypothese interpretieren, nach der immer etwas "fehlt", so müsste die Andersartigkeit abgeleitet und plausibel gemacht werden.
Auch die Annahme, dass die verschiedenen Formen von Geschichtsbewusstsein nicht defizitäre Formen sind, sondern nur anders, aber prinzipiell gleichwertig, löst das Problem nicht, sondern wertet nur die verschiedenen pluralen Formen. Wenn man von Ausprägungen spricht, so impliziert das, dass es gewissermaßen eine ursprüngliche Form gibt, die sich in unterschiedliche Formen ausfaltet. Dieser Gedanke legt nahe, dass man hinter den aktuellen Erscheinungsformen die "ursprüngliche" Form wiederfindet.
Das jeweils konkrete und individuelle Geschichtsbewusstsein wäre dann immer nur eine Aktualisierung aus einem Gesamtpotential der möglichen kategorial verfassten Strukturierungen. Das "nur" soll allerdings nicht bedeuten, dass das individuelle Geschichtsbewusstsein hinter irgendeinem hehren, umfassenden, normativ aufgefassten Geschichtsbewusstsein zurückbleibt, wie die Performanz hinter der Kompetenz. Das "nur" bedeutet vielmehr, dass Geschichtsbewusstsein als ein individuelles immer in Individualität erscheint und nicht als ein allgemeines in seiner Abstraktheit. Unser Sprachgebrauch führt uns dabei in die Irre. Es existiert in der Sprache nur die Singularform von Geschichtsbewusstsein, keine Pluralform. Wenn wir im Plural von Geschichtsbewusstsein reden, dann sprechen wir immer von Formen des Geschichtsbewusstseins. Die Sprache legt uns somit das Geschichtsbewusstsein nahe; die Empirie findet es aber nur als Pluralität vor. Aus diesem scheinbaren Widerspruch kommen wir nur schwer heraus. Wir müssen das konkrete Geschichtsbewusstsein immer nur als einen Ausschnitt aus der potentiellen Kategorialität auffassen, die zugrunde gelegt werden muss, wenn die individuellen und verschiedenen Formen von Geschichtsbewusstsein trotz aller Unterschiedlichkeit als "Geschichtsbewusstsein" identifiziert werden sollen.
c) Geschichtsbewusstsein äußert sich nicht nur im Erzählen, sondern auch im Umerzählen von Geschichten. Geschichten werden immer in unterschiedlichen Graden in andere Geschichten transformiert, ohne dass dabei die Ausgangserzählung unkenntlich wird. Geschichtstheoretisch und geschichtsdidaktisch gesehen, brauchen wir Angaben, die uns erklären, warum Geschichten nicht nur unterschiedlich erzählt, sondern auch umerzählt werden. Ein solches Veränderungsbedürfnis finden wir schon auf der lebensgeschichtlichen Ebene. Ein und dieselbe Ereignisfolge wird von unterschiedlichen Menschen auch unterschiedlich erzählt. Sie bedienen sich unterschiedlicher Relevanzstrukturen und Erzählpläne, die unterschiedliche Geschichten produzieren.
Ohne es an dieser Stelle ausführlich begründen zu können, gehe ich davon aus, dass Geschichtsbewusstsein mit "Erinnern" nichts zu tun hat. Formal gesehen ist Geschichtsbewusstsein eine narrative Kompetenz. Sie besteht in der Fähigkeit, Geschichte zu erzählen und zu verstehen. Die Geschichte (bzw. die Geschichten), die wir uns erzählen und die wir als erzählte verstehen, hat einen anderen Status als die Geschichte, in die wir im Alltag verstrickt sind. Die Geschichte(n) erfahren wir nicht, sondern sie werden tradiert, erzählt: Wir erinnern uns nicht an sie, sondern sie werden uns in einer kulturellen Kommunikation überliefert.
"'Kulturelle Kommunikation' ist eine Information, die man nicht durch direkte Beobachtung (Sinnesdaten) erhalten oder aus ihr ableiten kann: sie geht notwendigerweise von einem Bewusstsein zu einem anderen über" (Devereux 1984a: 279).
Diese Tradierung von Bewusstsein zu Bewusstsein schließt nicht schon ein, dass die Geschichte, die erzählt wird, die gleiche bleibt. Obwohl die gehörte Geschichte nur als erzählte Geschichte - nicht als erlebte Geschichte - angeeignet wird (wir also nicht über unterschiedliche Erfahrungsdaten verfügen), wird sie so transformiert, dass wir annehmen, sie sei erst jetzt "richtiger" geworden. Wir haben es also mit der Tatsache zu tun, dass nicht nur erlebte Ereignisfolgen von unterschiedlichen Menschen verschieden erzählt werden, sondern auch die gleiche tradierte Geschichte wird unterschiedlich erzählt. Geschichtsbewusstsein äußert sich also nicht nur in erzählten Geschichten, sondern auch im Transformationsbedürfnis an erzählten Geschichten.
2. Dimensionierung
Auf das einzelne Individuum bezogen ist Geschichtsbewusstsein eine individuelle mentale Struktur, die durch ein System aufeinander verweisender Kategorien gebildet wird. Dieses kognitive Bezugssystem wird im Prozess des Sprachlernens erworben (1). Die durch (direkte wie durch kommunikative) Erfahrung geformte mentale Struktur ist für die Art und Weise verantwortlich, wie eine Geschichte erzählt wird, welche Perspektiven gewählt, wie das Verhältnis von oben und unten, von arm und reich gesehen wird, ob Verhältnisse generell statisch oder veränderbar gesehen werden.
Ich möchte vorschlagen, Geschichtsbewusstsein als eine mentale Struktur zu bezeichnen, die aus sieben aufeinander verweisende Doppelkategorien besteht. In dem Maße, in dem das Kind diese grundlegenden Kategorien ausdifferenziert, erwirbt es jenes kognitive Bezugssystem, ohne das es weder Geschichte verstehen noch Geschichte erzählen könnte.
Diese Kategorien sind:
- Zeitbewusstsein (früher- heute/morgen) Wirklichkeitsbewusstsein (real/historisch imaginär)
- Historizitätsbewusstsein (statisch - veränderlich)
- Identitätsbewusstsein (wir - ihr/sie)
- politisches Bewusstsein (oben - unten)
- ökonomisch-soziales Bewusstsein (arm - reich)
- moralisches Bewusstsein (richtig - falsch)
Dem jeweiligen Geschichtsbewusstsein des einzelnen Individuums liegt eine individuelle mentale Strukturierung aus diesen Kategorien zugrunde. Dieses kognitive Bezugssystem, das das Geschichtsbewusstsein ausmacht, wird durch Entwicklungserfahrungen gebildet. In diesen Entwicklungserfahrungen wird die mentale Struktur des Individuums ausgebildet.
In welcher Reihenfolge und in welcher Gleichzeitigkeit diese einzelnen Kategorien erworben werden, wissen wir noch nicht. Wir können sie aber in drei Basiskategorien und vier soziale Kategorien einteilen, ohne damit schon eine Präferenz in den individuellen Lernprozessen anzugeben. Die drei fundamentalsten Differenzierungen dieser mentalen Strukturierung, die allen anderen vorausliegen, bestehen in der Fähigkeit, die Prädikate "früher" und "heute" (bzw. "morgen"), "real" und "imaginär" sowie statisch -veränderlich/veränderbar (sein - werden) korrekt zu verwenden. Natürlich werden die Orientierungsbegriffe nicht ausschließlich nacheinander erworben, sondern auch gleichzeitig. Dennoch wird es Hierarchien geben: Erst wenn Fiktion und Realität geschieden sind, kann aus dem Märchenerzählen ein historisches Erzählen werden. Für dieses historische Erzählen sind dann die Kategorien Identitätsbewusstsein, ökonomisch-soziales Bewusstsein, politisches Bewusstsein und moralisches Bewusstsein maßgeblich.
Die vier letzten Dimensionen beziehen sich auf die Komplexität von Gesellschaft. Geschichtsbewusstsein umfasst ein strukturiertes Wissen über Veränderung von jeweils konkret und spezifisch organisierten Gesellschaften in der Zeit. Veränderungen von Gesellschaft als Bewusstseinsinhalt beschreibt nicht nur Veränderungen in der Zeit, sondern auch was sich in der Gesellschaft strukturell verändert und was nicht - ob sich z. B. die politische Stratifikation verändert bzw. verändern kann oder ob es überhaupt wünschenswert ist, dass sie sich verändert.
Die Ausbildung dieser dimensionierten Doppelkategorien in der Lebensgeschichte ergibt jene individuelle mentale Strukturierung, die wir Geschichtsbewusstsein nennen können. Das bedeutet allerdings nicht, dass es ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein im Sinne eines bewussten Seins sein muss. Es muss sich nicht um ein durchdachtes moralisches Bewusstsein oder um ein konkretes Herrschaftsbewusstsein handeln. Moralisches Bewusstsein wie auch politisches Bewusstsein kann sich in moralischem Relativismus wie in politischer Apathie äußern. Dennoch ist eine Kategorisierung der Bereiche moralisches Bewusstsein und Herrschaftsbewusstsein vollzogen.
2.1 Zeitbewusstsein
Die grundlegende Kategorie, sowohl im zeitlichen wie auch im allgemein-kategorialen Sinne, dürfte für das Erlernen von Geschichte die Unterscheidung der Zeitmodi (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft; gestern - heute - morgen) darstellen (2).
Die ältere Geschichtsdidaktik und -methodik hat viel Energie darauf verwandt, diese Kategorien zu vermitteln. Der Erfolg solcher Bemühungen ist nachweislich auch nicht größer gewesen als jene Bemühungen, die nicht so sehr auf Zeit und Datierung fixiert waren. Diese Bemühungen vergaßen in der Regel einen zentralen Punkt, dass erst in der Kombination mit anderen Kategorien Zeit für das Lernen von Geschichte einen Wert hat. Die Isolierung und Abstrahierung von anderen Kategorien entkleidet Zeit gerade des historischen Charakters. Das Pauken von Zahlen, die Arbeit am Zeitstrahl etc. waren weniger Arbeit mit historischer, sondern mit biologischer und kalendarischer Zeit. Wenn d) Geschichte als Prozess Veränderung in der Zeit ist, darf dieser Fluss nicht wieder in einzelne Fixpunkte von datierbaren Fakten "fest"-gestellt werden. Eine Fixierung auf datierbare Ereignisse übersah langsam ablaufende Prozesse und langdauernde Strukturen. Sie blieb vorwiegend auf der Ebene der Ereignisgeschichte verhaftet, d. h. sie hatte diplomatiegeschichtlichen, besonders außenpolitischen Charakter.
Der Ausgangspunkt für das Denken in den verschiedenen Zeitmodi ist die lebensweltliche Wahrnehmung der Zeitlichkeit von Erfahrung und Handeln. Sprachlich drückt sich Zeitbewusstsein in der Fähigkeit aus, Ereignisse mit den Begriffen "gestern" "heute" und "morgen" zu versehen. Zeitbewusstsein als Dimension von Geschichtsbewusstsein leistet aber mehr als die zeitliche Lokalisierung (die Temporalisierung) von Ereignissen. Zeitbewusstsein als Komponente von Geschichtsbewusstsein konkretisiert sich darüber hinaus in vier Hinsichten:
- Zeitbewusstsein beinhaltet die Vorstellung von der Dichtigkeit der Ereignisse in der Zeit. Das jeweils konkrete und individuelle Zeitbewusstsein drückt sich darin aus, dass es bestimmte historische Epochen mit mehr Ereignissen und in kürzeren Abständen besetzt hat als andere. Für manche Zeitepochen verfügt das Individuum über ein Wissen von der Existenz vieler bzw. weniger Ereignisse (3).
- Die zweite Komponente bezieht sich auf die Länge der Zeitausdehnung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es geht hier um die Frage, wie weit das Geschichtsbewusstsein in die Vergangenheit zurück und in die Zukunft vorausdenkt. Auch die zeitliche Erstreckung von Gegenwart steht hier zur Debatte. Im zeittheoretischen Sinne kann Gegenwart zwar als ausdehnungsloser "Punkt" angesehen werden. Individuen erleben Gegenwart aber sehr wohl in einer zeitlichen Erstreckung, deren Ausdehnung herauszufinden wäre.
- Die dritte Komponente bezeichnet die Akzentuierung der Zeitdimensionen. Gesellschaften in bestimmten historischen Situationen und Epochen betonen immer eine Zeitdimension, bevorzugen sie vor den anderen und halten diese für wichtiger, um ihre eigene Lage zu deuten. Auch Individuen argumentieren mehr vergangenheits-, gegenwarts- oder zukunftsbezogen (4).
- Die vierte Komponente ist die Narrativierung von Zeit und meint die Umgliederung von wahrgenommenen und gelernten Ereignissen, wenn sie in eine Geschichte eingehen. Narrativierung von Zeit ist die Transformation der Chronik der wahrgenommenen und gelernten Ereignisse in eine narrative Chronologie. Man kann die Ursachen eines Ereignisses zeitlich nach der Wirkung erfahren und dennoch durch zeitliche Umgruppierung eine Geschichte nach Ursache und Wirkung erzählen. Die chronologische Reihenfolge, in der die Ereignisse wahrgenommen werden (indirekt oder kommunikativ), wird von uns in der Weise verändert, dass damit eine sinnvolle Geschichte entsteht. Über eine solche narrierende Umgruppierung von Zeit liegen allerdings noch keine gesicherten empirischen Ergebnisse vor.
2.2 Wirklichkeitsbewusstsein
Die zweite Grundorientierung besteht darin, Personen und Handlungen die Prädikate "real" und "imaginär" zuzusprechen (Prentice 1978). Dass es Personen und Handlungen (in der Sprache) gibt, die erfunden (fiktiv) sind (Rotkäppchen, Asterix etc.), muss das Kind erst lernen. Vermutlich geht das Kind zuerst von der Existenz von (sprachlich verfügbar gemachten) Personen und Handlungen aus und lernt erst dann mühsam, Existenzvorbehalte zu machen. Wenn es schon mit Existenzvorbehalten umgehen kann, muss es sich öfter der Existenz von Personen und Sachverhalten fragend versichern. So einfach ist es mit historischen Personen nicht. Sie lassen sich nicht nach der Dimension "gibt es" und "gibt es nicht" differenzieren. Historische Ereignisse (Personen, Dinge, Sachverhalte) sind nicht "nicht-existierende", sondern nur gegenwärtig "nicht mehr" existierende Ereignisse.
Diese Ausdifferenzierung von gegenwärtigen, imaginären und historischen Personen und Ereignissen vollzieht sich im Zusammenhang mit der Ausdifferenzierung von Zeit in den Zeitdimensionen Vergangenheit und Gegenwart.
Lebensgeschichtlich muss die Nicht-Existenz imaginärer Personen (Weihnachtsmann, Rotkäppchen, Asterix, Eisenherz) gelernt werden. Es ist ganz sicher eine Fehlinterpretation, wenn man annimmt, die Unterscheidung von historischen und imaginären Personen wäre eine Denkleistung, die in der frühen Jugend abgeschlossen würde. Sicher ist dieser Aspekt des Geschichtsbewusstseins für die frühen lebensgeschichtlichen Phasen ein größeres Problem als für spätere. Es ist aber lediglich ein graduelles.
Eine Befragung bei Osnabrücker Studenten nach Personen wie Rasputin, Siegfried, Robin Hood, Romulus und Remus zeigte, dass die Imaginarität von Personen durchaus nicht eindeutig geklärt ist (5). (Beispiel: Prinz Eisenherz wurde von 11,1% der befragten Studenten als historisch, 73,5% als imaginär eingeordnet. 13,2% wussten sich nicht zu entscheiden.)
Aber auch bei historischen Situationen treffen wir die gleiche Problematik. Traum und Fiktion müssen vom Geschichtsbewusstsein einen Ort angewiesen bekommen. Das Geschichtsbewusstsein ordnet den imaginären Bestandteilen immer bestimmte (zeitliche und räumliche) Bereiche zu und nimmt ihnen dadurch zwar ihre Imaginarität, rückt sie aber gleichzeitig in räumliche und zeitliche Distanz: Das goldene Zeitalter wird in der Vergangenheit angesiedelt, die humanitär befriedete Welt in der Zukunft verortet. Die "gute alte Zeit" gab es in der vorindustriellen Periode, das Matriarchat als erste Vergesellschaftungsform wird in die Frühgeschichte verlegt. Das friedliche Miteinander ohne Normen und Zwänge findet sich in der Südsee, und die bäuerlich-kleinhandwerkliche Kommune ohne Arbeitsteilung geht auf das Land (bzw. nach Griechenland oder Kalifornien).
Das historische Denken ordnet seine Imaginationen, Träume und Utopien in den verschieden akzentuierten Zeitdimensionen an. Dem Geschichtsbewusstsein fällt somit die Funktion zu, unsere Wunschträume in der Zeit zu verorten (6).
Wirklichkeitsbewusstsein ist jener Aspekt von Geschichtsbewusstsein, der die Grenze zwischen real und fiktiv zieht. Das bedeutet zunächst nur, dass eine solche Grenze im Bewusstsein gezogen wird, noch nicht, wo sie gezogen wird. In den verschiedenen Kulturen erfolgt die Grenzziehung unterschiedlich. Aber dass solche Grenzen gezogen werden, ist die Voraussetzung für Geschichtsbewusstsein und gleichzeitig ein strukturierendes Strukturmoment selbst. Die jeweils konkret individuellen Ausprägungen von Geschichtsbewusstsein, die als Bedingung ihrer Existenz diese Grenze gezogen haben, weisen Personen und Ereignissen ihren Platz diesseits und jenseits dieser Grenze zu: das jeweils konkret individuelle Geschichtsbewusstsein nimmt eine exakte Einordnung in einen dieser beiden Bereiche vor. Die Grenzziehung ist im individuellen Bewusstsein scharf und bewusst. Gesamtgesellschaftlich gesehen ist diese Grenze keineswegs eindeutig gezogen. Davon zeugen die verschiedenen Mythen: Barbarossa, Friedrich der Große, Dolchstoßlegende, Hitlers "Wunder"-Waffen, "Stunde Null" etc.
Wollte man annehmen, dass die individuellen Ausprägungen von Geschichtsbewusstsein nur diesseits der Grenze real-historisch ausgebildet seien, würde Geschichtsbewusstsein auf eine rein rationalistische Form festgelegt werden. Mythen, Legenden, Affabulationen würden als nicht zum Geschichtsbewusstsein gehörig betrachtet werden. Dass aber solche Mythen zum Geschichtsbewusstsein gehören, wissen wir aus der alltäglichen Erfahrung und kennen auch die ideologischen Bindewirkungen kollektiver Mythen. Aus dieser Tatsache resultiert eine wichtige Funktion von Geschichtswissenschaft und Geschichtsdidaktik: historische Legenden und Mythen aufzulösen und das Wirklichkeitsbewusstsein zu schärfen.
2.3 Historizitätsbewusstsein
Die Unterscheidung der Zeitdimensionen im Zeitbewusstsein und der Realitätsgrade im Wirklichkeitsbewusstsein ist zunächst einmal für das einzelne Individuum statisch. Personen und Verhältnisse ändern und verändern sich aber. Sie veralten und verjüngen sich, sie werden und vergehen. Diese Kenntnis soll die Kategorie Historizitätsbewusstsein ausdrücken, der die Erkenntnis von Geschichtlichkeit zugrunde liegt (7). Geschichtlichkeit beruht auf einer grundsätzlichen und fundamentalen Syntheseleistung, die relativ spät aus den Basiskategorien von Zeitlichkeit und Realität gebildet wird. Die lebensweltlich erfahrene Historizität ist immer nur auf ein unmittelbares, direktes Erfahren und Handeln bezogen. Die Personen und Gegenstände, die erfahren und behandelt werden können, sind stets real und präsent. Die Historizität historischer Ereignisse lässt sich dagegen nur über Erzählungen und durch Denkakte erfahren.
Die Kategorie Geschichtlichkeit, bezogen auf das Bewusstsein, können wir als Historizitätsbewusstsein bezeichnen. Es bezeichnet das Wissen, dass Personen, Dinge und Ereignisse sich in der Zeit verändern, aber auch, dass bestimmte Dinge und Ereignisse sich nicht verändern - scheinbar in der kurzen Zeit der eigenen Lebensspanne unveränderlich sind. Die über die lebensweltliche Erfahrung hinausgehende Historizität lässt sich dann nur über historische Erzählungen (kommunikativ) erfahren.
Historizitätsbewusstsein bezeichnet aber nicht nur das Wissen um Veränderungsprozesse, sondern beinhaltet auch die Anwesenheit von alltäglichen "Geschichtstheorien" im Bewusstsein des einzelnen. "Alltägliche Geschichtstheorie" wird dabei sowohl im Sinne einer Theorie der Geschichte wie einer Theorie der Geschichtswissenschaft verstanden. Alltägliche Geschichtstheorie ist eine naive, nicht reflektierte, aber aus primären und sekundären Erfahrungen resultierende Annahme darüber, was Geschichte ist, was ihre Kraftzentren sind, was Geschichte verändert, was unveränderlich ist, was Gegenstand von Geschichte ist, was Geschichte mit einem selbst zu tun hat, d. h. die Entdeckung, dass man selbst der Historizität unterworfen ist und eine eigene Geschichte hat (Schacht 1978). Als alltägliche Theorie des historischen Wissens enthält das Historizitätsbewusstsein auch Annahmen darüber, woher wir etwas über vergangene Zeiten wissen können.
Zusammengefasst gesagt, bezeichnet Historizitätsbewusstsein jenen Aspekt von Geschichtsbewusstsein, der Angaben darüber enthält, was im historischen Prozess veränderlich ist und was statisch bleibt, wer oder was diese Veränderungen bewirkt (gibt es ein Subjekt der Geschichte und wenn ja, wer ist dieses). Historizitätsbewusstsein drückt ferner das Wissen um die Differenz von Natur und Geschichte aus.
2.4 Identitätsbewusstsein
Identitätsbewusstsein beruht auf der Erfahrung, dass einzelne Menschen wie auch Menschengruppen sich ändern und doch mit sich selbst identisch bleiben. Als Kategorie des Geschichtsbewusstseins ist es das Bewusstsein, zu verschiedenen Gruppen "wir" sagen zu können und sich damit von anderen ("sie"; "ihr") abzugrenzen (8). Identitätsbewusstsein ist aber nur dann ein Strukturmoment von Geschichtsbewusstsein, wenn dies "wir" in zeitlicher Dimension gesehen wird, d. h. durch Verweis auf vergangene Handlungen der Bezugsgruppe, die als Identifikationsobjekt gewählt wird, Identität begründet. Identität als Strukturmoment von Geschichtsbewusstsein ist somit eine Orientierung in diachroner Weise.
Das Individuum sagt zu verschiedenen Gruppen "wir". Diese Gruppen variieren in der Größe: unsere Familie, unser Verein, unsere Stadt, unsere Nation (Devereux 1984b) etc. Das Individuum identifiziert sich mit den Mitgliedern dieser verschiedenen und verschieden großen Gruppen. Wir können deshalb von der Größe des identitiven Raumes des Individuums sprechen (Vgl. Streit 1982). Die Wir-Ihr-Differenzierung ist in der Regel mit einer Verteilung von sozialen Wertigkeiten verknüpft (9). Die Ihr-Gruppen (besonders wenn es sich um Minderheiten handelt, die der allgemeinen Norm nicht folgen) werden somit abgewertet. Die Ihr-Gruppe ist nicht "unseresgleichen", sie ist anders, fremd.
Den Mechanismus, der zu einem Identitätsbewusstsein, zu einem Kollektivbewusstsein führt, hat Piaget ausführlich analysiert (Piaget, Weil 1976). Piaget beschreibt das Verhältnis, dass das Kind zu übergeordneten Kollektiven eingeht, als logische und affektive Dezentralisierung. Zu Anfang der individualgeschichtlichen Entwicklung betrachtet das Kind sich selbst als den einzig logisch und affektiv möglichen Standpunkt (Egozentrismus). Es nimmt an, dass der Standpunkt, den es selbst vertritt, von allen geteilt wird.
Auf der ersten Stufe kann das Kind zwar wir und ihr unterscheiden, aber diese Unterscheidung gilt radikal. Ein Osnabrücker kann kein Deutscher sein und ein Deutscher kann kein Osnabrücker sein. Deutscher und Osnabrücker sind räumlich und logisch verschiedene Klassen. Ebenso kann ein Deutscher kein Europäer sein und Europäer kann kein Deutscher sein.
Auf der zweiten Stufe kann das Kind schon die räumliche, aber noch nicht die logische Inklusion vollziehen. Deutschland liegt in Europa, aber dennoch kann ein Deutscher kein Europäer sein. Auf der affektiven Ebene kann es aber auch schon eine affektive Dezentrierung vornehmen. Andere Länder, andere Bezugsgruppen können ihm schon gefallen, aber nur, wenn sie einem Mitglied der Familie gefallen. Das Kind ist in der Lage, seine Affekte auch auf Gruppen zu zentrieren, die außerhalb der eigenen liegen (Dezentrierung); hier wäre der Übergang zur diachronen Identität zu sehen.
Auf der dritten Stufe nimmt das Kind die kollektiven Stereotypen an, die eine jede Wir-Gruppe von sich entwirft (10).
2.5 Politisches Bewusstsein
Politisches Bewusstsein als Strukturmoment von Geschichtsbewusstsein ist hier im engeren Sinne von "politisch" gemeint - es soll als Herrschaftsbewusstsein verstanden werden. Hier ist nicht "staatsbürgerliche Kompetenz" gemeint (Steiner 1984), das Wissen von Verfassungsorganen und deren Wirkungsweise, sondern der Sachverhalt, dass Gesellschaften durch Herrschaft geordnet sind. Immer dort, wo von Geschichte die Rede ist, haben wir es mit asymmetrisch verteilten Machtverhältnissen zu tun. Dieses Bewusstsein, dass gesellschaftliche Verhältnisse von Machtverhältnissen durchdrungen sind, ist etwas, was nicht allein durch Unterricht oder Unterweisung allgemein vermittelt wird, sondern gehört zu den sehr frühen lebensgeschichtlichen Erfahrungen:
"Psychologisch betrachtet gehören die Dimensionen groß - klein und Macht - Ohnmacht in die prägenitale Entwicklung, sind also ein außerordentlich frühes und grundlegendes Problem." (Horn 1968)
Wenn dieses Herrschaftsbewusstsein schon sehr früh erworben wird, so bedeutet das noch nicht, dass späteres Lernen kaum noch Einfluss darauf hat. Geschichtsunterricht sollte sich vor allem darüber im klaren sein, wo Schüler die Macht lokalisieren. Dieses Wissen ist für die Geschichtsdidaktik wichtig, wenn Geschichtsunterricht überhaupt einen Beitrag zur politischen Bildung leisten will:
"Die Macht konzentriert sich nach Ansicht der Schüler in den Verfassungsorganen Regierung, Parteien und Parlament (in dieser Reihenfolge). Auch den Organen des Pressewesens kommt danach eine beträchtliche Macht zu, sie haben mehr Macht als die Gewerkschaften, welche wiederum mehr Macht als die Arbeitgeberverbände auf sich vereinigen.... ,Macht' wird von den Schülern hier als politische Macht verstanden, für die man sich alternative Konstellationen kaum vorzustellen vermag" (Urban 1976).
Dass wirtschaftliche Institutionen Macht ausüben, wird in der Regel von Schülern nicht gesehen. "Daraus muss nach unserer Ansicht abgeleitet werden, dass wirtschaftliche Macht einen weißen Fleck auf der Landkarte des politischen Schülerbewusstseins darstellt" (Urban 1976: 115).
2.6 Ökonomisch-soziales Bewusstsein
Zur Wahrnehmung historisch-gesellschaftlicher Sachverhalte gehört auch die Wahrnehmung von sozial-ökonomischen Unterschieden. Die Kategorien arm - reich werden zwar durch die Kategorien "oben" und "unten" überlagert, sind mit ihnen aber noch nicht identisch. Die Wahrnehmung von sozialen Unterschieden in historischen Darstellungen sowie die Wahrnehmung sozialer Ungleichheit in der Gegenwart ist an die Erfahrung dieser Prädikate in der alltäglichen kindlichen Umwelt gebunden.
Kinder lernen schon sehr früh die Begriffe arm und reich zu gebrauchen und richtig anzuwenden. Ob die Begriffe arm und reich heute historisch veraltet sind (Wacker 1976: 62) und auf unsere Gegenwart nicht mehr passen, ist hier nicht so wichtig. Ein Bewusstsein von gesellschaftlicher Ungleichheit ist dennoch vorhanden, wie auch neuere Untersuchungen zeigen (Leahy 1981). Kinder haben aber bestimmte Schwierigkeiten, sich selbst und ihre Familie in diesem Bezugssystem unterzubringen: "Dieselben Kinder, die in der Mehrzahl angeben, in ihrem Bekanntenkreis seien mehr arme Leute zu finden, nehmen wiederum in der Mehrzahl ihre Eltern aus" (Wacker 1976: 70). Sie können wohl ihre Umwelt nach den Kategorien "arm" und "reich" einschätzen, haben aber offensichtlich Schwierigkeiten in der Selbstlokalisation.
Der gleiche Tatbestand wird aus der Berliner Kinderladenbewegung berichtet:
"Auch bei Gegenüberstellungen wie: reiche Kapitalisten, die immer reicher werden, arme Arbeiter, die relativ verarmen, stießen wir häufig auf den Widerstand der oder besser die Abwehr der Kinder: Sie wollten ihre Eltern keinesfalls als arm hingestellt sehen, sondern betonen wider allen Augenschein, wie gut sie doch verdienten und wohnten, wie zufrieden sie mit ihrem Leben sein könnten" (Autorenkollektiv am psychologischen Institut der Freien Universität Berlin 1971:124; zitiert nach Holzkamp 1973: 228)
Hier treten offensichtlich bewusstseinsinterne Konflikte auf, die zu Schwierigkeiten führen, die einzelnen Strukturmomente "ökonomisches" und "moralisches Bewusstsein" (11) in einem Gesamtkonzept zu integrieren.
Wacker berichtet, dass die Schüler mit einem "inkongruenten Erklärungsmodell" die Ursachen von arm und reich erklären wollten. "Während Armut überwiegend als durch unbeeinflussbare Gegebenheiten ... verursacht gesehen wird, soll Reichtum wesentlich die Frucht individueller Bemühungen sein" (Wacker 1976: 76). Arm ist eine Eigenschaft von Personen, die von außen kommt, Reichtum dagegen ist eine Eigenschaft, die die Person der eigenen Tüchtigkeit (Begabung, Fleiß...) verdankt (externe und interne Kausalattributation).
Daran scheint Geschichtsunterricht nicht ganz unbeteiligt zu sein. Unsere Schulbücher verstärken diese inkongruenten Erklärungsmuster:
- "Weitblickende Unternehmer stampften die neuen Industrien aus dem Boden" (Geschichte für die Hauptschule 1981: 21).
- "Die Unternehmer in der frühen Zeit der Industrialisierung kamen meist aus bürgerlichen Familien und arbeiteten sich durch Sparsamkeit, Können, Erwerbssinn und nüchtern abwägendes Gewinnstreben empor" (Geschichtliche Weltkunde 1975: 168).
- "Der große Bevölkerungszuwachs ... brachte vielen Menschen die Sorge: wie das tägliche Brot erwerben? Woher Wohnung nehmen?... " ( Geschichtliche Weltkunde 1975: 171).
Armut und Reichtum als gesellschaftliche Kategorien, die auch gesellschaftlichen Ursprungs sind, werden hier auf Persönlichkeitsmerkmale reduziert: auf Weitsicht und Tatkraft einerseits und auf Hilflosigkeit andererseits.
Die jüngste (mir bekannte) Untersuchung (Leahy 1981), an die eine Analyse des ökonomischen Bewusstseins anknüpfen könnte, versucht, die Entwicklung von Schichtungskonzepten in Begriffen der kognitiven Entwicklung zu beschreiben. Sie untersucht zwei allgemeine Trends der kognitiven Entwicklung und der sozialen Wahrnehmung: Zwischen Kindheit und Adoleszenz findet ein Wandel in der Betonung von beobachtbaren "peripheren" zu vermuteten psychologischen oder "inneren" Eigenschaften von Personen statt. Zweitens, die Betonung jüngerer Kinder von Verhalten und äußerer Erscheinung ist verbunden mit Berufs- und Geschlechtsrolle.
2.7 Moralisches Bewusstsein
Eine geschichtsdidaktisch gerichtete Theorie des Geschichtsbewusstseins stößt immer wieder auf die kognitiven Schwierigkeiten beim Umgang mit moralischen Prinzipien. Die Welt historischer Sachverhalte wird "moralisiert", d. h. es wird nach den zugrunde liegenden Motivationen und den Begründungsformen von Handlungen gefragt, und diese werden dann gewertet. Historische Ereigniszusammenhänge werden als gut oder schlecht, historische Handlungen als richtig oder falsch klassifiziert. Darüber hinaus finden sich Formen des moralisierenden Deutens (Vorsehung, Verschwörung, Dolchstoß etc.) historischer Entwicklungsprozesse. Dennoch ist uns im Moment noch völlig unbekannt, welche Bedeutung moralische Prinzipien für die Wahrnehmung und Deutung von Geschichte haben.
Moralisches Bewusstsein allgemein besteht in der Selbstobligation gegenüber sozialen Normen (12). Es ist deshalb nach den sozialen Normen und deren Bindung zu fragen. Hinsichtlich der Wahrnehmung und Deutung von Geschichte besteht moralisches Bewusstsein in der Fähigkeit, die Prädikate gut und böse nicht willkürlich oder zufällig, sondern nach Regeln anzuwenden.
Hier stellen sich für das Geschichtsbewusstsein zwei Probleme, von denen das eine Geschichte als Prozess und das andere die Verstehbarkeit historischer Situationen betrifft.
- Im Kohlbergschen Konzept geht es nicht darum, ein historisches Ereignis richtig oder falsch, gut oder schlecht, akzeptabel oder verwerflich zu finden: ob die Bauern im Bauernkrieg "richtig" handelten, als sie zur Gewalt griffen, ob der gesellschaftliche Umsturz 1918/19 richtig oder verwerflich war, ob die Verschwörer des 20. Juli das tun durften oder nicht, was juristisch Hochverrat war, ist nicht Gegenstand einer genaueren Analyse des moralischen Urteils in der Geschichtsdidaktik. Hier geht es einzig und allein darum, welche Argumentationsniveaus für Pro- oder Contra-Entscheidungen benutzt wurden. Auf jeder der 6 Kohlbergschen Argumentationsstufen ist zu jedem Ereignis eine Pro- und eine Contra-Haltung möglich.
Die vorfindbaren moralischen Argumentations- und Begründungsmuster lassen sich hierarchisch ordnen (Egozentrik, Heteronomie, Autonomie), und diese Hierarchie bringt einen entwicklungslogischen Zusammenhang zum Ausdruck. Es spricht vieles dafür, dass die Entwicklung des moralischen Bewusstseins einem rational nachkonstruierbaren Muster folgt. Über diesen Entwicklungsgang des moralischen Bewusstseins geben uns die Untersuchungen von Jean Piaget und Lawrence Kohlberg Auskunft. Nach Kohlberg vollzieht sich das moralische Bewusstsein in sechs Stufen (13).
Die Untersuchung von moralischen Argumentationsformen, die sich auf historische Ereignisse beziehen, erlaubt eine zureichendere Analyse des historischen Handlungszusammenhanges als bisher. Ein Konzept wie das von Kohlberg, das allgemeine Menschheitsgeschichte und individuelle Lebensgeschichte verknüpft, vermeidet es, den Schülern die unterschiedlichen Handlungsorientierungen und Wertsysteme in der Geschichte als ein buntes, beliebiges und zufälliges Kaleidoskop kontingenter Ereignisse ohne eine bestimmte Entwicklungslogik vorzustellen. Wenn die Muster moralischen Handelns stets kontingent wären, wäre eine historistische Relativierung begründet. Eine solche Annahme schränkt die historischen Erkenntnismöglichkeiten ein, man kann aber mehr erkennen, als der Historismus für möglich hielt.
- Während wir moralisches Bewusstsein im alltäglichen Leben wie auch moralisches Bewusstsein in hypothetischen Situationen bei Kindern relativ früh finden, ist damit noch nicht entschieden, wie ihr moralisches Bewusstsein mit historischen Situationen umgeht. Was vom einzelnen Individuum hier gefordert ist, ist eine Verbindung der Basisorientierungen (Realität, Zeit, Geschichtlichkeit) mit dem moralischen Bewusstsein. Es scheint so, dass eine Verknüpfung von moralischem Bewusstsein und dem Bewusstsein von Geschichtlichkeit im weiteren Sinne erst auf einer zeitlich ziemlich späten lebensgeschichtlichen Stufe erfolgt. Auf der frühen Phase werden moralische Urteile für historische Situationen analog zu gegenwärtigen hypothetischen Situationen vorgenommen, ohne dass das Bewusstsein von Geschichtlichkeit dabei leitend wäre. Dass das moralische Bewusstsein als Komponente von Geschichtsbewusstsein nicht allein von Entwicklungs- und Sozialpsychologie hinreichend analysiert werden kann, zeigt die immer noch vorhandene Interpretationsregel des Historismus. Dem Historismus ist ein ethischer Relativismus eigen, der die "Geltung moralischer Urteile allein an Rationalitäts- oder Wertstandards derjenigen Kultur- und Lebensform bemisst", die verstanden werden soll und nicht an der, der das urteilende Subjekt angehört (Habermas 1983: 132)! Dass das nach den Erfahrungen mit dem Faschismus nicht mehr gelten kann, ist zwar theoretisch plausibel, trifft aber noch nicht die aktuelle Praxis. Wir müssen vielmehr von der Existenz eines kindlichen Historismus ausgehen, der alles legitimiert, weil es eben "damals" so üblich war (14).
3. Individuelles Geschichtsbewusstsein und Sinnbildungsprozesse - Versuch einer Matrix
Wenn Geschichtsbewusstsein strukturiert ist, d. h. über die oben ausgewiesenen kategorial wirkenden Strukturmomente definiert ist, ergibt sich daraus der praktische Aspekt. Eine solche Strukturierung kann als Dimensionierungsvorschlag für empirische Forschung sowie als Diagnose-, Analyse- und Planungsinstrument in einer geschichtsdidaktischen Pragmatik Verwendung finden. Die Strukturbestimmung macht Geschichtsbewusstsein für Empirie erforschbar und für Pragmatik identifizierbar. Wir wissen dann, wann wir Geschichtsbewusstsein vor uns haben und wann nicht. Das ist der anfangs skizzierte normative Aspekt.
Bisher ist aber nur von Strukturmomenten die Rede gewesen. Es wurde vorausgesetzt dass diese Momente eine Struktur bilden. Deshalb müssen jetzt noch einige Hypothesen über das Zusammenwirken der Strukturmomente angefügt werden. Das Zusammenwirken der einzelnen Strukturmomente von Geschichtsbewusstsein kann man vielleicht am besten durch eine Matrix ausdrücken (15), in der die Flächen, Linien, Punkte kategorial verfasste und noch nicht inhaltlich gefüllte Potentionalitäten der möglichen Ausprägung von Geschichtsbewusstsein bedeuten. Das Matrixmodell hat den Vorteil, dass das Geschichtsbewusstsein nicht durch die verschiedenen Inhalte (unterschiedliches Wissen) erklärt wird, sondern durch die prinzipiell gleichen Kategorien.
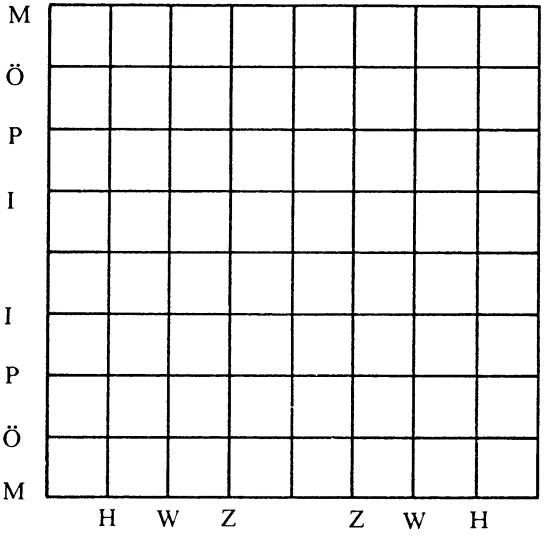
Diese Struktur, dieses Gitterwerk, hätte die Funktion, dargestellte Geschichte wahrnehmbar zu machen. Das würde aber noch nicht die verschiedenen individuellen Ausprägungen des Geschichtsbewusstseins erklären. Geschichtsbewusstsein hat aber nicht nur eine Wahrnehmungsfunktion, sondern auch eine Deutungsfunktion, und diese Deutung erfolgt individuell und soziokulturell unterschiedlich. Es sind zwar alle Strukturmomente an der (intellektuellen) Verarbeitung und Deutung von Geschichte beteiligt, aber nicht alle in gleicher Weise.
Die bisher vorgestellte Struktur sagt noch nichts darüber aus, wie ein konkret individuelles Geschichtsbewusstsein aussieht und sich von dem Geschichtsbewusstsein eines anderen Individuums unterscheidet. Eine solche Strukturbestimmung sagt vorerst auch nichts darüber aus, was passiert, wenn Geschichtsbewusstsein lebensgeschichtlichen Wandlungsprozessen unterworfen wird. Solche Wandlungen ergeben sich bei einschneidenden lebensgeschichtlichen Erfahrungen in historischen Situationen oder Ereignisketten und durch Denkprozesse über Geschichte, durch Nachdenken, das allerdings durch Gegenwartserfahrungen ausgelöst wird. Eine tiefgreifende Veränderung des Geschichtsbewusstseins - vielleicht die wichtigste - erfolgt in der Adoleszenz. Nicht, dass jetzt erst Geschichtsbewusstsein ausgebildet würde, wie die ältere Entwicklungspsychologie noch behauptet, sondern es erfolgt in der Adoleszenz eine tiefgreifende Umstrukturierung. Daraus müssen für eine elaborierte Theorie des Geschichtsbewusstseins Konsequenzen gezogen werden: Die Struktur des Geschichtsbewusstseins, die zunächst noch statisch ist, muss dynamisiert werden: sie muss individuelle Unterschiede wie lebensgeschichtliche Wandlungen erklären.
Die Struktur wird durch sozial und individuell unterschiedliche Kombinationen von Strukturmomenten gebildet. Das macht die Pluralität von Geschichtsbewusstsein aus.
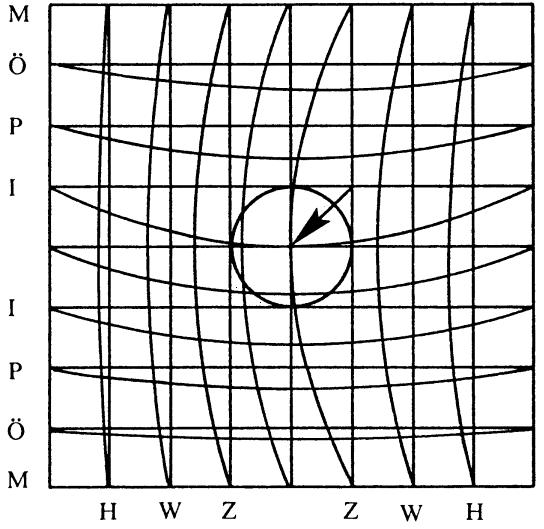
Bestimmte soziale und individuelle Ausprägungen von Geschichtsbewusstsein beinhalten die für sie typische Dominanz von bestimmten Strukturmomenten und verweisen die anderen auf einen niedrigeren Rangplatz. Es gibt somit basale und ephemere Strukturmomente in den einzelnen Typen von Geschichtsbewusstsein. Ob allerdings im Laufe der Lebensgeschichte das Kontinuum von basalen bis ephemeren das gleiche bleibt, ist damit noch nicht gesagt.
Es ergeben sich also "Verzerrungen" der Strukturierung, die nicht nur individuelle Verschiedenheit ausdrücken, sondern darüber hinaus auch die Sinnbildungsprozesse bei der kreativen Produktion wie auch bei der produktiven Transformation von Geschichten anzeigen können. Wo sich die Strukturverzerrungen kumulieren, wäre also die individuell eigenartige "Sinnmitte" des Geschichtsbewusstseins zu lokalisieren, die die Ereignisbeschreibungen zu sinnvollen Geschichten erzählt. Sinnbildungsprozesse müssen von einem anfangs "leeren" Sinnzentrum ausgehen, wenn es sich um Bildungsprozesse handelt, also um solche Prozesse, in denen etwas entsteht. Sinnbildung entsteht somit durch Verzerrung der idealtypischen Struktur, d. h. einzelne Dimensionen verschieben sich und bilden damit ein Sinnzentrum aus.
Konkrete Formen von Geschichtsbewusstsein könnten etwa dann in den folgenden Arten beschrieben werden:
- Traditionelle Ausprägungen von Geschichtsbewusstsein aktualisieren aus dem Potential der Möglichkeiten lediglich die Dimensionen der staatlich verfassten Macht und Herrschaft in der als Nation organisierten Wir-Gruppe.
- Dieser traditionell bürgerlichen Ausprägung von Geschichtsbewusstsein steht ein nicht weniger traditionelles, sich antibürgerlich gebendes Geschichtsbewusstsein gegenüber. Hier wird die Wir-Gruppe am unteren Ende der ökonomischen Stratifikation angesiedelt. Das Historizitätsbewusstsein ist auf die Aufhebung aller ökonomischen Stratifikationen und der daran gebundenen Herrschaftsverhältnisse gerichtet.
- Neuere Bewusstseinsformen setzen die Definition der Wir-Gruppe zwar auf der Seite der ohnmächtigen und ökonomisch Abhängigen an. Konstitutiv ist aber, dass sie sich in der Objektrolle, der Rolle der Leidenden, aber moralisch Mächtigen sehen. Legitimation ergeben nicht die stolzen Taten der Vergangenheit, sondern die antizipierten Schrecken der Zukunft (16).
Über die Beschreibung von Geschichtsbewusstsein durch die ausgewiesenen Doppelkategorien ließe sich sicherlich hinsichtlich Vollständigkeit und zureichender Definition der einzelnen Momente diskutieren. Mein Vorschlag zielt in erster Linie aber auf zwei mir wichtig erscheinende Punkte:
- Es gilt, Geschichtsbewusstsein als ein komplexes Gebilde aufzufassen, das sich durch kategorial wirkende Strukturen auszeichnet und sich nicht über die Anwesenheit oder Abwesenheit von historischem Wissen definiert.
- Geschichtsbewusstsein ist nicht nur eine formale Orientierung in der historischen Zeit, sondern eine sozial-politische Orientierung über sich wandelnde gesellschaftliche Verhältnisse.
Wollte man die ersten drei Strukturmomente (Zeit, Wirklichkeit, Historizität), die in der Tat eine grundlegendere Ebene des Geschichtsbewusstseins bilden als die übrigen vier (Identität, Herrschaft, Sozialschicht, Moral), allein zur Definition von Geschichtsbewusstsein heranziehen, so würde Geschichtsbewusstsein entpolitisiert und dem Gesamtbereich "Geschichte" nur sehr verkürzt Rechnung getragen.
Anmerkungen
1 Vor zehn Jahren habe ich mit Ulrich Mayer den Versuch gemacht, "Kategorien der Geschichtsdidaktik" über die Analyse von Sprachverwendung und Sprachhandeln zu erkennen. Dieser Ansatz - damals zum Zwecke der Unterrichtsanalyse unternommen - kann auch für die empirische Erforschung von Geschichtsbewusstsein genutzt werden. Vgl. Mayer, U.; Pandel, H.-J. (1976) Kategorien der Geschichtsdidaktik und Praxis der Unterrichtsanalyse. Stuttgart.
2 Um die Kategorie Zeit sprachlich erkennbar zu machen, ist die linguistisch gerichtete Untersuchung von Wunderlich immer noch unübertroffen. Vgl. Wunderlich, D. (1970) Tempus und Zeitreferenz im Deutschen, München. Zu dieser und den folgenden zwei Hinsichten vgl. Riegel, K. (1978) Versuch einer psychologischen Theorie der Zeit. In: Rosenmayr, L. (Hrsg.) Die menschlichen Lebensalter. München, 269-292.
3 Zu dieser und den folgenden zwei Hinsichten vgl. Riegel (1978).
4 Vgl. auch die Analysen von Autobiographien, die Bodo von Borries in seinem Beitrag in Gd 1/1987 vorgelegt hat.
5 Diese Ergebnisse verdanke ich der Arbeitsgruppe Barbara Glosemeyer, Frank König, Stefan Oelschig und Martin Pohimann, die sich der Mühe unterzogen haben, die hier vorgeschlagenen Doppelkategorien in einer ersten empirischen Untersuchung bei Osnabrücker Studenten zu testen.
6 Anschauungsmaterial hierfür findet sich in der Debatte der letzten Jahre über die "Deutsche Frage" und "Wiedervereinigung". Die zeitliche Verortung der eigenen Wünsche gilt als real; Illusionen und falsche Vorstellungen sind immer bei den anderen zu finden.
7 Ob der von mir gebrauchte Begriff der Geschichtlichkeit mit der "Geschichtlichkeit" der Geschichtsphilosophie Gemeinsamkeiten hat, kann hier nicht ausdiskutiert werden. Zur Orientierung vgl. Bauer, G. (1963) Geschichtlichkeit. Wege und Irrwege eines Begriffs. Tübingen.
8 Vgl. Meier (1985) "Nichts zeigt die Schwierigkeit, die wir mit der Geschichte haben, so deutlich wie unsere Unfähigkeit, in der zeitlichen Dimension Wir zu sagen; unsere Vorfahren also einzuschließen, in ein Ganzes, dem auch wir selbst angehören. Mit elf Männern auf dem Rasen können wir uns identifizieren, wenn wir etwa 2 zu 0 gegen Wales spielen. Aber dass wir 1870/71 gegen Frankreich gekämpft hätten - um vom Zweiten Weltkrieg zu schweigen -, sagen wir nicht. So etwas sprechen wir distanzierend ,den Deutschen' zu. Unsere Großväter dagegen konnten meinen, im Jahre 9 nach Christus die Römer im Teutoburger Wald besiegt zu haben. Sie lasen Tacitus' Germania, um über sich selbst etwas zu erfahren. Sie fühlten sich mit Vatermörder und Zylinder den alten Germanen verwandter als den Franzosen ihrer Zeit".
9 Vgl. dazu das Kapitel 2.7.
10 Ein kritischer Punkt bei bundesrepublikanischen Schülern ist ihr Verhältnis zu Kommunisten (bzw. was sie dafür halten) und zur DDR. Ein "richtiger" Deutscher kann kein Kommunist sein, aber gleichwohl sind Kommunisten wieder Deutsche. Das Verhältnis zur DDR ist ebenso problematisch. Bundesrepublik und DDR werden nicht als zwei Teile einer ursprünglich staatlichen und kulturellen nationalen Einheit angesehen, sondern die DDR erscheint den Schülern als ein abgetrennter Teil der Einheit Bundesrepublik. Vgl. dazu das Anschauungsmaterial, das Boßmann geliefert hat: Boßmann, D. (Hrsg.) (1978) Schüler über die Einheit der Nation, Ergebnisse einer Umfrage. Frankfurt/M.
11 Vgl. dazu Kapitel 2.7.
12 Vgl. Pandel, H.-J. (1985) Moralische Entwicklung. In: Bergmann, K. (1985) u. a. (Hrsg.) Handbuch der Geschichtsdidaktik. Düsseldorf, 279-286. und Miller, M. (1980) Zur Ontogenese moralischer Argumentationen. In: LiLi 10, Nr. 38/39, 58-109.
13 Vgl. die Zusammenfassung bei Pandel (1985).
14 Erste empirische Voruntersuchungen scheinen diesen Tatbestand des kindlichen Historismus zu bestätigen.
15 Den Gedanken des Matrixmodells verdanke ich meinem Osnabrücker Kollegen Walter Aschmoneit, der mich an den verschiedenen Stufen seiner Ausformulierung teilnehmen ließ. Dieses Matrixmodell ist von Walter Aschmoneit zum Zwecke der transkulturellen Analyse entwickelt worden. Vgl. Aschmoneit, W. (1985) Kulturvergleich, Entwicklung und Matrixmetapher (mit Beispielen aus der Kultur Kambodschas). In: Internationales Asienforum 16 (3/4), 215-244.
16 Dass hier auch komparatistische Arbeiten als Strukturvergleiche möglich sind, soll nur angemerkt, aber nicht mehr ausgeführt werden.
Literatur
Aschmoneit, Walter (1985): Kulturvergleich, Entwicklung und Matrixmetapher (mit Beispielen aus der Kultur Kambodschas). In: Internationales Asienforum. Jg. 16 (3/4), Seite 215-244.
Autorenkollektiv am psychologischen Institut der Freien Universität Berlin 1971.
Bauer, Gerhard (1963): Geschichtlichkeit. Wege und Irrwege eines Begriffs. Tübingen.
Borries, Bodo von (1987): Geschichtslernen und Persönlichkeitsentwicklung. Aufgewiesen an autobiographischen Zeugnissen über die Zeit um den Ersten Weltkrieg. In: Geschichtsdidaktik. Jg. 12 (2), Seite l ff.
Boßmann, Dieter (Hg.) (1978): Schüler über die Einheit der Nation, Ergebnisse einer Umfrage. Frankfurt/M. : Fischer-Taschenbuch.
Devereux, George (1984a): Ethnopsychoanalyse. 2. Aufl., Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Devereux, George (1984b): Die ethnische Identität. Ihre logischen Grundlagen und ihre Dysfunktionen. In: ders.: Ethnopsychoanalyse. Frankfurt/M.: Suhrkamp, Seite 131-169.
Geschichte für die Hauptschule. (1981): 8. Jahrgangsstufe. Donauwörth: Auer.
Geschichtliche Weltkunde. (1975): Bd. 2. Frankfurt/M.: Diesterweg.
Habermas, Jürgen (1983): Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln. Frankfurt/M.: Suhrkamp Taschenbuch.
Holzkamp, Klaus (1973): Sinnliche Erkenntnis. Frankfurt/M.: Athenäum.
Horn, Klaus (1968): Über den Zusammenhang zwischen Angst und politischer Apathie. In: Marcuse, Herbert u.a.: Aggression und Anpassung in der Industriegesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp, Seite 68ff.
Leahy, Robert L. (1981): The Development of the Conception of Economic Inequality. I. Descriptions and Comparisons of Rich and Poor People. In: Child Development. Vol. 52 (2), Seite 523-532.
Mayer, Ulrich; Pandel, Hans-Jürgen (1976): Kategorien der Geschichtsdidaktik und Praxis der Unterrichtsanalyse. Stuttgart: Klett.
Meier, Christian (1985): Die Deutschen im Niemandsland. In: FAZ 24. 8. 1985.
Miller, Max (1980): Zur Ontogenese moralischer Argumentationen. In: LiLi. Jg. 10, (38/39), Seite 58-109.
Pandel, Hans-Jürgen (1985): Moralische Entwicklung. In: Bergmann, Klaus u. a. (Hg.): Handbuch der Geschichtsdidaktik. Düsseldorf: Schwann, Seite 279-286.
Piaget, Jean; Weil, Anne-Marie (1976): Die Entwicklung der kindlichen Heimatvorstellungen und der Urteile über andere Länder. In: Wacker, Ali (Hg.): Die Entwicklung des Gesellschaftsverständnisses bei Kindern. Frankfurt/M.: Campus, Seite 127-148.
Prentice, N. (1978): Imaginary Figures. In: American Journal of Orthopsychiatry. Vol. 48, Seite 618-628.
Riegel, K. (1978): Versuch einer psychologischen Theorie der Zeit. In: Rosenmayr, Leopold (Hg.): Die menschlichen Lebensalter. München: Piper, Seite 269-292.
Schacht, L. (1978): Die Entdeckung der Lebensgeschichte. In: Psyche 32. Seite 97-110.
Steiner, K. (1984): Sozial-kognitive Entwicklung im Jugendalter: Veränderungen im Verständnis von staatspolitischen Begriffen. In: Stiksrud, Hans Arne (Hg.): Jugend und Werte. Weinheim: Beltz, Seite 216.
Streit, R. (1982): Das individuelle Bild vom außernationalen Bereich. In: KZfSS 34. Seite 677-694.
Urban, Klaus B. (1976): Die Bedingungen politischen Lernens bei Schülern. München: Juventa.
Wacker, Ali (1976): Wahrnehmung, Bewertung und Interpretation sozialer Ungleichheit. In: ders. (Hg.): Die Entwicklung des Gesellschaftsverständnisses bei Kindern. Frankfurt/M.: Campus, Seite 60-87.
Wunderlich, Dieter (1970): Tempus und Zeitreferenz im Deutschen. München: Hueber.
Süssmuth, Hans (1988): Kooperation von Geschichte und Politik
1. Systematische und historische Einordnung des Themas
Die Frage nach Chancen und Grenzen der Kooperation von Geschichte und Politik stellt sich gleichermaßen für Curricula der Primarstufe, der Sekundarstufen und der wissenschaftlichen Hochschulen. Zu leisten ist wissenschaftstheoretische Legitimierung und methodische Absicherung. Das Thema ist durch zwei gescheiterte Versuche belastet:
Nach der Saarbrückener Rahmenvereinbarung von 1960 sollten die Schulfächer Geschichte, Geographie und Sozialkunde für die Oberstufe des Gymnasiums als Fach [/S. 543:] Gemeinschaftskunde zusammengefügt werden. Die Mehrzahl der Geschichtslehrer und der Verband der Geschichtslehrer Deutschlands traten für die Beibehaltung eines eigenständigen Geschichtsunterrichts ein. Trotz des Auftrages, das Fach Gemeinschaftskunde einzuführen, blieb es in den meisten Bundesländern bei einer Addition der dominierenden Fächer Geschichte und Geographie. Da an dem Anspruch festgehalten wurde, pB werde durch historische Bildung mit abgedeckt, verzichteten die Historiker darauf, neue fächerübergreifende geschichtsdidaktische Ansätze zu entwickeln.
Erneut in die Defensive gedrängt sahen sich Historiker und Geschichtslehrer, als 1973 mit den Hess. Rahmenrichtlinien Gesellschaftslehre (HRRG) ein Fach konzipiert wurde, das die volle Integration eines reduzierten Geschichtsunterrichts in ein sozialwissenschaftliches Curriculum vorsah. Mit der Einführung der HRRG wurde die bisherige Praxis schulischer Lehrplanrevision insofern durchbrochen, als die Priorität der fachwissenschaftlichen → Bezugsdisziplinen für curriculare Entscheidungen des Schulfaches in Frage gestellt wurde und eine stärkere Gesellschaftsorientierung zum Tragen kam. Der Ansatz war konsequent lernzielorientiert, erwies sich mit dem Leitziel → Emanzipation jedoch als politisch nicht konsensfähig. Hinzu kam, dass die den fachwissenschaftlichen Bezugsdisziplinen spezifischen Fragestellungen, Begriffe und Methoden, d. h. die jeweilige Struktur der Disziplinen nicht berücksichtigt war. Ungelöst blieb auch das Problem der Lehrerausbildung für das neue Unterrichtsfach. Die Diskussion wurde auf zwei Ebenen geführt. Wissenschaftliche und politische Argumente standen nebeneinander und vermischten sich bisweilen. Als Ergebnis lässt sich zusammenfassen, dass weder die wissenschaftstheoretischen Grundlagen erarbeitet noch die personellen Voraussetzungen zur Realisierung der HRRG vorhanden waren oder der notwendige politische Konsens bestand.
2. Wissenschaftstheoretische Voraussetzungen
Die von den Historikern in der Bundesrepublik geführte neuere Theoriediskussion hat eine Reihe von Ursachen. Sie lagen zu einem Teil in fachinternen Richtungskämpfen, zum anderen in externen Herausforderungen. Nach 1945 hatte sich, insbesondere im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Geschichte des »Dritten Reiches«, verschärft die Frage gestellt, ob die in der Tradition des Historismus stehende Geschichtswissenschaft in der Lage sei, historische Phänomene wie den Totalitarismus zu erforschen. Für die Erschließung von Motiven, Entscheidungen, Handlungen historischer Persönlichkeiten reichten die Instrumente der traditionellen Geschichtswissenschaft aus. Es wurde aber problematisiert, ob Konzentration auf die historische Individualität, hermeneutisch verstehende Auslegung, Verstehen historischer Phänomene aus den eigenen Bedingungen und nach den Maßstäben der eigenen Zeit ausreichten, um die Strukturen einer historischen Zeit wie der des Nationalsozialismus zu erklären. Das vorherrschende theorieskeptische historistische Paradigma wurde kritisiert. In diesem Zusammenhang ist die Diskussion der 50er Jahre zu sehen, sozioökonomische, soziopolitische und soziokulturelle Phänomene, Strukturen und Prozesse in die Forschung einzubeziehen. Strukturgeschichte war einer der Schlüsselbegriffe.
Die Auseinandersetzung der Historiker war auch eine Reaktion auf die Herausforderung der Geschichtswissenschaft durch die systematischen Sozialwissenschaften, [/S. 544:] insbesondere → Politikwissenschaft und → Soziologie, die sich an den Universitäten etabliert hatten und mit ihrem Instrumentarium, ihren Methoden, Fragestellungen, Theorien für die anstehenden Probleme der Gesellschaft Lösungsmöglichkeiten anboten. Das führte zu einem Statusverlust der Geschichtswissenschaft. Eine Folge dieser Entwicklung war, dass das Unterrichtsfach Geschichte in den Schulen zurückgedrängt wurde, was wiederum zu einer Gegenbewegung der Historiker und der Geschichtslehrerverbände führte. Von einem Teil der Historiker wurde der Ruf nach Öffnung gegenüber den systematischen Sozialwissenschaften aufgegriffen, da deren Instrumente die Erforschung von Strukturen und Prozessen, also von überindividuellen Phänomenen, ermöglichte. Es ging auch darum, verlorene Positionen in der öffentlichen Diskussion, in den Universitäten, im Schulcurriculum zurückzugewinnen.
In den frühen 70er Jahren vertrat eine jüngere Gruppe von Historikern, beeinflusst von der Frankfurter Schule, eine praktisch engagierte Geschichtswissenschaft in emanzipatorischer Absicht. Sie verstanden Geschichtswissenschaft als Historische Sozialwissenschaft oder Gesellschaftsgeschichte. In einer Reihe von Publikationen und in der neu gegründeten Zeitschrift »Geschichte und Gesellschaft« forderten sie Kritik am überkommenen Historismus und mehr Theorieorientierung der Geschichtswissenschaft. Sie hoben die gesellschaftlichen Funktionen der Geschichtswissenschaft hervor und betonten den Praxisbezug.
An dieser engagiert geführten Diskussion um Theorieorientierung und Paradigmawechsel in der Geschichtswissenschaft hat sich nur ein Teil der Historiker beteiligt. Viele Historiker sind gegenüber einer Theorieorientierung in der Geschichtswissenschaft skeptisch geblieben. Sie fürchten, dass die Komplexität historischer Wirklichkeit aus dem Blick geraten könne, weil Geschichtsschreibung aus der Perspektive des »Sehschlitzes« von Theorien zur Verkürzung führe. Hinzu kommt, dass sich nicht jeder Historiker dem hohen Anspruch einer theorieorientierten Geschichtswissenschaft gewachsen fühlt. Aber durch diese Auseinandersetzung wurde die Krise, in der sich Geschichtswissenschaft und Geschichtsunterricht Ende der 60er Jahre befanden, überwunden. Die Konkurrenz mit den systematischen Sozialwissenschaften wurde erfolgreich aufgenommen, und die Geschichte hat in der öffentlichen Diskussion an Gewicht gewonnen. Im Rückblick erweist sich diese Auseinandersetzung als eine frühe Phase des Richtungsstreites in der Historikerschaft der Bundesrepublik, der seit 1986 öffentlich ausgetragen wird.
Im Gegenzug zur Theorieorientierung, die eher von Experten als von der breiten Gruppe historisch Interessierter angenommen wurde, ist es über die → Alltagsgeschichte zu einer Gegenbewegung gekommen. Auf der Mikroebene wird im überschaubaren Feld gearbeitet. So versteht sich Erforschung der Alltagsgeschichte oft als antitheoretische Bewegung, die durch einfühlende Rekonstruktion der Lebenszusammenhänge des »kleinen Mannes« erzählend und berichtend vergangene Wirklichkeit treffender erschließt, als es nach Ansicht vieler ihrer Vertreter durch den Einsatz von Theorien möglich sei. Hier liegt die Gefahr naiver Vergangenheitserschließung. Andererseits ist festzuhalten, dass theoretisch abgesicherte Alltagsgeschichtsforschung ein Defizit der Sozialgeschichte aufhebt. Konsens besteht in der Auffassung, dass die theorieorientierten, engagierten Historiker die traditionellen Methoden der [/S. 545:] Geschichtswissenschaft nicht aufgeben, sondern hermeneutische und analytische Methode miteinander verbinden.
Der innerhalb der Geschichtswissenschaft geführte Disput hat die Grundlagendiskussion der Disziplin intensiviert. Die Auseinandersetzung wurde auf zwei Ebenen geführt. Einmal ging es um die Fragen, die das Selbstverständnis der Geschichtswissenschaft betreffen: Wodurch unterscheidet sich Geschichtswissenschaft von den systematischen Sozialwissenschaften? Wie ist das Verhältnis von Hermeneutik und analytischer Wissenschaftstheorie? Wie steht es um Wertbezogenheit und Wertfreiheit von Wissenschaft, um Objektivität und Parteilichkeit? Wie ist das Verhältnis von Verstehen und Erklären? Diese erkenntnistheoretisch und geschichtsphilosophisch orientierte Diskussion über das Selbstverständnis der Geschichtswissenschaft hat Karl-Georg Faber 1971 bilanziert. In den folgenden Jahren wurde der »Arbeitskreis Theorie der Geschichte« eingerichtet, in dem Historiker, Philosophen, Sozialwissenschaftler die begonnene geschichtstheoretische Diskussion fortführten.
Von dieser Theorie der Geschichtswissenschaft, die als Metatheorie zu bezeichnen ist, unterscheiden wir die gegenstandsbezogene Theorie des Historikers. Theorien in diesem Verständnis sind für den Historiker Instrumente, mit denen er die Quellenvielfalt ordnet. Es handelt sich bei der Metatheorie der Geschichtswissenschaft also um Begriffssysteme, die zur Identifikation und Erklärung historischer Prozesse eingesetzt werden, die aber nicht aus den Quellen selbst abgeleitet sind. Kollektive historische Phänomene können nur angemessen erforscht werden, wenn Theorien, Fragestellungen und Methoden der systematischen Sozialwissenschaften einbezogen werden. Der explizite Theoriegebrauch schafft erst die Voraussetzung, historische Realität wie Klassen, Schichten, Rollen, Status, Stratifikationen, Sozialisation zu erfassen.
Eine neue Qualität erhielt die Auseinandersetzung durch die sogenannte Historikerdebatte (oder Historikerstreit), die durch den von Ernst Nolte in der FAZ (6. 6. 1986) veröffentlichten Artikel »Vergangenheit, die nicht vergehen will. Eine Rede, die geschrieben, aber nicht gehalten werden konnte« und die Antwort von Jürgen Habermas, »Eine Art Schadensabwicklung. Die apologetischen Tendenzen in der deutschen Zeitgeschichtsschreibung«, in der ZEIT (10. 7. 1986) ausgelöst wurde.
Der bisher fachintern ausgetragene Richtungsstreit wurde nun nicht nur von Historikern, sondern auch von Publizisten und Vertretern der sozialwissenschaftlichen Disziplinen in eine breite öffentliche Diskussion eingebracht. Der Kern dieser Auseinandersetzung lässt sich auf die Kurzformel bringen: Geschichte als Aufklärung oder Geschichte als Identifikationsstifterin. Zu kurz greift die Hypothese, aufklärend-emanzipatorische Geschichtswissenschaft führe zu Destabilisierung, identitätsstiftende Geschichtswissenschaft zu Orientierung. Aufklärung und Identitätsstiftung sind zwei dominante Funktionen der Geschichtswissenschaft, die sich ergänzen. Durch Aufklärung wird tragfähige Identität gewonnen. Das so erworbene Geschichtsbild erweist sich als tragfähig, weil es offen und nicht geschlossen, rational und nicht irrational, dynamisch und nicht statisch ist. Historische Identitätsgewinnung muss Ergebnis kritischer Auseinandersetzung mit Vergangenheit sein, also traditionskritisch gewonnen werden. Für die Geschichtswissenschaft der Bundesrepublik gilt, dass die Ausfüllung von Erinnerung nicht uniform gedacht werden kann, sondern nur [/S. 546] plural. Es gibt in der Demokratie nicht das eine Geschichtsbild, sondern die Vielheit der Geschichtsbilder. Deshalb sind in der Bundesrepublik auch »verordnete Geschichtsbilder« nicht denkbar, wie irrig in einem Beitrag zum Historikerstreit geargwöhnt wird (Hans Mommsen, in: Gewerkschaftliche Monatshefte, 1/1986). Solche Intentionen würden auch angesichts der konkurrierenden Richtungen, die an den Historischen Instituten vertreten werden, nicht realisierbar sein.
3. Curriculare Voraussetzungen
Der 1973 unternommene Versuch, bisher voneinander getrennte Schulfächer durch Lernbereiche abzulösen und diese vorrangig an fächerübergreifenden gesellschaftsrelevanten Zielen auszurichten, musste scheitern, weil die wissenschaftstheoretische Fundierung fehlte. Hinzu kam, dass der politische Konsens nicht erreicht wurde und es noch keine Lehrerausbildung für dieses Fach gab.
In Hessen wurde seit 1973 an einer Neufassung der HRRG gearbeitet und 1980 das Ergebnis vorgelegt. Eine entscheidende Korrektur bestand darin, dass zu den Grundsätzen für den Lernbereich Gesellschaftslehre auch Wissenschaftsorientierung gehörte: Es wurde bei der Neufassung der Rahmenrichtlinien davon ausgegangen, dass die Wissenschaftsdisziplinen die wesentlichen gesellschaftlichen und historisch-politischen Probleme und Lerninhalte benennen und → Methoden sowie → Kategorien für ihre Bearbeitung im Unterricht zur Verfügung stellen können. Das früher bestehende Defizit in der theoretischen Grundlegung wurde also aufgehoben.
Im Jahre 1978 veröffentlichte eine Arbeitsgruppe von Historikern, Politikwissenschaftlern und Soziologen (Behrmann u. a.) das Konzept für einen kooperativen Unterricht in den Fächern Geschichte und Politik für die Sekundarstufe I. Vorgeschlagen wurde eine gestufte Verbindung zwischen geschichtlichen und politischen Unterrichtseinheiten. Die wissenschaftstheoretische Fundierung wurde hier ebenso abgesichert wie der methodische Zugriff.
Für den historischen und politischen Unterricht wurden jeweils vier Thementypen entwickelt und als Leitthemen bzw. Zusatzthemen einander zugeordnet. Thementypen des Politikunterrichts sind: die →> Erkundung, die systematische Analyse oder der → Vergleich, die → Fallstudie, die Bearbeitung eines aktuellen Problems. Die vier Thementypen des Geschichtsunterrichts werden nach Kooperationsmöglichkeiten mit dem politischen Unterricht befragt. Der erste Thementyp ist die genetisch vorgehende Erarbeitung eines historischen Prozesses, die tendenziell alle seine Faktoren fasst (z. B. Industrielle Revolution, Imperialismus) - hier gibt es über den Gegenwartsbezug kombinatorische Möglichkeiten mit dem Politikunterricht. Der zweite Thementyp ist der thematische Längsschnitt. Auch hier besteht zwischen historischem und politischem Unterricht ein ergänzender Zusammenhang. Dabei kommt es für den historischen Unterricht darauf an, dass eine der aktuellen vergleichbare Problematik in der Vergangenheit in ihren unterschiedlichen und in ihren ähnlichen Strukturen herausgearbeitet wird. Der dritte Thementyp ist die querschnittartige Repräsentation einer besonders wichtigen Epoche. Hier ist die Möglichkeit der Kooperation nur über die Methode der Analogie möglich. Im Unterschied dazu besteht eine enge Verbindung des vierten Thementyps zum politischen Unterricht. Er greift ein gegenwärtig wichtiges Phänomen der politischen Welt regressiv in [S. 547:] seiner historischen Bedingtheit auf (z. B. Revolution in Ländern der Dritten Welt, israelisch-arabischer Konflikt). Bei diesem Thementyp verbinden sich politischer und historischer Unterricht jeweils eng. Die Kombination dieser vier Thementypen des Geschichtsunterrichts und die Kooperation mit den entsprechenden Thementypen des Politikunterrichts sind als → offenes Curriculum konzipiert. Es ist also eine Vielzahl flexibler Verbindungsmöglichkeiten zwischen Geschichte und Politik zu komponieren.
Geschichtsdidaktik beschäftigt sich mit dem Prozess der Rezeption von Geschichte in der Gesellschaft. In der geschichtsdidaktischen Diskussion ist seit den 70er Jahren der Begriff Geschichtsbewusstsein als zentrale Kategorie herausgearbeitet worden. Geschichtsbewusstsein meint über geschichtliches Wissen hinaus auch Vorstellungen und Deutungen von der Vergangenheit und daraus entstehende Einstellungen. Erforscht wird das Geschichtsbewusstsein von Individuen und Kollektiven. Dabei geht es um Inhalte und Formen, um Bedingungen des Aufbaus und der Veränderung, um Bedeutung und Funktion des Geschichtsbewusstseins. Durch die Einführung des Begriffs Geschichtsbewusstsein wurde die Geschichtsdidaktik neu fundiert und ihre über den schulischen Bereich hinausreichende Dimension verdeutlicht. Ohne Geschichtsbewusstsein ist die Gewinnung sozialer und politischer Identität nicht möglich. Deshalb ist Geschichtsbewusstsein ein Schlüsselbegriff aller historischen, aber auch aller pB. Historische und politische Urteilskompetenz werden durch ein aufgeklärtes Geschichtsbewusstsein gefördert. Wenn es dem Politikunterricht um die Vermittlung von Sachwissen und jener Kompetenzen geht, die zu politischer Reflexion, → Urteilsbildung und verantwortlichem politischen Handeln befähigen, so kann er nahtlos mit einem Geschichtsunterricht kooperieren, dessen Bezugsdisziplin zunehmend einen Praxisbezug vertritt und folgende Funktionsziele betont: Geschichtswissenschaft
- schafft aufklärungsgeprägte Rationalität;
- bewahrt gesellschaftliches Wissen, ist Kollektivgedächtnis;
- interpretiert Gegenwart aus deren Vergangenheit und trägt so zur Ortsbestimmung der Gegenwart bei;
- legt Ursachen und Entwicklungen bestimmter Gegenwartsprobleme offen;
- schafft Distanz zu emotional besetzten Gegenstandsbereichen;
- zeigt die Entwicklung und Veränderung sozialer Wandlungsprozesse und weist den Rahmen der Veränderbarkeit auf;
- leistet → Ideologiekritik;
- vermittelt einen kritisch aufgeklärten Praxisbezug;
- legt Grundlagen für politische und soziale Identifikationen;
- bewahrt vor Manipulation, indem sie Erinnerung aufklärt;
- wirkt als Korrektiv gegenüber generalisierenden »Totalentwürfen«;
- motiviert durch den Aufweis welthistorischer Perspektiven zu globaler Verantwortung.
4. Perspektiven
Seit 1980 sind die wissenschaftstheoretischen Grundlagen und methodischen Absicherungen für die Konstruktion eines integrierten oder kooperativen Curriculums Geschichte/Politik geschaffen. Es liegen auch Unterrichtsmateria- [S. 548:] lien und ausgearbeitete Unterrichtseinheiten für ein Curriculum Geschichte/Politik der Sekundarstufe I vor (Behrmann u. a. 1976 ff.). Für den Bereich der Lehrerbildung wurde 1980 das Konzept eines Studienganges Sozialwissenschaften entwickelt, das von Vertretern der Geschichtswissenschaft, der → Politikwissenschaft, der → Soziologie und der → Wirtschaftswissenschaft (Forndran u. a. 1978) vorgelegt wurde. Hier wurden die wissenschaftstheoretischen Grundlagen für einen kooperativen oder integrierten Studiengang geschaffen.
Trotz dieser günstigen Ausgangsposition ist die Strategie der Historiker nicht durchgängig offensiv. Es entsteht vielmehr der Eindruck, dass sie erst wieder auf Herausforderungen reagieren. Weder in der Lehrerausbildung noch im Schulcurriculum werden Experimente gewagt. Statt dessen vollzieht sich auf der Ebene des Geschichtsunterrichts eine Entwicklung, wie wir sie aus den USA kennen. Nach einer Phase intensiver theoretischer Auseinandersetzung und konzeptioneller Entwürfe werden in den Fachzeitschriften unsystematisch neue Themen diskutiert. Dabei geht es um Inhalte wie Ökologie und Geschichte, Geschichte der Frauen, Geschichte von Minderheiten, Geschichte der Arbeit. Eine Bereicherung ist auch die intensive Beschäftigung mit der Alltagsgeschichte und die Einbeziehung der Oral-History-Methode. Es ist an der Zeit, die additiv nebeneinander stehenden neuen Themen in einem neu zu konzipierenden offenen Curriculum zusammenzufügen und die sich daraus ergebenden weiterführenden Möglichkeiten für eine Kooperation mit dem Unterrichtsfach Politik auszuloten.
Literatur
Behrmann, Günter C.; Jeismann, Karl-Ernst; Süssmuth, Hans (1978): Geschichte und Politik. Didaktische Grundlegung eines kooperativen Unterrichts. Paderborn: F. Schöningh.
Behrmann, Günter C. u. a. (Hg.) (1976 ff.): Geschichte. Politik. Unterrichtseinheiten für ein Curriculum. Paderborn: F. Schöningh.
Bergmann, Klaus; Schneider, Gerhard (Hg.) (1980): Gesellschaft, Staat, Geschichtsunterricht 1500-1980. Düsseldorf: Schwann.
Bergmann, Klaus; Kuhn, Annette; Rüsen, Jörn; Schneider, Gerhard (Hg.) (1985): Handbuch der Geschichtsdidaktik. Düsseldorf : Schwann.
Cobet, Justus; Maek-Gérard, Eva; Muhlack, Ulrich; Zitzlaff, Dietrich (1974): Zur Rolle der Geschichte in der Gesellschaftslehre: Das Beispiel der hessischen Rahmenrichtlinien. Stuttgart: Klett.
Diner, Dan (Hg.) (1987): Ist Nationalsozialismus Geschichte? Zu Historisierung und Historikerstreit. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.
Faber, Karl-Georg (1971): Theorie der Geschichtswissenschaft. München: Beck.
Forndran, Erhard; Hummell, Hans J.; Süssmuth, Hans (Hg.) (1978): Studiengang Sozialwissenschaften. Düsseldorf: Schwann.
Gies, Horst; Spanik, S. (1983): Bibliographie zur Didaktik des Geschichtsunterrichts. Weinheim: Beltz.
"Historikerstreit". Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung. München 1987.
Hoffmann, Hilmar (Hg.) (1987): Gegen den Versuch, Vergangenheit zu verbiegen. Frankfurt: Athenäum.
Iggers, Georg (1978): Neue Geschichtswissenschaft. Vom Historismus zur Historischen Sozialwissenschaft. München: dtv.
Kirchhoff, Hans Georg (Hg.) (1986): Neue Beiträge zur Geschichtsdidaktik. Bochum: Studienverlag Brockmeyer.
Kocka, Jürgen; Repgen, Konrad; Quandt, Siegfried (1982): Theoriedebatte und Geschichtsunterricht. Sonderheft 3 von Geschichte, Politik und ihre Didaktik. Paderborn: Schöningh.
Kröll, Ulrich (1983): Bibliographie zur neueren Geschichtsdidaktik. Münster: Regensberg.
Kühnl, Reinhard (Hg.) (1987): Vergangenheit, die nicht vergeht. Die "Historiker-Debatte". Dokumentation, Darstellung und Kritik. Köln: Pahl-Rugenstein.
Lüdtke, Alf; Uhl, H. (Hg.) (1974): Kooperation der Sozialwissenschaften, Teile 1 und 2. Stuttgart: Klett.
Mannzmann, Anneliese (Hg.) (1983): Geschichte der Unterrichtsfächer II. München: Kösel.
Mayer, U.; Schröder, J.: Die Hess. Rahmenrichtlinien Gesellschaftslehre - Didaktische Perspektiven und Ergebnisse der Weiterentwicklung 1972-1980. In: Quandt, Siegfried (Hg.): Geschichtsdidaktik und Lehrerfortbildung. Willich o. J.
Mickel, Wolfgang W. (Hg.) (1979): Politikunterricht im Zusammenhang mit seinen Nachbarfächern. München [/S. 549:]: Ehrenwirth.
Pellens, Karl; Quandt, Siegfried; Süssmuth, Hans (Hg.) (1984): Geschichtskultur - Geschichtsdidaktik. Paderborn: Schöningh.
Rohlfes, Joachim (1986): Geschichte und ihre Didaktik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Rohlfes, Joachim (1985): Geschichtsdidaktik und Gesellschaft. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, Jg. 36 (8).
Rüsen, Jörn (1986): Grundlagenreflexion und Paradigmawechsel in der westdeutschen Geschichtswissenschaft. In: Geschichtsdidaktik 4.
Rüsen, Jörn; Süsmuth, Hans (Hg.) (1980): Theorien in der Geschichtswissenschaft. Düsseldorf: Schwann.
Schörken, Rolf (Hg.) (1978): Zur Zusammenarbeit von Geschichts- und Politikunterricht. Stuttgart: Klett.
Süssmuth, Hans (Hg.) (1984): Historische Anthropologie. Der Mensch in der Geschichte. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Sutor, Bernhard (1979): Geschichte als politische Bildung. In: Mickel, Wolfgang W. (Hg.): Politikunterricht im Zusammenhang mit seinen Nachbarfächern. München [/S. 549:]: Ehrenwirth.
Sutor, Bernhard (1979): Zum Verhältnis von Geschichte und Politikunterricht. Politische Bildung im Fächerverbund. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. B 34-35/79.
Uffelmann, Uwe (1986): Didaktik der Geschichte. Aus der Arbeit der Pädagogischen Hochschulen BadenWürttembergs. Villingen-Schwenningen: Neckar.
Sutor, Bernhard (1984): Exkurs V: Geschichtsunterricht und politische Bildung; S. 221-23, in: Neue Grundlegung politischer Bildung, Bd. II, 1984, Paderborn: Ferdinand Schöningh
Die didaktische Analyse der Aufgabenfelder politischer Bildung, wie wir sie in Kapitel D vorgenommen haben, hat an vielen Stellen nachdrücklich demonstriert, wie sehr politisches Urteilen auf geschichtliches Verstehen angewiesen ist. Das kann nicht überraschen. Wenn Geschichtlichkeit eine anthropologische Konstante ist, muss sie auch als soziologische, als politikwissenschaftliche und als didaktische Grundkategorie erscheinen. Es gibt nicht die reine Gegenwart; der Versuch, sie vorzustellen, trifft nur auf den jeweiligen Punkt im Strom der Zeit. Es ist daher im Ansatz verständlich und richtig, dass seit Jahrzehnten um eine plausible didaktische Zuordnung von Geschichte und Politikunterricht gerungen und der Beitrag der Geschichte zur politischen Bildung diskutiert wird. Die Schwierigkeit der Aufgabe erhellt aus der Tatsache, dass diese Diskussion bisher zu keinem allgemein anerkannten Konzept geführt hat. Bildungspolitisch hat sich der Streit der siebziger Jahre zwar gelegt, aber die Grundfrage blieb unentschieden. Dem Konzept einer integrierten Gesellschaftslehre steht das Beharren auf eigenständigem Geschichtsunterricht gegenüber. Die geschichtsdidaktischen Positionen stehen gewiss differenzierter dazwischen, aber keineswegs in einem in Lehrpläne umsetzbaren Konsens (Süssmuth 1980). Ich selbst habe in den siebziger Jahren in Rheinland-Pfalz an koordinierten Lehrplänen für das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld der reformierten gymnasialen Oberstufe mitgearbeitet und habe das dabei entwickelte Konzept in Auseinandersetzung mit didaktischer Literatur in Aufsätze einfließen lassen (Sutor 1979 sowie Sutor bei Mickel 1979). Die nachstehende Skizze ist im wesentlichen eine Zusammenfassung des dort Entwickelten.
1. Didaktische Folgerungen aus der Grundkonstante Geschichtlichkeit
Wenn menschliches Dasein in der Gesellschaft prinzipiell geschichtlich verfasst ist (B I 3), dann ergeben sich daraus didaktisch relevante Folgerungen, die kurz genannt seien:
Erstens: Die Handlungsprobleme menschlichen Zusammenlebens müssen bewältigt werden in der Spannung zwischen Dauer und Wandel, zwischen einer Überlieferung, die Geltung beansprucht, und Fortschritt, der aus Veränderungswillen entspringt. Überlieferung und Fortschritt bilden keinen reinen Gegensatz, sondern stehen in einem dialektischen Verhältnis. Fortschritt hat die menschliche Gesellschaft nur, weil sie Tradition bildet. Es wäre daher falsch, Geschichtsunterricht und politische Bildung prinzipiell aus konservativer oder aus progressiver Grundhaltung zu konzipieren. Nur erkannte Geschichte macht frei zu Aneignung oder Kritik des Überlieferten. Historisch-politische Bildung soll deshalb Traditionen weder tabuisieren und naiv pflegen, noch sie progressistisch verwerfen, sondern zum Gegenstand des Nachdenkens machen.
Zweitens: Geschichtlichkeit bedeutet Offenheit und Unvollendbarkeit der Geschichte. Wir kennen nicht die Geschichte als ganze und können sie nicht von einem idealen Endzustand her begreifen. Geschichte ist keine Einbahnstrasse des Fortschritts, auf der von einem idealen Ende her Antworten auf unsere heutigen Probleme zu finden und die Opfer der Vergangenheit und Gegenwart zu rechtfertigen wären. Gegenwartsprobleme können nur durch partielle Verbesserungen gelöst werden, die ihren Preis haben. Geschichtsphilosophische Totalbilder, so unentbehrlich sie als Denkhorizonte sein mögen, dürfen nicht verabsolutiert und nicht als Ergebnisse der Geschichtswissenschaft dargestellt werden. Der Geschichtsunterricht kann sie bewusst machen und zugleich relativieren, indem er mehrere vergleichend nebeneinander betrachtet. Wenn dagegen Geschichte über den Leisten angeblich erkannter Gesetzmäßigkeiten geschlagen wird, dann wird das konkrete Einzelne missdeutet und missachtet, dann werden Menschen und Gruppen in prinzipielle Freund-Feind-Schablonen gepresst. "Wer die Menschheit der Zukunft als Partei in der Gegenwart reprä[/S.:222]sentiert, hat damit eo ipso alle anderen Parteien in die Partikularität verwiesen, so dass sie als Instanzen der Kritik rechtlos werden" (Lübbe bei Oelmüller 1977, 312). Offenes Geschichtsbild und offene Gesellschaft, historischer und politischer "Relativismus" bedingen einander. Allerdings bedeutet dieser Relativismus nicht normative Beliebigkeit (B I 1/2).
Drittens: Relativismus heißt nicht Flucht in die angeblich reinen Fakten, heißt nicht Absage an Norm- und Wertvorstellungen, heißt nicht Ausweichen vor den Sinnfragen. Im Gegenteil verweist die hier vorgenommene Auslegung von Geschichtlichkeit auf die Verantwortung der jeweils Lebenden und Handelnden für den Gang der menschlichen Dinge. In der Offenheit der jeweiligen geschichtlich-politischen Situation müssen die Menschen Antworten finden auf konkrete Herausforderungen nach Maßgabe sittlicher Prinzipien, deren Geltung sie in ihrem Gewissen vernehmen und in Kommunikation miteinander ergründen.
Viertens: Geschichtlichkeit des Menschen in der Gesellschaft bedeutet auch, Macht und Verantwortlichkeit des Individuums und der heute Lebenden insgesamt nicht idealistisch zu überzeichnen. Das Gewordene, die sozialen Strukturen, die überlieferten Normen und Institutionen, die "Verhältnisse" erfährt der einzelne Mensch zutreffend zunächst einmal als übermächtig. Die in didaktischer Literatur in den siebziger Jahren ständig zitierte Formel "historisch geworden, also veränderbar" ist irreführend. Geschehenes und Gewordenes können wir nicht rückgängig machen. Dem Geschehenen gegenüber können wir uns nur bemühen, in Freiheit unser Verhältnis zu ihm zu bestimmen. Dies ist der reale Kern der sogenannten Bewältigung der Vergangenheit. Das Gewordene, das institutionelle Gefüge und die Strukturen einer Gesellschaft sind von "langer Dauer", sie entziehen sich daher kurzfristigem Veränderungswillen. Übrigens zeigen die im Gefolge raschen sozialen Wandels der letzten Jahrzehnte zu beobachtenden Phänomene wie Daseinsunsicherheit und Mangel an Sinnorientierung, daß Mensch und Gesellschaft auf eine gewisse relative Stabilität ihrer Normen, Institutionen und Strukturen angewiesen sind. Das meiste an sozialem Wandel geschieht wahrscheinlich unmerklich und ungewollt, und gerade deshalb gilt, dass man gezielt verändern soll nur, was man verbessern kann.
2. Geschichtlich-politisches Bewusstsein
Geschichtliches und politisches Bewusstsein bilden unabhängig vom Grad ihrer Reflexion einen unauflösbaren dialektischen Zusammenhang. Das Bewusstsein von politischen Problemen und der Wille zu politischer Gestaltung sind geschichtlich bedingt, und ihre ungewisse Zukunftsperspektive begründet ein Bedürfnis, sich der Gegenwart aus der Vergangenheit zu vergewissern. Daher wird Geschichte häufig zu einem Arsenal für Legitimation und Identifikation im politischen Handeln sozialer Gruppen. Das Selbstverständnis von Individuen und Gruppen hat eine geschichtliche Dimension, schließt mindestens rudimentär ein Bewusstsein von Vergangenheit und Einstellungen zur Vergangenheit ein. Die Menschen leben mit Geschichtsbildern, sie suchen ihre Identität in Auseinandersetzung mit Vergangenem, das sie als wirksam erfahren. Daher ist im Mit- und Gegeneinander der sozialen und politischen Gruppierungen immer auch Geschichte wirksam anwesend, wird zur Sprache gebracht und gedeutet. "Ein historisch-politisches Standortwissen ist gleichsam ,sprungbereit' von seiner Deutung der Geschichte und der gegenwärtigen Situation auf die Zukunft gerichtet" (Bergsträßer 1963, 14).
Geschichte ist daher, wie schon Augustinus in seiner berühmten Analyse der menschlichen Erinnerung darlegte, nicht die in sich stehende Vergangenheit, sondern die Gegenwart der Vergangenheit in der Erinnerung. Geschichte ist also einerseits niemals ohne Gegenwartsbezug, ein Geschichtsbild wird von den Erfahrungen der Gegenwart her strukturiert; andererseits beeinflusst die erinnerte Vergangenheit die Wahrnehmung der Gegen[/S.:223]wart und den Zukunftswillen (Keßler bei Schörken 1981, 26 ff.). Jörn Rüsen fasst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunftsperspektive überzeugend in folgender Definition von Geschichte zusammen: "Geschichte ist derjenige Zusammenhang zwischen Vergangenheit und Gegenwart, den handelnde Individuen und Gruppen reflektieren müssen, wenn sie ihr Handeln sinnhaft in einer Zukunftsperspektive orientieren wollen" (Rüsen bei Kosthorst 1977, 48). Für Geschichtswissenschaft wie für Geschichtsunterricht bedeutet dies, dass sie, wie immer man im einzelnen ihre Funktionen bestimmt, unabdingbar in einem Gegenwartsbezug stehen.
Geschichtswissenschaft ist in ihrem Zugriff auf ihren Gegenstand, in ihrem Erkenntnisinteresse, in ihren Fragestellungen und in ihrer Problemwahl vom herrschenden Geschichtsbewusstsein und damit auch von der Gegenwart bestimmt. Ihre Objektivität besteht nicht darin, dass sie Vergangenheit gleichsam photographisch abbildet. Vielmehr macht sie Geschichte im definierten Sinn unter bestimmten theoretischen Prämissen zum Gegenstand von Fragen, untersucht sie nach intersubjektiv anerkannten Regeln und stellt ihre Antworten fachlich und öffentlich zur Diskussion. Der öffentliche Bezug war großer Geschichtsschreibung immer wesentlich. Kein wirklicher Historiker schreibt nur für den kleinen Kreis von Zunftgenossen. Geschichtsschreibung bezieht sich auf öffentliches Geschichtsbewusstsein, hat insofern also auch eine didaktische Komponente. Dies ist in der heutigen "Historik" allgemein anerkannt, freilich wird der Gegenwartsbezug der Geschichtswissenschaft von den Forschern und einzelnen Forschungsrichtungen unterschiedlich gewichtet und ausgelegt.
Leider sind die Neuansätze geschichtswissenschaftlicher Selbstbesinnung, die in der Nachkriegszeit zu beobachten waren, in der didaktischen Diskussion zunächst relativ unbeachtet geblieben. Eine gesellschaftskritische Geschichtsdidaktik der siebziger Jahre konnte daher so tun, als pflege die deutsche Geschichtswissenschaft fern von den Fragen unserer Zeit einen "objektivistischen Irrtum" in ihrem Elfenbeinturm. Dagegen ist die gesellschaftlich-politische Relevanz der Geschichtswissenschaft, ihr lebensweltlicher Ursprung lange vor dem Streit um Richtlinien für Gesellschaftslehre und Politikunterricht gründlich erörtert worden. Die Beiträge hierzu von Heimpel und Wittram stammen aus den fünfziger Jahren, Walther Hofers Studien zum modernen Geschichtsdenken ebenfalls. 1961 erschien das "Fischer-Lexikon Geschichte", welches die von Hans Rothfels und seinen Schülern geleistete Rückbesinnung auf die politischen Implikationen der Geschichtswissenschaft darstellte. Diese Neuansätze erbrachten damals zweierlei: Erstens klärten sie im Zuge einer Revision deutscher Geschichtsbilder den in Deutschland bis zum Nationalsozialismus greifbaren Zusammenhang von Historismus und nationalkonservativer Weltanschauung. Zweitens gewannen sie dem unvermeidlichen Ineinander von Geschichtsdenken und Gegenwartsbewusstsein positive Züge ab durch die Entwicklung einer modernen Kritik der historischen Vernunft, jenseits von Objektivismus und Irrationalismus.
Während in diesen Ansätzen eine Balance versucht wurde zwischen dem Gegenwartsbezug historischen Forschens und seiner Verpflichtung, der untersuchten Vergangenheit gerecht zu werden, dominiert bei manchen heutigen, insbesondere jüngeren und sozialwissenschaftlich ausgerichteten Historikern das gegenwärtige Erkenntnisinteresse so sehr, dass sie ihre Wissenschaft unter das Ziel stellen, einen unmittelbaren und handlungsorientierten Sinnzusammenhang zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu konstruieren (Rohlfes bei Schörken 1981, 63 ff.). Was sich daraus an Gefahren für die Wissenschaftlichkeit der Geschichtswissenschaft ergibt, mag in der fachwissenschaftlichen Diskussion erörtert werden. Für unseren Zusammenhang ist der auch von Rohlfes ins Feld geführte nachdrückliche Hinweis nötig, dass die Gegenwart selbst keine einheitliche Größe ist und also schon deshalb keine altgemeingültigen Sinnlinien zwischen Vergangenheit und Gegenwart konstruiert werden können. Es gibt die unterschiedlichen weltanschaulichen und politischen Lager, die sozialen Gruppierungen und Interessen, die zwischen Indivi[/S.:224]duen und Generationen divergierenden Lebenserfahrungen und Wertüberzeugungen. Wenn Geschichtswissenschaft und Geschichtsunterricht etwas zur Klärung der Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegenwart beitragen wollen, dürfen sie an dieser Pluralität nicht vorbeigehen.
3. Traditionsreflexion und Hilfe zur Identitätsfindung als Aufgaben des Geschichtsunterrichts
Joachim Rohlfes zitiert in unserem Zusammenhang das bekannte Wort von Jacob Burckhardt, Geschichte solle nicht klug machen für ein andermal, sondern weise für immer. Dieser der klassisch-humanistischen Bildungsvorstellung verpflichtete Gedanke repräsentiert den Versuch, die Beschäftigung mit Geschichte aus einer allzu engen pädagogisch-politischen Zwecksetzung zu befreien. Bei aller Skepsis gegenüber der Tragfähigkeit dieser Bildungsvorstellung muss man bedauern, dass die Geschichte des Geschichtsunterrichts anders aussieht. Die Indienstnahme dieses Schulfaches durch die Herrschenden ist nicht erst ein Phänomen des Nationalsozialismus, sondern lässt sich bis weit ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Übrigens kann angesichts dieser Fachgeschichte die geschichtsdidaktische Ratlosigkeit der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht überraschen. Das Fach hatte seinen bis dahin herrschenden politischen Orientierungsrahmen verloren (Bergmann/Schneider 1982).
Geschichtsunterricht in den öffentlichen Schulen einer demokratisch verfassten pluralistischen Gesellschaft ist an die Bedingungen der Pluralität geknüpft, ist auf wissenschaftliche Rationalität und auf die allgemein anerkannten Wertgrundlagen der gemeinsamen Verfassung verpflichtet. Gerade deshalb darf er nicht unter partikularen politischen Zwecksetzungen stehen, vielmehr muss seine politische Aufgabe konsensfähig formuliert werden. Im Hinblick auf den dargestellten Zusammenhang geschichtlich-politischen Bewusstseins kann man die Aufgabe des Geschichtsunterrichts definieren als historische Aufklärung. Aber Aufklärung und Rationalität machen nicht halt beim Infragestellen und Reflektieren. Wie immer der einzelne Historiker sein Fach versteht und betreibt, in der Schule müssen Aufklärung und Rationalität den anthropologisch grundlegenden Tatbestand umschließen, dass der Mensch ein sinnsuchendes und wertorientiertes Wesen ist und folglich mit bloßer Kritik nicht leben kann. Halbe Aufklärung heißt Auflösung von Traditionen und Identifikationen, ganze Aufklärung erweist Urteilsbildung, wertende Stellungnahme und Identifikation mit Sinnhaftem als human und sozial notwendig. Auch wenn wir die Möglichkeiten der Schule in unserer Gesellschaft nicht überschätzen wollen, kann sie dazu doch einiges beitragen.
Der Geschichtsunterricht kann den Schülern ihre eigene geschichtlich bedingte und vielleicht bisher unreflektiert gelebte Identität bewusst machen durch das Aufzeigen unterschiedlicher Orientierungen von Individuen und Gruppen an ihrer spezifischen Geschichte. Dies ist in einer pluralen Gesellschaft unumgänglich, es erleichtert das Zusammenleben und das gegenseitige Verständnis der Gruppen und ist gerade in Deutschland angesichts der pluralistischen Züge unserer Geschichte besonders notwendig. Die Pluralität unserer Identitäten darf nicht durch eine Einheitsideologie einer Großgruppe, auch nicht durch die einer Nation verdeckt werden (B II Exkurs I). Ferner kann der Geschichtsunterricht das Phänomen der Legitimation gegenwärtiger Verhältnisse aus geschichtlicher Erinnerung aufzeigen und dadurch kritisch machen, vielleicht sogar schützen gegen die Gefahr der Kurzschlüssigkeit und Ideologisierung. Zwar ist die öffentliche Pflege geschichtlicher Erinnerung nicht nur legitim, sondern auch in einer demokratisch verfassten Gesellschaft notwendig, die sich an der Vergewisserung ihrer Ursprünge nicht hindern lassen sollte angesichts der Perversion von Tradition durch Diktaturen. In der Bundesrepublik Deutschland haben wir einen eklatanten Mangel an öffentlicher Traditionspflege. Aber nach den Maßstäben von Humanität, Rationalität und Demokratie ist sie nur legitim als [/S.:225] Ausdruck der Bereitschaft, das Bestehende auch messen zu lassen an dem im Ursprung positiv gemeinten Sinn einer freien Ordnung. Deshalb löst kritisch-rationaler Unterricht auf der Basis dieser Maßstäbe positive geschichtliche Legitimation und Identität nicht auf, sondern reinigt sie, gibt ihr eine rational tragfähige Grundlage.
Hermann Giesecke bezeichnet die historische Selbstvergewisserung der demokratischen Gesellschaft als eine Aufgabe des Unterrichts und grenzt die dabei zu zeichnende "politische Biographie" dieser Gesellschaft gegen ein geschlossenes und verbindliches Geschichtsbild ab (Giesecke 1974, 58 ff.). Dem kann ich voll zustimmen, sehe jedoch in den Diskussionen der siebziger Jahre Anlass hinzuzufügen, dass in der Rückfrage heutiger Demokratie nach ihren Ursprüngen die Offenheit des Demokratiekonzepts und der Geschichtsdeutung einander entsprechen müssen. Es darf nicht eine partikulare Richtung die Traditionen des demokratischen Verfassungsstaates für sich allein in Anspruch nehmen, etwa um ihr Programm als die allein legitime Einlösung demokratischer Verheißungen zu verabsolutieren. Kritischer Geschichtsunterricht verträgt sich mit keiner Art von Einbahn- und Endpunkt-Denken, ganz gleich ob es sich "national" oder "sozialistisch" oder "emanzipatorisch" vorführt. Solches Denken wird der Ambivalenz und der Kontingenz des Geschichtlichen und der Offenheit der Zukunft nicht gerecht.
Schließlich kann Geschichtsunterricht die Identitätsfindung von Individuen, von Gruppen und Gesamtgesellschaft zwar nicht selbst und unmittelbar leisten, aber Möglichkeiten dazu anbahnen, indem er das Verhältnis von Zustimmung und Kritik prinzipiell offenhält, sich dabei jedoch nicht in angebliche Wertneutralität flüchtet, sondern die Sinn- und Wertfragen an den konkreten historisch-politischen Gegenständen offen zur Sprache bringt. Identitätsfindung steht dann nicht im Gegensatz zu Kritik, sie ist freilich nicht eine neben anderen stehende und in gleicher Weise erfüllbare Funktion des Unterrichts, sondern nur eine Möglichkeit jenseits der unmittelbaren Ziele. Was Wissenschaft und Schule in einer pluralistischen Gesellschaft leisten können, ist Humanisierung durch Rationalisierung, Ordnung der Vorstellungswelt in dialogischer Auseinandersetzung. Gelebte Identitäten müssen durch diesen Prozess hindurch wie durch eine Feuerprobe und erweisen sich nur so als tragfähig in einem kontrollierten Selbstverständnis der Individuen und Gruppen wie auch für das friedlich-freiheitliche Zusammenleben in den inner- und zwischenstaatlichen Konfliktfeldern.
4. Integration oder Koordination der Fächer?
Da alle tiefer reichenden politischen Probleme der Gegenwart eine geschichtliche Dimension haben, deren Aufarbeitung für das Gegenwartsverständnis hilfreich, oft sogar unentbehrlich ist, wurde in manchen Konzepten historisch-politischer Bildung gefolgert, Geschichte ließe sich gleichsam ohne Rest in Gegenwartskunde oder Gesellschaftslehre oder Politikunterricht integrieren. Der Beitrag der Geschichte zur politischen Bildung würde sich dann darin erschöpfen, die geschichtliche Entwicklung gegenwärtiger Probleme zu erschließen. Unterrichtsorganisatorisch sollte das so aussehen, dass anlässlich gegenwärtiger Probleme und Konflikte zurückgefragt wird nach ihrer Entstehung und Entwicklung. Im methodisch unzulänglichen Falle führt dies dazu, Geschichte zum "Steinbruch", zum Arsenal für Versatzstücke innerhalb gegenwärtiger interessenbedingter und ideologischer Positionen zu degradieren. Aber die Analyse der geschichtlichen Herkunft gegenwärtiger Probleme kann durchaus auch den Erfordernissen historischer Methode genügen, und ohne Zweifel liegt in solcher Erklärung ein wesentlicher Beitrag der Geschichte zur politischen Bildung. Dennoch ist es ein Kurzschluss zu meinen, auf diese Weise ließe sich Geschichte befriedigend in Politikunterricht integrieren.
Gegen diese Versuche soll hier zunächst gar nicht wissenschaftstheoretisch und prinzipiell argumentiert werden. Wenn man voraussetzen kann, dass ein Lehrer in Geschichte und Sozialwissenschaften gründlich ausgebildet ist, dann kann es für ihn und für seine [/S.:226] Schüler eine reizvolle Aufgabe sein, bestimmte Gegenstände bzw. Themen, die durchaus nicht nur aus der Gegenwart zu stammen brauchen, sowohl in historischer als auch in sozialwissenschaftlicher Perspektive mit den entsprechenden Kategorien und Methoden zu bearbeiten. Geschichts- und Sozialwissenschaften sind sich zumal seit der Entwicklung historischer Sozialwissenschaft nicht mehr so fern und fremd, dass man sie nicht auch im Unterricht aufeinander beziehen könnte. Das ist prinzipiell in zwei Weisen möglich. Erstens kann man den gleichen Gegenstand im Wechsel zwischen historischer und sozialwissenschaftlicher Perspektive angehen. Zweitens kann man unterschiedliche Gegenstände beider Fächer vergleichender Fragestellung unterwerfen; etwa, indem man eine historische Strukturanalyse früherer Institutionen und Systeme neben eine gegenwartsbezogene Systemanalyse stellt, eine historische Konstellationsanalyse neben eine politikwissenschaftliche Fallanalyse. Die beiden Disziplinen überschneiden sich in ihren Methoden und Kategorien, wenn sie sich auch nicht völlig decken; sie unterscheiden sich wie jede wissenschaftliche Disziplin von der anderen durch ihre spezifische Perspektive, durch ihr Formatobjekt (Schieder 1977; Sutor bei Mickel 1979).
Aber mit solchen Versuchen, die den kundigen Fachmann voraussetzen, wären die beiden Fächer nicht integriert. Bei näherem Zusehen, nämlich bei dem Versuch festzulegen, was denn inhaltlich aus Geschichte und Gegenwart miteinander in Beziehung gesetzt oder in Parallele zueinander bearbeitet werden soll, erweist sich Integration unterrichtsorganisatorisch und gegenständlich als unmöglich. Dies lässt sich schon an den Versuchen, geschichtliche Entwicklungen und gegenwärtige Problemlagen aufeinander zu beziehen, erkennen. Wie weit kann und soll man im Politikunterricht Gegenwartsprobleme und -phänomene in ihre Vergangenheit zurückverfolgen? Die Deutschlandfrage beginnt aktuell mit dem Jahr 1945, hat aber freilich sehr viel weiter zurückreichende Wurzeln. Die Geschichte unserer politischen Parteien reicht ins 19. Jahrhundert, ebenso das sozialstrukturelle Problem des Verhältnisses von Kapital und Arbeit, die Institutionen sozialer Sicherheit und vieles andere. Die Geschichte des Parlamentarismus beginnt im Mittelalter, die des Rechtsstaates in der frühen Neuzeit, die der modernen Demokratie spätestens in der Aufklärung. Kurzum, es ist historisch gesehen immer willkürlich, mit den Rückfragen in die Geschichte an einer bestimmten Stelle kaltzumachen. Vor allem aber gewinnt die Genese unserer heutigen tieferreichenden Probleme in allen Fällen schon vom Umfang her den Charakter eines eigenen Themas, das unterrichtsorganisatorisch nicht mehr in die Bearbeitung eines aktuell-gegenwärtigen Problems einzuordnen ist. Für eine erste vorläufige Orientierung im Politikunterricht mag es oder muss es oft genügen, einige Stichworte zur geschichtlichen Entwicklung einzuführen. Aber gerade deshalb ist es auch um politischer Bildung und um eines fundierten Gegenwartsverständnisses willen nötig, unabhängig davon Geschichte breiter und gründlicher zu betrachten. Man kann Geschichte nicht gleichsam nebenher bei Gelegenheit aktueller Probleme und Konflikte abhandeln.
Es handelt sich bei der geschilderten Schwierigkeit allerdings nur scheinbar um eine rein unterrichtsorganisatorische. Just an dem Konzept politischer Bildung, wie wir es hier entwickelt haben, lässt sich die Erkenntnis ablesen, dass ein unter Handlungs- und Zukunftsperspektiven auf politisches Urteilen zielender Politikunterricht nur die eine Seite politischer Bildung ausmacht und dringend der Ergänzung durch einen Geschichtsunterricht bedarf, dessen Ziel historische Ortsbestimmung der Gegenwart lautet. Die geschichtliche Dimension der Gegenstände, mit denen der Politikunterricht sich befasst, ist unter der Kategorie der Geschichtlichkeit allein, die uns oben als eine unter vielen Kategorien begegnet ist (vgl. C III 1), gar nicht hinlänglich erfasst. Denn Geschichtlichkeit durchdringt auch alle anderen Kategorien des Politischen, auch diese haben geschichtlichen Charakter. Heutige Interessen und ihre Interpretationen, die Ideologien, die sozialen Strukturen, das geltende Recht und die Institutionen, die Machtverhältnisse und schließlich unsere normativen Vorstellungen von Legitimität und Zumutbarkeit, von individueller und politischer Freiheit, von sozialer Gerechtigkeit und von Frieden sind allesamt geschichtlich geworden [/S.:227] und bedürfen deshalb um politischer Bildung willen historischen Verstehens. Bildhaft ausgedrückt heißt dies: Geschichte trifft nicht wie in einem einzigen Punkt auf unsere Gegenwart, sondern bestimmt diese als breiter Strom, der aus der Vergangenheit auf uns zukommt. Geschichte ist deshalb nicht punktuell von einzelnen Problemen und Konflikten der Gegenwart her angemessen erfassbar. Deshalb darf Geschichte gerade auch um politischer Bildung willen nicht reduziert werden auf die Bearbeitung der Genese heutiger Probleme. Er muss vielmehr didaktisch kategorial eigenständig gefasst werden, wenn historische Ortsbestimmung der Gegenwart nicht an einem zu engen Ansatz scheitern soll.
Unter diesem Aspekt erweist sich als das Hauptproblem der Geschichtsdidaktik nicht die Frage nach kategorialen und methodischen Lernpotentialen der Geschichte; darin ist vielmehr relativ leicht ein gewisser Konsens zu erzielen (Rohlfes 1974, Sutor bei Mickel 1979) und die dort verarbeitete Literatur). Das schwierigere Problem ist die Bestimmung der Inhalte geschichtlicher Bildung, die für eine historische Ortsbestimmung der Gegenwart unabdingbar sind. Diese Aufgabe kann nur gelöst werden, wenn wir nicht nur aus unserer Gegenwart in die Geschichte zurückfragen, sondern zugleich umgekehrt den Versuch machen, die Gegenwart im geschichtlichen Zusammenhang zu begreifen. Nur so lassen sich fatale Verengungen vermeiden, die in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen sind. Zwar hat die Geschichtsdidaktik nach dem Zweiten Weltkrieg nacheinander einige Verengungen überwunden, so die nationalstaatliche durch die Hereinnahme europäischer und weltgeschichtlicher Perspektiven; so die personalisierende und idealisierende Geschichtsbetrachtung durch stärkere Berücksichtigung der Sozialgeschichte als Bereich und der Strukturgeschichte als Aspekt seit Ende der sechziger Jahre. Umso erstaunlicher ist es, dass immer wieder neue Verengungen von einem einseitig verstandenen Gegenwartsbezug her didaktisch legitimiert werden. Neben dem weiter oben schon zurückgewiesenen emanzipatorischen Ansatz einseitiger Geschichtsbetrachtung hat sich in den sechziger und siebziger Jahren im Zuge der Diskussion um Fächerintegration besonders eine inhaltliche Verengung ausgewirkt, nämlich eine Verkürzung unserer Geschichte auf die Zeit etwa seit der Aufklärung und der Französischen Revolution.
Es ist im Prinzip nichts einzuwenden gegen ein inhaltliches Überwiegen neuzeitlicher und zeitgeschichtlicher Themen; denn je mehr wir an unsere Gegenwart herankommen, umso stärker haben wir es mit unserer eigenen unmittelbaren Vorgeschichte zu tun, umso vielfältiger werden die Bezüge zu heutigen Fragen, die historisch aufweisbar und erfahrbar sind. Historisch fundiertes Gegenwartsverständnis ist daher viel stärker auf Detailkenntnis etwa aus dem 19. und 20. Jahrhundert angewiesen als auch solches aus Antike und Mittelalter. Dennoch muss die Vorstellung, die Genese unserer Zeit reiche nur bis zur Aufklärung zurück, als ein unhistorischer Kurzschluss bezeichnet werden. Vielmehr ist gerade unsere Gegenwartssituation sowohl innergesellschaftlich wie zwischenstaatlich derart, dass ihre historische Ortsbestimmung einer universalgeschichtlichen Sicht bedarf. So treten etwa die Eigenarten und Probleme einer industriell-technisch bestimmten Gesellschaft umso deutlicher hervor, je mehr man sie im Kontrast zu vorindustriellen Gesellschaftsformen betrachtet. Das Zusammenwachsen der Völker der Erde zu einer Verkehrs-, Wirtschafts- und Kommunikationseinheit stellt heute die Kunst der Politik vor Aufgaben, die in ihrer Besonderheit erst in universalgeschichtlicher Anschauung hervortreten. "Wird Politik zur Weltpolitik, so ist die weltgeschichtliche Besinnung ihr notwendiges Korrelat" (Bergsträßer 1963, 36). Die Auswahlfrage für eine historische Ortsbestimmung der Gegenwart kann daher didaktisch nur sinnvoll diskutiert werden, wenn man zunächst davon ausgeht, dass die ganze Geschichte der Menschheit mögliches Arbeitsfeld für einen Geschichtsunterricht ist, der zum Gegenwartsverständnis beitragen soll. Aus diesem Feld unübersehbarer möglicher Gegenstände darf dann freilich nicht beliebig und willkürlich ausgewählt werden; denn es geht um unsere Geschichte, um den Zusammenhang unserer Gegenwart mit unserer eigenen Vergangenheit. [/S.:228]
Folgende Auswahlaspekte, die in didaktischer Literatur, freilich in unterschiedlicher Gewichtung, alle diskutiert werden, scheinen mir unentbehrlich für den didaktischen Entwurf eines Geschichtsunterrichts, der ohne Verengung der Aufgabe historischer Ortsbestimmung der Gegenwart dienen soll:
- Fragen aus der Gegenwart an die Geschichte: Welche fundamentalen und permanent aktuellen Probleme unserer Zeit bedürfen der historischen Aufklärung?
- Fragen nach unserem Selbstverständnis aus der Geschichte: Welche geschichtlichen Kräfte und Entwicklungen haben uns, unsere Zeit, unsere Gesellschaft, ihre Ordnungs- und Lebensformen grundlegend geprägt?
- Fragen nach Geschichte als Alternative: Welche Phänomene unserer Tradition sind so abgeschlossen, dass sie im Vergleich und Kontrast das Spezifische unserer Zeit klarer erkennen lassen?
- Fragen nach der Geschichte als anthropologisch-soziales Erfahrungsfeld: Welche geschichtlichen Phänomene und Ereignisse sind besonders geeignet (und wissenschaftlich erschlossen), zu menschlicher Selbsterkenntnis und zur sozialen Erfahrung von Möglichkeiten und Grenzen menschlichen Handelns beizutragen?
- Fragen nach Geschichte als Erkenntnisproblem: Welche Gegenstände sind besonders geeignet und wissenschaftlich aufbereitet zur Vermittlung kategorialer Einsichten und methodischer Fähigkeiten im Umgang mit Geschichte sowie zur Klärung geschichtlichpolitischer Grundbegriffe?
Gewiss lässt sich mit Hilfe dieser Aspekte kein Kanon notwendiger Gegenstände begründen. Aber es lassen sich die Umrisse eines Feldes von Themen zeichnen, das im ganzen als unsere deutsche und europäische Geschichte im weltgeschichtlichen Zusammenhang zu bezeichnen wäre. Daher sollte der Geschichtsunterricht unserer öffentlichen Schulen auf jeden Fall Teilthemen aus folgenden Themenkreisen enthalten:
- Sozialstrukturen und politische Ordnungsformen vorindustrieller Gesellschaften in einer auf die europäische Entwicklung bezogenen Auswahl (etwa: Neolithische Revolution und Hochkulturen; Griechische Polis; Römische Republik und ihre Entwicklung vom Stadtstaat zum Imperium; Reich, Kirche und Feudalordnung im Mittelalter).
- Der Umbruch des europäischen Gesellschafts- und Wirtschaftssystems und die Ausformung des Staates zu Beginn der Neuzeit (etwa: Frühkapitalismus und Frühkolonialismus; Reformation und Religionskriege; Absolutismus und europäisches Staatensystem).
- Die geistig-politische und wirtschaftlich-soziale Grundlegung der modernen Zeit im 18. und 19. Jahrhundert (Aufklärung und westlich-liberale Demokratie; Industrielle Revolution, Soziale Frage und unterschiedliche Konzepte ihrer Bewältigung; Liberalismus und Nationalstaat in Deutschland).
- Weltkriege und Weltkrisen im 20. Jahrhundert (Imperialismus und Erster Weltkrieg; Demokratie, Faschismus/Nationalsozialismus und Kommunismus; Zweiter Weltkrieg und Ost-West-Dualismus einschließlich Deutsche Frage; Entkolonialisierung und Entwicklungsproblematik).
Damit haben wir weder einen fertigen Themenkatalog, noch soll hier plädiert werden für den chronologischen Durchgang durch die Geschichte. Was die Struktur und die Reihenfolge einzelner Themen betrifft, so legt gerade die Vielfalt der kategorialen, der methodischen und inhaltlichen Aspekte, die in der Geschichtsdidaktik heute diskutiert werden, eine gewisse Abkehr vom nur chronologischen Durchgang nahe. Dies käme auch der Koordination des Geschichtsunterrichts mit dem Politikunterricht zugute. Der Widerstand gegen diese Konsequenz stammt aus dem Missverständnis, damit würde auf Chronologie als Ordnungsprinzip überhaupt verzichtet. Sie muss gesichert werden, aber sie darf uns nicht dazu zwingen, etwa in der siebten Klasse dem Schüler schwierige kulturhistorische Vergleiche mit fernen Zeiten zuzumuten und ihn mit seinen Fragen zu unserer un[/S.:229]mittelbaren Vergangenheit, die ihm durch Eltern und Großeltern noch begegnet, auf die Abschlussklasse zu vertrösten. Zudem bleibt der chronologisch geordnete Durchgang durch die Geschichte, auch wenn er thematisch und perspektivisch mehr oder weniger stark strukturiert ist, doch allzu leicht an der Oberfläche der Ereignisse und verstößt damit sowohl gegen die Erfordernisse struktureller Geschichtsbetrachtung als auch gegen die der Lernpsychologie (strukturiertes Lernen). Sinnvoll und fruchtbar scheinen hingegen Ansätze, in denen versucht wird, die kategorialen und methodischen Lernpotentiale der Geschichte unterschiedlich strukturierten Thementypen zuzuordnen und sie damit zu sichern (Rohlfes/Jeismann 1974 und Behrmann/Jeismann/Süssmuth 1978). Dementsprechend seien hier in Orientierung an unseren obigen Auswahlaspekten einige beispielhafte Hinweise gegeben:
- Die historische Problemanalyse erhellt eine gegenwärtige Problemlage durch Aufarbeitung ihrer Geschichte (Deutschlandfrage; Nahost-Konflikt).
- Der thematische Längsschnitt untersucht die Gegenwartswirkung und/oder die "lange Dauer" geschichtlicher Phänomene (geistliche und weltliche Gewalt; deutsch-polnisches Verhältnis).
- Der epochenspezifische Querschnitt erarbeitet die Eigenart und Andersartigkeit früherer Lebensformen und sozialer Strukturen (Griechische Polis; Feudalordnung im Mittelalter).
- Die historische Situationsanalyse macht synoptisch die Komplexität einer Konstellation deutlich und/oder rekonstruiert sie als Entscheidungssituation (Ausbruch des Ersten Weltkrieges; 20. Juli 1944).
- Der historiographische Vergleich macht die Perspektivität und Relativität historischer Erkenntnis sichtbar (das Bild Cäsars oder Luthers oder Bismarcks im Urteil von Zeitgenossen und Nachwelt; Ergebnisse deutsch-polnischer Schulbuchkonferenzen).
Ein in dieser Weise anspruchsvoller, thematisch strukturierter Geschichtsunterricht ist auf Sekundarstufe II umso eher möglich, je gründlicher auf Sekundarstufe I gearbeitet wurde. Aber auch hier muss vor dem Irrtum gewarnt werden, der nur chronologische Durchgang durch die Geschichte sichere ausreichende Geschichtskenntnisse. Jeder Geschichtslehrer weiß, dass sehr rasch in das Vergessen zurücksinkt, was in früheren Jahren behandelt wurde, wenn es nicht entweder ständig direkt wiederholt oder durch neue Fragestellungen in immanenter Wiederholung aufgegriffen wird. Zu letzterem bietet ein thematisch stärker strukturierter Geschichtsunterricht aber auf jeden Fall die bessere Gelegenheit als der einfach chronologische Durchgang. An ihm streng festzuhalten, heißt auf jeden Fall ferner Absage an die Koordination von Geschichts- und Politikunterricht. Denn letzterer bewegt sich auch auf den Jahrgangsstufen jedenfalls in der Gegenwart, auf denen sich der Geschichtsunterricht heute leider noch allzu oft ohne jeden Gegenwartsbezug mit fernen und früheren Zeiten beschäftigt.
5. Integration von Zeitgeschichte und Politikunterricht
So nachdrücklich wir gerade um politischer Bildung willen für einen eigenständigen, aber mit dem Politikunterricht koordinierten Geschichtsunterricht plädiert haben; für das, was man Zeitgeschichte zu nennen pflegt, stellt sich das Problem anders. Hier scheint mir Integration nicht nur möglich, sondern geboten. In den fünfziger und sechziger Jahren hat man zwischen zeitgeschichtlichem und politischem Unterricht kaum unterschieden. Erst durch die stärkere sozial- und politikwissenschaftliche Ausrichtung des letzteren sind die Fachperspektiven auseinandergetreten und unterscheidbar geworden. Dies hat aber stellenweise auch dazu geführt, dass Politikunterricht zeitgeschichtlich leer, zeitgeschichtlicher Unterricht sozialwissenschaftlich blind geworden ist.
Was Zeitgeschichte ist, lässt sich nicht für längere Zeit in Jahreszahlen fixieren. Ihr Beginn verschiebt sich ständig, wenn auch unmerklich, und sie mündet in die offenen poli[/S.:230]tischen Probleme der Gegenwart, aus denen sie viel unmittelbarer als die Geschichtswissenschaft sonst ihre Frageimpulse und ihr Erkenntnisinteresse bezieht. Zeitgeschichte umgreift einen unmittelbar politisch wirksamen Zusammenhang von Vergangenheit und Gegenwart (Kampmann 1968). Aber dieser Zusammenhang ist kein objektiver Bestand, der uns Zeitgenossen gegenüberstünde und mit den distanzierenden Mitteln Wissenschaftlicher Forschung allein bearbeitet werden könnte. Vielmehr ergibt sich seine Eigenart gerade daraus, dass wir in ihn hineinverwoben sind, und eben dies macht die Integration von Zeitgeschichte und Politikunterricht notwendig.
Zeitgeschichte ist die Geschichte der jeweils lebenden Menschen, für uns also die erlebte Geschichte der heute Lebenden. Für das geschichtlich-politische Bewusstsein der Lebenden wird Zeitgeschichte nicht durch Geschichtsschreibung erschlossen, mag auch die Wissenschaft mit mehr oder weniger Erfolg dies versuchen. Sie wird vielmehr von denen, die sie erlebt haben, unmittelbar mental interpretiert, erzählt oder verschwiegen, gedeutet und in politische Zusammenhänge eingebracht. Sie treibt die Menschen noch um und ist so auf viel elementarere Weise politisch wirksam als die Geschichte, die jenseits unserer Lebensspanne liegt. Wir haben es also bei Zeitgeschichte immer mit einem sehr engen Ineinander von subjektiver und objektiver Betroffenheit zu tun.
Zeitgeschichte so verstanden ist aber immer die Geschichte mindestens zweier, in der Regel dreier und mehr Generationen, die objektiv Verschiedenes erlebt haben und auch das gemeinsam Erlebte subjektiv unterschiedlich verarbeiten und deuten. In den fünfziger und sechziger Jahren war die Auseinandersetzung mit dem Scheitern der Weimarer Republik, mit dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg unsere notwendige zeitgeschichtliche Thematik. Spätestens seit dem Mentalitätsschub der "Studentenrevolte" gegen Ende der sechziger Jahre wurde dann die Nachkriegsentwicklung selbst zum zeitgeschichtlichen Gegenstand. Die Bundesrepublik Deutschland ist mehr als 30 Jahre alt, sie umfasst eine längere Zeitspanne als Weimarer Republik und Nationalsozialismus zusammen. Ihre Anfänge liegen für die heutige Schuljugend weiter zurück als für die Nachkriegsjugend der Erste Weltkrieg. Zeitgeschichte als die unterschiedlich erlebte Geschichte der heute Lebenden erfordert daher einen Kommunikationsprozess zwischen den Generationen, und eben dieser Prozess ist zentraler Bestandteil politischer Bildung. Es geht um die kommunikative und dialogische Vermittlung von Frageperspektiven und Erfahrungen zwischen den Generationen. Darin gibt es heute erhebliche Defizite.
So werden die Erfahrungen der älteren Generation, die in den Zusammenhang der Gründungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland gehören, seit langem nur mangelhaft ins Gespräch gebracht. Dies ist einer der gefährlichsten Mängel unserer politischen Bildung, weil es bedeutet, dass das Sinnkonzept unserer politischen Ordnung der nachwachsenden Generation nicht aus seinem geschichtlich-politischen Kontext begreifbar und nachvollziehbar gemacht wird. Wenn die ältere Generation ihre Position entweder nur autoritär behauptet oder nachgiebig räumt, statt sie gesprächsbereit zu vertreten und damit Erfahrungen zu vermitteln, dann gerät das Gleichgewicht zwischen Tradition und Fortschritt in Gefahr, dann gewinnen erfahrungslos zukunftsorientierte, ideologieanfällige und utopische Vorstellungen die Oberhand, und das Bestehende erscheint rasch nur noch im negativen Licht. Das Abschneiden der geschichtlichen Perspektive in der sozialwissenschaftlichen Lehrerausbildung hat bereits dazu geführt, dass heute eine ganze Generation junger Lehrer Politikunterricht erteilt ohne genügenden zeitgeschichtlichen Hintergrund und ohne den Blick für die Notwendigkeit, unsere heutigen Probleme im Zusammenhang der letzten drei Jahrzehnte zu sehen. Damit aber trägt Politikunterricht nicht mehr zum Kommunikationsprozess zwischen den Generationen im beschriebenen Sinne bei.
Ob es sich um die Deutschlandfrage handelt, um den Ost-West-Konflikt und die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus, um Friedenssicherung und Rüstungsproblematik, um Dritte Welt und Entwicklung, um die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland und die in ihrem Rahmen verlaufenden politischen Prozesse, um Wirtschaftsordnung, [/S.:231] Konjunktur- und Sozialpolitikum unsere Medienlandschaft oder um Fragen der Bildungspolitik, keine dieser Fragen kann unter der Zielsetzung politischer Urteilsbildung hinlänglich begriffen werden ohne den zeitgeschichtlichen Zusammenhang der Jahrzehnte seit dem Zweiten Weltkrieg. Damit soll nicht gesagt sein, der Nationalsozialismus mit seinen fundamentalen sozialstrukturellen, politischen und geistigen Erschütterungen sei aus unserem zeitgeschichtlich-politischen Fragehorizont schon herausgerückt. Er wird vielmehr noch für einige Zeit auch in den hier geforderten zeitgeschichtlichen Kommunikationsprozess hineingehören. Aber auch auf diesem Feld wurde in den vergangenen Jahren eine politisch rationale und moralisch verantwortbare Auseinandersetzung zwischen den Generationen nicht nur durch beiderseitige Fehlhaltungen, sondern auch durch das Auseinanderreißen der geschichtlich-historischen und der gegenwärtig-sozialwissenschaftlichen Betrachtungsweise gestört. Der Versuch politischen Urteilens ohne Kenntnis zeitgeschichtlicher Zusammenhänge führt zu bodenlosem Politisieren und zu unverantwortlichem Gerede; eine nicht auf politische Fragestellungen hin strukturierte Zeitgeschichte ertrinkt in der Fülle beliebiger Einzelheiten. Zeitgeschichte und Politikunterricht gehören zusammen. Politikunterricht ohne Zeitgeschichte bleibt leer, Zeitgeschichte ohne Politikunterricht bleibt blind.
Aus dieser unabweisbaren Einsicht die Konsequenzen für Lehrerbildung, Stundentafeln und Lehrpläne zu ziehen, ist eine dringende Notwendigkeit, wenn politische Bildung an unseren öffentlichen Schulen so etabliert werden soll, dass sie endlich ihren Namen verdient.
Literatur
Behrmann, Günter C.; Jeismann, Karl-Ernst; Süssmuth Hans (1978): Geschichte und Politik. Didaktische Grundlegung eines kooperativen Unterrichts. Paderborn: Schöningh.
Bergmann, Klaus; Schneider, Gerhard (Hg.) (1982): Gesellschaft - Staat - Geschichtsunterricht. Beiträge zu einer Geschichte der Geschichtsdidaktik und des Geschichtsunterrichts von 1500-1980. Düsseldorf: Pädag. Verl. Schwann.
Bergsträßer, Arnold (1963): Geschichtliches Bewußtsein und politische Entscheidung. In: Geschichte und Gegenwartsbewusstsein. Festschrift Hans Rothfels. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Giesecke, Hermann (1974): Thesen zum Geschichtsunterricht. In: Die Neue Sammlung. Jg. 14. Seite 63ff.
Kampmann, Wanda (1968): Zur Didaktik der Zeitgeschichte. Stuttgart: Klett.
Kosthorst, Erich (Hg.) (1977): Geschichtswissenschaft. Didaktik - Forschung - Theorie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Oelmüller, Willi (Hg.) (1977): Wozu noch Geschichte? München: Fink.
Rohlfes, Joachim (1974): Umrisse einer Didaktik der Geschichte, 3. Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Rohlfes, Joachim; Jeismann, Karl-Ernst (Hg.) (1974): Geschichtsunterricht. Inhalte und Ziele. Arbeitsergebnisse zweier Kommissionen. Stuttgart: Klett (Beiheft zur Zeitschrift "Geschichte in Wissenschaft und Unterricht").
Schieder, Theodor; Gräubig, Kurt (Hg.) (1977): Theorieprobleme der Geschichtswissenschaft (Reihe "Wege der Forschung" der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft). Darmstadt: Wiss. Buchges.
Schörken, Rolf (Hg.) (1981): Der Gegenwartsbezug der Geschichte. Stuttgart: Klett.
Süssmuth, Hans (Hg.) (1980): Geschichtsdidaktische Positionen. Bestandsaufnahme und Neuorientierung. Paderborn: UTB 954.
Sutor, Bernhard (1979): Geschichte als politische Bildung. In: Mickel, Wolfgang W. (Hg.): Politikunterricht im Zusammenhang mit seinen Nachbarfächern. München: Ehrenwirth, Seite 82ff.
Sutor, Bernhard (1979): Zum Verhältnis von Geschichts- und Politikunterricht. Politische Bildung im Fächerbund. In: Beilage zur Wochenzeitung "Das Parlament". Nr. 34/35, Seite 31ff.
Beiträge 1990-2004
Borries, Bodo von (1998): Jugendliche Geschichtsvorstellungen und Politikeinstellungen im europäischen Ost West Vergleich. Das Beispiel Demokratie. Befunde einer komparativen empirischen Studie in 9. Klassen 1994/95
1. Fragestellung, Teilnehmer und Methode
Die europäische Wende von 1989/91 hat - unbeschadet vieler Enttäuschungen und Konflikte - eine neue politische und intellektuelle Konstellation geschaffen. Das "Ende der Nachkriegszeit" eröffnet die Chance dauerhafter neuer (und friedlicher) Strukturen wie das Risiko extrem labiler und asymmetrischer Verhältnisse. In diesen werden die geschichtlichen Vorstellungen und politischen Einstellungen von Jugendlichen künftig sicherlich eine hoch bedeutsame Rolle spielen. Europäische Integration (oder Desintegration), ethnische Konflikte und Säuberungen (oder interkulturelle Harmonie), demokratische Stabilität (oder diktatorisch-populistische Abenteuer), Konfrontation zwischen Westeuropa und der osteuropäischen Zentralmacht Russland (oder Kooperation beider) werden auch durch den Bewusstseinsstand von Bevölkerungen mitbestimmt - neben dem Einfluss von Wirtschaftsinteressen und Machtpositionen.
Es lohnt sich also, mit wissenschaftlichen Mitteln empirischer Sozialforschung Landkarten allgemeiner und besonderer historisch-politischer Mentalitäten von Jugendlichen in Europa zu erstellen: Wie steht es z. B. mit Deutungen zu Mittelalter, Kolonialismus, Industrialisierung und Nationalsozialismus? Was halten die Jugendlichen von Nation und Europa, Demokratie und Fortschritt? Welche Erklärungen und Lösungsvorschläge haben sie für ökonomische Ungleichheit und ethnische Konflikte, Wanderungsbewegungen und Menschenrechte? Wie sehen sie die Zukunftsprobleme von Frieden, Freiheit, Wohlstand und Umweltschonung? Wie bringen sie historische Erfahrungen und Änderungstrends in ihre Gegenwartsbeobachtungen und Zukunftserwartungen ein?
Neben der pragmatischen und politischen Bedeutung eines solchen Kartierungsversuchs von Mentalitäten sind von einer kulturvergleichenden Betrachtung selbstverständlich auch theoretische Einsichten in Struktur und Genese historischen Bewusstseins zu erhoffen. Wieweit lassen sich theoretische Grundlegungen empirisch verifizieren oder falsifizieren? Es gibt - außer Feldexperimenten und Längsschnittstudien - z. B. keine besser geeignete Methode, um die Beziehungen zwischen Reifungsprozess und Sozialisationsabhängigkeit des Geschichtsbewusstseins aufzuklären. Im weiteren Verlauf kulturvergleichender Empirie könnten [/S. 209:] z. B. die geschichtslogischen Niveaus der traditionalen, exemplarischen, kritischen und genetischen Sinnbildung näher untersucht werden. Solche Studien dürften auch zu mehr Bescheidenheit, Nüchternheit und Bodenhaftung didaktischer Konzepte beitragen oder verdeckte normative Vorgaben in den erkenntnistheoretischen Analysen aufdecken.
Große europäische Kulturvergleiche sind ideologisch und organisatorisch überhaupt erst durch die Öffnung von 1989/91 möglich geworden. Seit 1991 wurde unter Leitung von Magne Angvik (Bergen), Bodo von Borries (Hamburg) und Lászlo Kéri (Budapest) ein Netzwerk nationaler Koordinatoren für "Youth and History. The Comparative European Project an Historical Consciousness among Adolescents" aufgebaut, das bald etwa 30 Territorien umfasste. 1992 wurde eine Pilotstudie in neun Ländern mit 900 Befragten durchgeführt (2). Die Finanzierung einer Hauptstudie war gleichwohl ein großes Problem. Nach jahrelangen vergeblichen Anträgen bei öffentlichen Stellen hat die Körber-Stiftung (Hamburg) die Kosten des internationalen Managements und der internationalen Auswertung übernommen. Die Europäische Kommission (Brüssel) steuert beträchtliche Summen bei, jedoch nur für ihre Mitglieder und einige Assoziierte. In vielen Ländern sind weitere Stiftungen, Universitäten und Regierungen mit nennenswerten Summen an der nationalen Finanzierung beteiligt.
Im Schuljahr 1994/95 wurden also über 31.000 Schülerinnen und Schüler 9. Klassenstufen (d.h. 800 bis 1.200 pro Land je nach vermuteter Homogenität oder Heterogenität) gemeinsam mit ihren mehr als 1.250 Lehrpersonen im Geschichtsunterricht befragt. Es nahmen - meist mit reinen Zufallsstichproben auf Klassenebene oder mit vorzüglich vertretbaren Konvenienzsamples (3) - über 25 Länder teil.
- Den ersten großen Block bilden zehn "postsozialistische" Länder, darunter vier Nachfolgestaaten der UdSSR (Russland, Ukraine Litauen und Estland), zwei Nachfolgestaaten Jugoslawiens (Slowenien, Kroatien), drei Visengradstaaten Ostmitteleuropas (Polen, Tschechien und Ungarn) und Bulgarien (4).
- Dem stehen im Westen elf Länder der Europäischen Union gegenüber, die skandinavischen Mitglieder (Dänemark, Schweden, Finnland), Großbritannien (England/Wales und Schottland), die iberischen Staaten (Portugal, Spanien), Griechenland und vier der Gründungsmitglieder (5): Frankreich, Italien, Belgien (nur Flandern) und Deutschland (mit den 1990 beigetretenen Ländern der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik) (6). [/S. 210:]
- Dazu kommen eine Reihe von Ländern am Rande und in der Nachbarschaft Europas. Island und Norwegen sind der Europäischen Union eng assoziiert; neuerdings ist auch die Türkei vertraglich näher herangerückt. Israel wurde mit zwei unabhängigen Teilstichproben (Staatsnation und israelische Araber) berücksichtigt; außerdem wurden Palästinenser (in Ostjerusalem, Westjordanland und Gaza-Streifen) befragt (7). Die Einbeziehung solcher nicht- oder marginal-europäischer Gemeinschaften erlaubt - bis zu einem gewissen Grade - eine Kontrolle des gemeinsamen europäischen Charakters der restlichen Stichprobe und schützt vor der Deutung ihrer Reaktionen als allgemein-menschlicher.
- Die Analyse soll jedoch auch unterhalb der Nationalstaaten für das Verhältnis zwischen staatstragenden Mehrheiten und anerkannten kulturellen Minderheiten (sprachlicher, ethnischer und konfessioneller Art) fortgesetzt werden. Die je zwei unabhängigen Samples in Großbritannien und Israel wurden schon erwähnt. Außerdem ist in Italien neben der nationalen Stichprobe eine besondere Stichprobe in der multikulturellen Provinz Südtirol (mit den drei Sprachgruppen des Italienischen, Deutschen und Ladinischen) befragt worden; in Russland wurde mit den Mari eine besondere autonome Gruppe einbezogen. In Estland lässt sich das knappe Drittel Russen mit der Mehrheit der Esten vergleichen. Die Jugendlichen wurden während zweier Schulstunden (95 Minuten) mit etwa 300 Fragen konfrontiert - und reagierten meist sehr positiv und vollständig. Dabei mussten sie fast ausnahmslos nur auf fünfstufigen Likertskalen von "nein, gar nicht" (1) bis "ja, sehr" (5) auswählen und ankreuzen. Die Begrenztheit dieser mechanischen Fragetechnik, die zunächst (auf der Ebene der einzelnen Frage) wohl Stellungnahmen, aber kaum Argumentationen und Zusammenhänge aufklären kann, ist uns sehr wohl bewusst. Für "Youth and History" gab es jedoch einige zwingende (oder wenigstens überzeugende) Gründe für die Wahl geschlossener Fragen.
- Die Codierung offener Antworten bei repräsentativen Stichproben tausender Probanden wäre sehr aufwendig und teuer und nur begrenzt reliabel; sie würde zudem das Problem absoluter Bedeutungsgleichheit in verschiedenen Sprachen dramatisch verschärfen, weil es sich dann nicht mehr auf den Fragebogenwortlaut begrenzen ließe, bei dem mit Übersetzung und unabhängiger Rückübersetzung eine methodische Kontrolle möglich ist.
- Bei offenen Fragen, d. h. selbst frei produzierten, argumentativen Antworten, ist man viel stärker von aktiver Sprach- und Schriftbeherrschung der Befragten sowie von ihrer Motivation abhängig. In entsprechenden Untersuchungen haben sich bei etwas schwierigeren Fragen Datenverluste bis 50 oder 60 % als üblich erwiesen. Das verzerrt grob die Repräsentativität, da unter weniger Intelligenten, Selbstsicheren und Motivierten ein viel größerer Anteil ausfällt. Im internationalen Vergleich drohen ebenfalls Einbrüche, und zwar in verschiedenen Ländern in abweichendem Maße (8).
- Eine gewisse Argumentativität und Komplexität der Antworten kann auch bei geschlossenen Fragen (mit vorgegebenen Antwortalternativen) dadurch erzeugt werden, dass nacheinander die Zustimmung zu verschieden pointierten - auch gegensätzlichen - Argumentationsweisen abgerufen wird. Von diesen Möglichkeiten ist im Fragebogen vor allem bei historischen Dilemmata und politischen Entscheidungen reichlich Gebrauch gemacht worden. Proteste gegen die Primitivität von Likertskalen bleiben ganz vereinzelt (sie kommen [/S. 211:] nach Erfahrungen in anderen Studien nur gelegentlich bei besonders intelligenten Zwölftklässlern vor).
- Die einzelne Antwort auf einer Likertskala wird zwar mechanisch gegeben und nicht legitimiert; ihre positive, negative oder fehlende Kombination mit zahlreichen anderen Antworten, die statistisch einfach und perfekt geprüft werden kann (z. B. Korrelationen), erlaubt aber zahlreiche Rückschlüsse auf Argumente und Strukturen, auch soweit sie den Antwortenden selbst kaum bewusst sind. Die Herstellung eines solchen Netzwerkes von Antworten setzt klar verarbeitbare und in sich einigermaßen simple (und vollständige) Einzeldaten voraus.
2. Themenkomplex "Demokratie" als Auswahlkriterium und Darstellungsbeispiel
Es erscheint vernünftig, die Vorstellung des fast unerschöpflichen Materials um ein einziges Thema zu bündeln, auch wenn dabei die Gesamtbetrachtung der Struktur von Geschichtsbewusstsein (und sogar der Bezug auf vergangene Geschehnisse) teilweise verloren geht. Dafür habe ich "Demokratie" gewählt, weil das Ausmaß demokratischer Hoffnungen und Überzeugungen sowie antidemokratischer Risiken und Gewohnheiten in Osteuropa und Ostmitteleuropa seit 1991 die Öffentlichkeit besonders interessiert. Ein Stichwort dieser Nachfrage lautet z. B. "Chancen zur Entwicklung von ,offener Gesellschaft' bzw. ,civil society'".
2.1. Wichtigkeit von "Demokratie"
Zu den Fragen des Fragebogens gehörte "Wie wichtig sind Dir die folgenden Dinge?" mit Einzelitems u.a. zu "Demokratie" und "Meinungsfreiheit für alle". Im gesamten Sample erhält Demokratie nur einen mittleren Stellenwert (MOverall = 3.46), weit hinter Meinungsfreiheit (MOverall = 4.27, vgl. Grafik 1) (9). Private Werte (Familie, Freunde, Hobbys) liegen weit höher - meist auch vor Meinungsfreiheit. Auch solidarische Werte (Frieden, Umweltschutz soziale Sicherheit, Hilfe für Arme Hilfe für die Dritte Welt) zählen weit mehr als Demokratie, im Mittel etwa so viel wie Meinungsfreiheit (z. B. Solidarität für Dritte Welt: MOverall = 3.72, Umweltschutz: MOverall = 4.39). Weniger wichtig als Demokratie sind nur "mein religiöser Glaube" (MOverall = 3.16) und "Europäische Zusammenarbeit" (MOverall = 3.13). Etwa auf gleicher Höhe befinden sich materielle Interessen "Geld und Wohlstand für mich selbst" (MOverall = 3.56), und ethnozentrische Werte, "mein Land" (MOverall = 3.84) und "meine ethnische Gruppe/Nationalität" (MOverall = 3.48).
Das ist ein erstaunliches und aufregendes Ergebnis auch wenn man das Alter der Jugendlichen bedenkt. Natürlich stehen bei ihnen persönliche Dinge im Vordergrund; es handelt sich ja noch nicht um politische Aktivbürger, sondern um Pubertierende. Das Vorwiegen privater Werte der Primärgruppe ist also naheliegend; weniger selbstverständlich ist das Übergewicht kollektiv-solidarischer Werte sekundärer Systeme (auch über große Entfernungen bis in die "Dritte Welt").
Offenkundig spiegeln die Jugendlichen hier kulturelle Selbstverständlichkeiten ihrer Umgebung, geben in diesem Sinne "sozial erwünschte Antworten". Wahrscheinlich hilft der Vergleich von "Demokratie" und "Meinungsfreiheit" weiter: Das scheinbar Konkretere [/S. 212:]
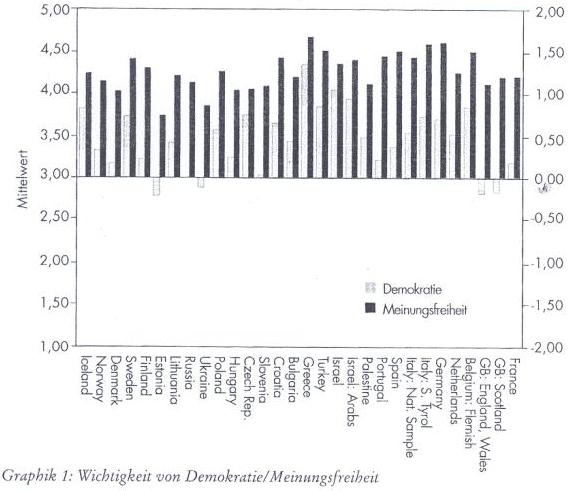
wird viel wichtiger genommen. Zugleich heißt das: Freiheitsrechte werden als selbstverständliches Konsumgut angenommen, nicht als zu gestaltende und zu verantwortende Aufgabe angesehen.
Diese These lässt sich leicht beweisen. In einer anderen Fragegruppe wurden die Jugendlichen gebeten, ihre persönlichen Erwartungen für die Zeit in vierzig Jahren anzugeben. Erneut liegen die kommunikativen (Familie, Freunde) und wirtschaftlichen (Beruf, Einkommen) Erwartungen weit vor den politischen Prognosen. Ein scharfer Gegensatz besteht zudem zwischen der künftigen Hinnahme von "persönlicher politischer Freiheit" (MOverall = 3.61) und der künftigen Teilnahme an "politischer Arbeit" (MOverall = 2.28). Der einmal krass positive, einmal krass negative Mittelwert spricht für sich (vgl. Grafik 2).
Einen entschiedenen Willen zur politischen Partizipation gibt es nicht, wohl aber einen intensiven Anspruch auf Selbstentfaltung und Glück. Das Selbstverwirklichungsverlangen reicht auch in die politische Sphäre hinein, weil es auf individualistische Freiheitsrechte angewiesen bleibt. Die Zweiteilung der persönlichen Erwartungen ("persönliche Freiheit" vor "politischer Teilhabe") bestätigt die Abstufung der Wichtigkeit ("Meinungsfreiheit" weit vor "Demokratie").
Wie steht es nun mit der länderspezifischen Verteilung? Die Bedeutung der Demokratie zeigt klare Minima (teilweise sogar im negativen Bereich) in mehreren "postsozialistischen", aber auch in einzelnen skandinavischen Ländern (Dänemark, Finnland), Großbritannien (beide Gruppen), Frankreich und Portugal (vgl. Grafik 1). Demgegenüber finden sich Maxima in Griechenland, Israel (beide Gruppen), Türkei, Belgien, Deutschland, Südtirol und in einzelnen skandinavischen Ländern. [/S. 213:]
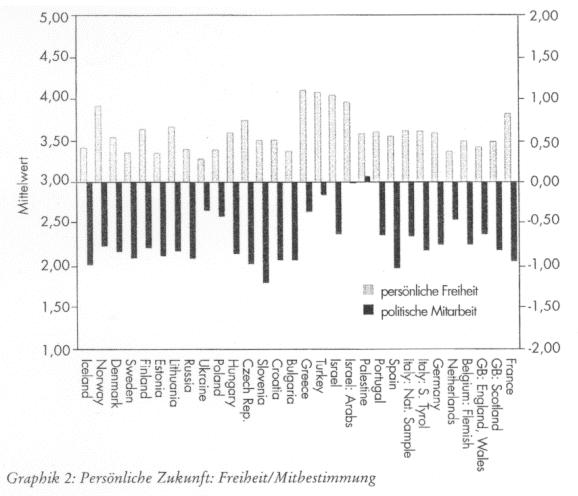
Von den "postsozialistischen" Ländern haben nur Tschechien und Kroatien ernsthaft überdurchschnittliche Werte. Osteuropa hat also sehr niedrige, Ostmitteleuropa unterdurchschnittliche Werte, die man als beklemmend bezeichnen könnte, wenn sie nicht mit Großbritannien, Frankreich und den iberischen Ländern geteilt würden. Das Verteilungsmuster besteht auch nicht in einem einfachen Ost-West-Gegensatz (MOst = 3.08, MOstmittel = 3.47 gegen MSüdwest = 3.69, MNordwest = 3.42) (10), sondern einem Südwest-(Nord-)Ost-Gefälle. Bei der "Meinungsfreiheit" wiederholt sich das im großen und ganzen (MOst = 4.03, MOstmittel = 4.17 gegen MSüdwest = 4.53, MNordwest = 4.30) (11), aber es gibt Ausnahmen von der Parallelität; Tschechien liegt diesmal z. B. nicht besonders hoch, sondern eher besonders niedrig (vgl. Grafik 1).
Die Erwartung persönlicher politischer Freiheit in vierzig Jahren fällt ziemlich gleichmäßig hoch aus (vgl. Grafik 2). Ernsthafte Ausrutscher nach unten gibt es nur in Ost- und Ostmitteleuropa (Estland, Russland, Ukraine, Polen, Bulgarien), zudem vereinzelt im Nordwesten (Island, Schweden, Schottland). Herausragend hohe Werte stehen dem vor allem im ostmediterranen Raum (Griechenland, Türkei, beide Gruppen in Israel) gegenüber, außerdem noch in Frankreich und Norwegen. Was immer die Motive der Jugendlichen sind: Hier finden wir kaum ein Ost-West-Muster (MOst = 3.41, MOstmittel = 3.54 gegen MSüdwest = [/S. 214:] 3.73, MNordwest = 3.59), sondern eher einen (Nord-)Ost-Nahost-Gegensatz (MOst 3.41 und MNahost = 3.91). Schaut man nachträglich noch einmal auf die Wichtigkeit von "Demokratie", so ist genau dieser Gegensatz auch dort schon angelegt (MOst = 3.08 und MNahost = 3.80).
Die künftige Teilnahme an politischer Arbeit wird - wie erwähnt - überaus skeptisch eingeschätzt (vgl. Grafik 2). Ausnahmen gibt es genau in jenen östlichen Mittelmeerländern (Griechenland, Türkei, Israel, diesmal auch Palästina), die schon die persönliche Freiheit betont haben (MNahost = 2.78 und MOst = 2.20, MOstmittel = 2.15, MSüdwest = 2.34, MNordwest = 2.18). Die Ergänzung um Palästina liegt insofern nahe, als hier besondere Aufbau-Anstrengungen nötig sein werden. Aus dem allgemeinen Muster politischer Apathie stechen aber auch Polen und die Ukraine positiv hervor, während Slowenien, Spanien, Island und Tschechien besonders trostlose Mittelwerte zeigen.
Die Angaben über politisches Interesse bestätigen den Befund; das Gesamtmittel für politisches Interesse ist deutlich negativ (MOverall = 2.52), positive Ausnahmen gibt es nur in Palästina und im arabischen Israel. Zwischen politischem Interesse und politischem Mitbestimmungswunsch besteht tatsächlich ein nennenswerter Zusammenhang (12).
2.2. Erwartung von "Demokratie" und Erinnerung an "Demokratie"
Das Material lässt sich durch Vergleich mit der Zukunft des eigenen Landes weiter auf Plausibilität und Konsistenz testen. Die Prognose für die Demokratie im eigenen Land in vierzig Jahren (d.h. um 2035) fällt eher bescheiden aus (MOverall = 3.50), wobei Osteuropa (außer Litauen) besonders niedrige Werte zeigt und auch Ostmitteleuropa (außer Tschechien und Kroatien) unterdurchschnittlich abschneidet (MOst = 3.21, MOstmittel = 3.46 gegen MSüdwest = 3.59, MNordwest = 3.60). Nur in Palästina ist man vergleichbar skeptisch hinsichtlich einer demokratischen Zukunft. Die positivsten Werte, d. h. den größten Optimismus legen die ostmittelmeerischen Länder (Griechenland, Türkei, Israel) an den Tag (MOst = 3.21, MNahost = 3.64), dazu Island. Nord-, West- und Westmitteleuropa bewegen sich ganz dicht am Gesamtmittel.
Völlig anders aber sieht die Einschätzung des eigenen Landes vor vierzig Jahren (also 1955) aus. Gegenüber der Zukunft ist das Gesamtmittel für "demokratisch" etwa drei Viertel Skalenpunkte niedriger (MOverall = 2.73). Das beruht auf durchweg deutlich negativen Mittelwerten aller 10 "postsozialistischen" Länder (vgl. Grafik 3). Es handelt sich um den maximalen gemessenen Ost-West-Unterschied (MOst = 2.19, MOstmittel = 2.29 gegen MSüdwest = 2.90, MNordwest = 3.22) und auch einen beachtlichen Abstand zum Nahen Osten (MNahost = 2.83). Polen und Slowenien geben noch die mildesten, Bulgarien und Tschechien die härtesten Urteile ab.
Auffälligerweise haben die skandinavischen Länder durchweg positive, die westeuropäischen Länder nur neutrale Werte. Offenbar ist langfristige Demokratie besonders im Norden Teil der kulturellen Selbstverständlichkeit, aber auch des Stolzes und der Identität. Ausgesprochen negative Werte gibt es in Spanien (Franco-Zeit), abgeschwächt in Portugal (Salazar-Zeit) und bei den beiden arabischen Gruppen.Anders ausgedrückt: In den länderspezifisch unterschiedlichen Einschätzungen der "Demokratie" vor vierzig Jahren steckt ein hoher Grad an empirischer historischer Triftigkeit - von mentaler Stimmigkeit in der heutigen Situation ganz abgesehen. Die Unterschiede sind enorm: Zwischen den Osteuropäern und den Nordeuropäern liegt mehr als ein Skalenpunkt (und mehr als eine Standardabweichung der Antworten); das ist ein sehr großer Effekt.[/S. 215:]
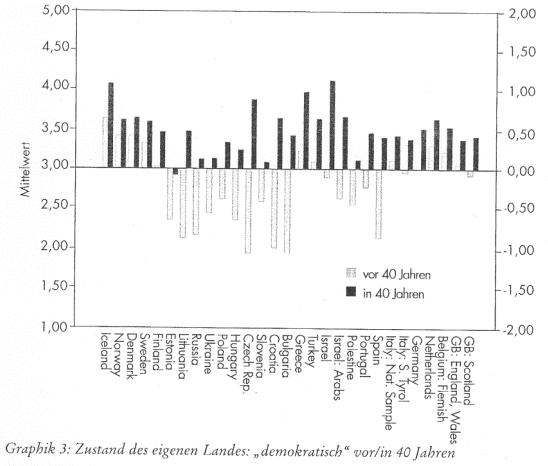
Aber auch die Ostmittel- und die Westmitteleuropäer sind noch beachtliche drei Viertel Skalenpunkte (oder fast zwei Drittel der Standardabweichung) entfernt.
Einen anderen Zugriff auf die Bewertung von Demokratie in der Geschichte bieten die Fragen nach dem Gewicht bestimmter Faktoren oder Determinanten für Änderungen des menschlichen Lebens. Auch diesmal wurde sowohl nach der Entwicklung in der Vergangenheit und der in der nächsten Zukunft (von 40 Jahren) gefragt. Unter den 15 Angeboten standen für beide Zeitformen neben "Kriegen", "Revolutionen" und "Umweltkrisen" auch "jeder Mensch" sowie "soziale Bewegungen und soziale Konflikte" und "politische Reformen". Der Einfluss von "jedem Menschen" in der Vergangenheit wie in der Zukunft wurde besonders uneinheitlich eingeschätzt (jeweils größte Standardabweichung überhaupt!). Die Gesamtmittelwerte für "jeden" (MOverall = 3.26 und 3.23), die deutlich unter denen der meisten anderen Determinanten liegen, sagen daher ziemlich wenig.
Dagegen sind die nationalen Unterschiede sehr bezeichnend (vgl. Grafik 4). Die Kontraste gehen jeweils mitten durch die regionalen und systemspezifischen Ländergruppen: Isländer halten gegen die anderen Skandinavier viel von der Kraft der Individuen, Litauer und Esten gegen die anderen Osteuropäer, Tschechen und Slowenen gegen die anderen Ostmitteleuropäer, Griechen, Spanier und Portugiesen gegen die anderen Mediterranen und Belgier gegen die anderen Westeuropäer. Das bedeutet aber: Fast durchgehend (Spanien ist die einzige Ausnahme!) sind es die mit Abstand kleineren Länder, die dem "einzelnen" großen Einfluss zutrauen. Dieses Muster schlägt gegenüber den sonst so deutlichen Besonderheiten (Nord gegen Süd und Ost gegen West) weithin durch. [/S. 216:]
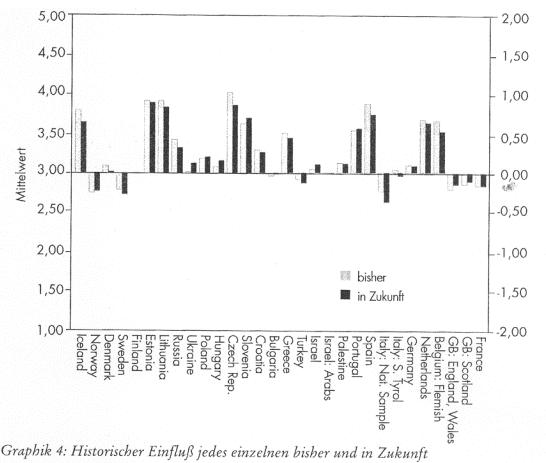
Die künftige Bedeutung jedes einzelnen ist der vergangenen überaus ähnlich. Kein Land entfernt sich ernsthaft von den Angaben für die Vergangenheit (13). Das heißt aber: Ein Wandel im Einfluss des einzelnen von der Vergangenheit zur Zukunft wird nicht ins Auge gefasst. Man hat daher den Eindruck einer ausgesprochen unhistorischen Konzeption von Demokratie bzw. Partizipation, d. h. ihrer fehlenden Verankerung in einer Entwicklung. Das hängt gewiss damit zusammen, dass die Jugendlichen nachweislich mit Fremdverstehen abweichender geschichtlicher Zustände nicht viel anfangen und heutige Ideal-Maßstäbe (z. B. Menschen- und Bürgerrechte) ziemlich undifferenziert an das Verhalten von Menschen aller Epochen anlegen.
Eine gewisse Kontrolle des (absolut untergeordneten) Stellenwertes von "Demokratie" als historischem Thema und Motor lässt sich auch mittels der Frage nach den thematischen Interessen der Jugendlichen gewinnen (vgl. Grafik 5). Von elf Sektoren liegt "die Entwicklung der Demokratie" (MOverall = 2.80) im schwach negativen Bereich und eindeutig an letzter Stelle, etwa einen Skalenpunkt hinter der "Geschichte Deiner Familie" (MOverall = 4.02) oder "Abenteurern und großen Entdeckungen" (MOverall = 3.76), aber auch einen halben Skalenpunkt hinter "den Auswirkungen von Menschen auf ihre Umwelt" und "der Geschichte bestimmter Gegenstände (z. B. ... von Autos, von Kirchen, der Musik, des Sports)". [/S. 217:]
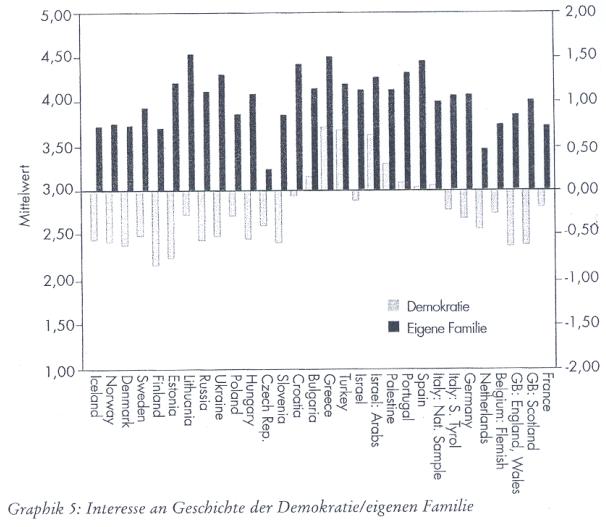
Das mit Abstand größte Interesse an der "Entwicklung der Demokratie" besteht in den ostmittelmeerischen Ländern (allerdings mit einem Einbruch in Israel); etwa neutrale Werte gibt es auch in Südeuropa (mit Kroatien und Bulgarien), während Osteuropa und Teile Ostmitteleuropas (Litauen und Tschechien wiederum mit Einschränkungen) sowie Nord- und Westeuropa ein vertieftes Desinteresse zeigen (vgl. Grafik 5). Der "postsozialistische" Bereich bleibt also hinter dem Westen kaum (MOst = 2.61, MOstmittel = 2.65 gegen MSüdwest = 3.20, MNordwest = 2.65), hinter dem Nahen Osten um so weiter zurück (MNahost = 3.32). Eine tiefe Kluft besteht auch zwischen dem reservierten ("kühlen") Norden und dem enthusiastischen ("heißen") Süden des westlichen, schon vor 1989 "marktwirtschaftlichen", Europa (MSüdwest = 3.20 und MNordwest = 2.65).
Nach den Kriterien der Wichtigkeit und des Interesses, der Erinnerung und der Erwartung bleibt Demokratie also für die Jugendlichen gleichermaßen untergeordnet - ganz im Gegensatz zu der herausragenden normativen Bedeutung, die Lehrerschaft (und Fachdidaktik) dem Gegenstand und seiner Internalisierung ausdrücklich zusprechen (Lehrziel MOverall = 4.18). Im großen und ganzen sind es auch stets dieselben Länder, die dabei einerseits mit besonderer Nichtachtung hervortreten oder die andererseits wenigstens verbale Zugeständnisse machen.
Ausführlich wurde weiterhin nach Urteilen über die osteuropäische Entwicklung seit 1985 gefragt. Die Antworten sind jedoch sehr vage (bei einzelnen Fragen kreuzen bis zu 51% das unentschiedene "teils-teils" an) - und überraschenderweise in Ost- und Westeuropa fast gleich, so auch beim Item "Demokratisierung der sowjetischen Gesellschaft" (MOst = 3.31, MOstmittel = 3.21 gegen MSüdwest = 3.43, MNordwest= 3.25). Insgesamt wird deutlich, dass [/S. 218:] den Jugendlichen von 1994/95 die Entwicklung 10 Jahre zuvor weder aus biografischer Erfahrung noch aus offizieller Überlieferung bekannt ist; auch das soziale Gedächtnis der Familien füllt die Lücke offenbar unzureichend.
Statt weitere (mögliche) Details zu präsentieren, ist eher danach zu fragen, was die Daten (ohnehin mehr politische Einstellungen als historische Vorstellungen betreffend) wirklich aussagen. Natürlich überlegt man, ob Angaben wie die vorgestellten irgendeine logische Konsistenz und politische Relevanz aufweisen. Aus der Forschung zur "öffentlichen Meinung" ist das aber eigentlich bereits bekannt: Die Aussagen sind soziale Wirklichkeit und insofern hoch bedeutsam, auch wenn sie vielfach widersprüchlich bleiben und Meinungen das Handeln keineswegs direkt und abschließend bestimmen. Das gilt selbst für Erwachsene, nicht nur für fünfzehnjährige Halbwüchsige wie in unserer Stichprobe.
In Deutschland haben Ende September 1996 etwa zwei Drittel der Menschen die einschneidenden Sparmaßnahmen der Regierung im Sozialbereich als überzogen und überflüssig abgelehnt. Gleichzeitig haben etwa zwei Drittel die Meinung vertreten, es müsse noch viel härter gespart werden. Weit über die Hälfte war zudem überzeugt, die Steuern müssten gesenkt werden (insbesondere der Spitzensteuersatz für die höchsten Einkommen). Das ist absolut widersinnig; aber man erkennt deutlich, in welchen Punkten Regierung und Opposition jeweils erfolgreich die "öffentliche Meinung" besetzt haben und beherrschen. Nur im Sinne solcher vager und fragwürdiger, aber gesellschaftstypischer und wichtiger Orientierungen vom Hörensagen sind unsere Daten und ihre Verteilung ernst zu nehmen.
2.3. Begriffe von "Demokratie"
Damit können wir zu den Begriffen von Demokratie überwechseln, bei denen versucht wurde, auch einige historische Erfahrungen einzufangen. Im Gesamtmittel der Stichprobe werden alle positiven Aussagen über Demokratie vorsichtig bis lebhaft akzeptiert (MOverall ≈ 3.39), alle negativen Äußerungen schwach zurückgewiesen (MOverall ≈ 2.71, vgl. z. B. Grafik 6). Solche kritischen Aussagen waren die (theoretisch und empirisch teilweise durchaus triftigen) Feststellungen der bloßen Akklamation für Parteiführer (vgl. Grafik 6), der Lenkung durch die Reichen und Mächtigen und der Schwäche in Krisenzeiten. Die Anmahnung bisheriger Defizite von Demokratie (Wohlfahrts-Staat und Frauen-Gleichberechtigung) erhalten im Durchschnitt schwache Zustimmung (MOverall ≈ 3.40). Am positivsten kommen die Definitionen als "Regierung des Volkes über das Volk für das Volk und durch das Volk" (Lincoln) und als "Gesetzesherrschaft und Minderheitenschutz" weg (MOverall ≈ 3.60, vgl. Grafik 6), während historische Ableitungen aus dem alten Griechenland und einem langen "Prozess von Versuch und Irrtum" wenig Resonanz finden (MOverall ≈ 3.10).
Der Verweis auf die "Erbschaft des klassischen Griechenland" z. B. findet nur in Griechenland Gegenliebe. Der Hinweis auf lange und schmerzhafte geschichtliche Erfahrungen und Experimente wird im östlichen Mittelmeer (außer Griechenland), aber auch in Teilen Skandinaviens (Finnland, Island, Schweden), Ostmitteleuropas (Ungarn, Slowenien) und Osteuropas (Litauen, Estland) nur neutral (und insgesamt oft "unentschieden") betrachtet. Das gilt überraschenderweise auch für Deutschland (43 % "bin unentschieden"). Generell kann man wohl erneut eine geringe Historisierung des Demokratiekonzepts (und zugleich etwas illusionäre Vorstellungen) festhalten. Speziell muss man fragen, warum einerseits Länder mit einer alten, unproblematischen demokratischen Tradition, andererseits gerade Muster diskontinuierlicher Entwicklung (Deutschland, Ungarn, Slowenien) die Prozesshaftigkeit nicht erkennen und anerkennen.
Damit sind wir von den Gesamtmittelwerten zu den länderspezifischen Verteilungen übergegangen. Sie fallen teilweise recht abweichend aus. Die Lincoln-Formel z. B. (vgl. Grafik 6) [/S. 219:]
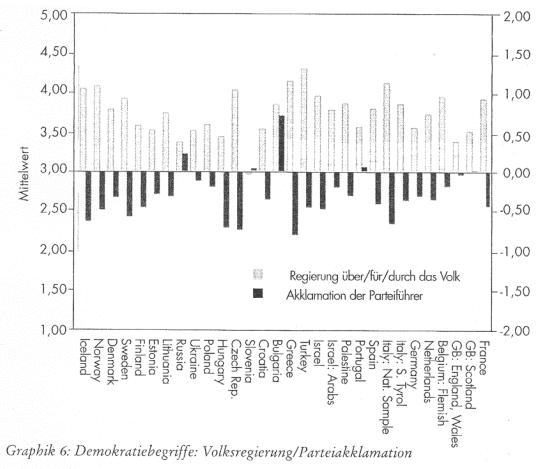
wird in Skandinavien weit stärker akzeptiert als in Osteuropa und Ostmitteleuropa (wo Tschechien erstaunlich weit nach oben und Slowenien erstaunlich weit nach unten abweicht). In Westeuropa wird Demokratie ebenso intensiv mit Lincolns Definition verknüpft wie in Skandinavien, nur dass (leider) Deutschland und Großbritannien auf den osteuropäischen Standard abrutschen (MOst = 3.54, MOstmittel = 3.53 gegen MSüdwest = 3.87, MNordwest = 3.72). Noch höher als in Skandinavien aber ist die Zustimmung im östlichen Mittelmeerraum (Griechenland, Türkei und Israel mit Palästina) (MNahost = 3.96). Das ist nun schon ein vertrautes Bild.
Die drei negativen Feststellungen werden - wie erwähnt - im Mittel abgelehnt. Es lohnt sich aber, solche Länder herauszusuchen, die im einen oder anderen Punkt neutral stehen oder zustimmen. Dass Demokratie bloße Akklamation für Parteiführer sei ("Stimmviehargument" und "realistische Demokratietheorie" im Sinne von Schaumpeter, vgl. Grafik 6) wird in Bulgarien fest behauptet, aber auch in einer Reihe anderer "postsozialistischer" Länder (Russland, Ukraine, Polen, Slowenien), in einigen westlichen Ländern (Portugal, Großbritannien, Belgien) und unter arabischen Israelis anerkannt (MOst = 3.04, MOstmittel = 2.62 gegen MSüdwest = 2.56, MNordwest = 2.64 und MNahost = 2.63). Gerade für Jugendliche ohne den Willen zu eigenem politischen Engagement (das Gesamtmittel für politisches Interesse ist deutlich negativ, MOverall = 2.52) müsste diese Feststellung an sich als empirisch korrekt gelten.
Die Kritik an der Demokratie als einer "schwachen Regierungsforen" mit fehlender Eignung für Krisenzeiten wird in Polen und Großbritannien zwar nicht geteilt, aber neutral [/S. 219:] eingeschätzt. Auch in anderen osteuropäischen (erneut außer Litauen!) und ostmitteleuropäischen Ländern (erneut außer Tschechien!) hat sie merklich höhere Werte als in Nord- und Westmitteleuropa (MOst = 2.78, MOstmittel = 2.69 gegen MSüdwest = 2.52 MNordwest = 2.63). Freilich ist man auch in den iberischen Ländern und den arabischen Stichproben etwas skeptischer (MNahost = 2.47). Im ganzen sind die Unterschiede nicht radikal; das Muster zeigt leise Anklänge an den ehemaligen Ost-West-Gegensatz, geht aber bei weitem nicht darin auf.
Dieses Bild wiederholt sich bei der Kennzeichnung: Demokratie sei "ein Vorwand, der die Tatsache verdeckt, dass die Reichen und Mächtigen in der Geschichte immer gewonnen haben". Energischen Widerstand gegen diese Formulierung gibt es nur im Ostmittelmeer (Griechenland, Türkei, Israel, auch Italien) (MNahost = 2.61) und in Tschechien und Litauen. Hier ist offenbar die Konnotation zu "Demokratie" am positivsten, da diese Länderkombination immer wieder auftaucht, obwohl es sich vermutlich nicht gerade um die wirklich basisdemokratischen Länder Europas handelt. Die höchsten (teilweise positiven) Werte werden in den britischen und iberischen Samples sowie in Ost- und Ostmitteleuropa erreicht (jedoch keinerlei Ost-West-Abstufung: MOst = 2.88, MOstmittel = 2.81 gegen MSüdwest = 2.75, MNordwest = 2.83). Auch das ist mittlerweile ein geläufiges Muster.
Aus den Items lassen sich zwei zuverlässige Konstrukte herstellen, nämlich "affirmative Konzepte von Demokratie" und "kritische Konzepte von Demokratie". Es überrascht nicht, daß Großbritannien, Iberien, Ost- und (teilweise) Ostmitteleuropa ziemlich hohe Werte an "Demokratiekritik" haben, die Ostmittelmeerländer sehr niedrige (MOst = 0.25, MNahost = -0.24, MSüdwest = -0.13). Zu diesen nicht-demokratiekritischen Gruppen gehören auch die tschechischen und (abgeschwächt) die litauischen Befragten.
Bei der "Demokratieaffirmation" stehen Bulgarien, Griechenland und Italien mit den höchsten Werten krass gegen Slowenien und Finnland, aber auch Russland, Palästina, Ungarn, Estland und Deutschland mit recht niedrigen. Hier handelt es sich nicht primär um ein Ost-West-Gefälle (MOst = -0.02, MOstmittel = -0.10 gegen MSüdwest = 0.30 MNordwest = -0.08), sondern eher um einen rhetorisch-pathetischen Demokratiebegriff des "heißen" Südens im Vergleich zum pragmatischeren und zurückhaltenderen "kühlen" Norden (MSüdwest = 0.30 und MNordwest = -0.08). Wahrscheinlich hat das mehr mit einem allgemeinen Phänomen "Enthusiasmus" versus "Reserviertheit" zu tun als mit dem besonderen Thema Demokratie.
3. Überlegungen zu Ertrag und Grenzen
Betrachtet man die Gesamtheit der Äußerungen über "Demokratie", so drängen sich eine Reihe von Schlussfolgerungen auf:
- Das Konzept "Demokratie" ist insgesamt nicht sehr lebhaft im Bewusstsein der Jugendlichen verankert; das ist wahrscheinlich ebenso eine Folge ihres niedrigen Alters wie des geringen politischen und partizipatorischen Engagements auch von erwachsenen Bevölkerungen insgesamt. Die ziemlich geringe Wertigkeit wird übrigens mit den anderen abstrakten Orientierungen hoher Ebene (Staat, Nation, Europa, Glaube) mehr oder weniger geteilt; die Befragten scheinen durch so allgemeine, globale und lebensweltferne Konzepte weithin überfordert. Das Eintreten für "mein Land" ist zwar etwas lebhafter, aber ausgesprochen chauvinistische Statements werden im Mittel zurückgewiesen.
- Das Konzept der "Demokratie" wird nicht (oder wenig) historisiert, d.h. kaum für eine Orientierung in erkennbaren Änderungsprozessen von der Vergangenheit her über die Gegenwart auf die Zukunft hin benutzt. Auch darin gleicht es anderen abstrakten und globalen Begriffen wie Nation, Europa und Religion. Das ist gewiss auch ein Problem der Fragetechnik [/S. 220:] in kulturvergleichenden Studien mit geschlossenen Items (in Papier-Bleistift-Verfahren). Es ist aber sicher auszuschließen, dass es sich nur um einen Methodeneffekt handelt.
- Die Stellung zur "Demokratie" ist deutlich mehrdimensional. Relevanz und Interesse, Einsicht und Engagement, Begriff und Geschichte, Erinnerung und Erwartung haben etwas miteinander zu tun, sind aber nicht einfach identisch. Im Begriff selbst lassen sich wenigstens zwei unabhängige Gesichtspunkte herausarbeiten nämlich "affirmative Konzepte" und "kritische Konzepte" (14). Theoretisch ist bei "Affirmation" (wohl vorwiegend des Anspruchs) und"Kritik" (sicher besonders der Wirklichkeit) von Demokratie nicht von einer einfachen Polarität auszugehen, sondern von komplementären, erst zusammen ein Gesamtbild ergebenden Dimensionen. Die Studie hat eine solche zwei- bis dreidimensionale Struktur (die in fast allen Ländern stabil bleibt) regelmäßig für geschichtliche Epochenassoziationen und historische Allgemeinbegriffe gefunden.
- Auch hinsichtlich der Demokratiebegriffe und -Wertungen gibt es nennenswerte kulturelle Unterschiede zwischen den beteiligten Ländern. Diese folgen jedoch keineswegs dem einfachen Schema, dass die "postsozialistischen" Länder des "Ostens" viel weniger demokratiebegeistert (stattdessen demokratieskeptischer) seien als die "alt-marktwirtschaftlichen" des "Westens". Vielmehr gibt es schon auf der Ebene von Ländergruppen mehrere miteinander verzahnte, sich durchgitternde Muster, z. B. auch den größeren rhetorisch-pathetischen Enthusiasmus im Süden Europas gegenüber der größeren vorsichtig-zurückhaltenden Reserve in der Mitte und im Norden.
- Diese Differenzierung setzt sich auf der Ebene der einzelnen Länder erkennbar fort. So sind Litauen und Tschechien eindeutig Länder mit einer Jugend, die ein größeres Demokratievertrauen entwickelt als die der Nachbarländer. Auf der anderen Seite zeigt Großbritannien eine auffällige, kaum glaubliche Distanz, die durch die Parallelität in beiden unabhängig gezogenen Teilgruppen (England/Wales und Schottland) noch zusätzlich gesichert wird. Durch die Studie werden aber auch Vorurteile und Befürchtungen zerstört. So trifft es z. B. keineswegs zu, dass in Russland "Demokratie" nur noch ein Schimpfwort sei und inzwischen "Demokrat" mit "betrügerischem Geschäftemacher" gleichgesetzt werde. Jedenfalls war es 1995 noch nicht so.
- Trotz der oben genannten Mehrdimensionalität kann den Jugendlichen nicht ohne weiteres ein konsistentes Denken bescheinigt werden. Die Widersprüche oder Spannungen zwischen Einstellungen sind (aus der Meinungsforschung) ebenso bekannt wie die zwischen Einstellungen einerseits und tatsächlichem Verhalten andererseits. Die überwiegend "edlen", d. h. Menschenrechte, Fremdenfreundlichkeit, Gewaltfreiheit und Umweltschonung ausdrücklich bejahenden Überzeugungen setzen sich nicht oder nur sehr teilweise in Alltagshandeln um. Das kann man schon an Angaben zu anderen Teilen unseres Fragebogens kontrollieren; vielfach treten Nullkorrelationen auf, wo hohe positive (gelegentlich auch negative) Zusammenhänge zu erwarten wären (15).
Methodisch sollte noch angemerkt werden dass die Studie mit großer Sicherheit nicht Maximal-, sondern Minimalunterschiede zwischen dem Geschichts- und Politikbewusstsein [/S. 221:] in den beteiligten Nationen bzw. Kulturen gemessen hat. Das liegt einerseits an der geschlossenen Form der Fragen (statt offener Anreize) und der Notwendigkeit generellgemeineuropäischer Themen (statt nationsspezifischer Lieblings- und Tabuzonen), andererseits am begrenzten Reifestand (vor-politisches Alter) und an gemeinsamen Vorlieben der Befragten (Tendenzen zu einer einheitlichen, mode- und konsumbestimmten europäischen "Jugendkultur").
Bei der Benutzung der Befunde muss davor gewarnt werden, allzu eilfertig und voreilig von der empirischen Beschreibung von kulturellen Unterschieden zu ihrer politisch-moralischen Bewertung überzugehen. Wenigstens aus Sicht des Empirikers gibt es nicht umstandslos "gutes" und "schlechtes", "angemessenes" und "verfehltes" Geschichtsbewusstsein. Selbstverständlich sollen die Befunde zu einer gründlichen didaktischen Diskussion in den beteiligten Ländern beitragen; sorgfältige Diagnose und abwägende Selbstreflexion sind im zuverlässigen Vergleich mit Nachbar- und Kontrastländern natürlich wesentlich einfacher als ohne solche Informationen. Auch Handlungsmaximen und Reformmaßnahmen sollen dabei gefunden werden. Misslich erscheint aber eine gewissermaßen "diktatorische" Beurteilung seitens einer zentralen Analyse, die notwendigerweise Traditionen, Randbedingungen und Zielsetzungen in den einzelnen Ländern nur höchst unvollkommen kennen kann.
Anmerkungen
(1) Als umfangreiche Präsentation der Studie vgl. Magne Angvik/Bodo von Borries (eds.): Youth and History. A Comparative European Survey an Historical Consciousness and Political Attitudes among Adolescents. Volume A: Description, Volume B: Documentation (containing the Database an CD-ROM); Hamburg (edition Körber-Stiftung) 1997. Zur Einführung vgl. Ursula A. J. Becher, Bodo von Borries u.a.: Jugend-Politik-Geschichte. Ergebnisse des europäischen Kulturvergleichs "Youth and History". Hamburg (edition Körber-Stiftung) 1997. [/S. 209:]
(2) Vgl. Bodo v. Borries (unter Mitarbeit von Magne Angvik u.v.a.): Jugendliches Geschichtsbewusstsein im europäischen Kulturvergleich. Verfahren und Erträge einer empirischen Pilotstudie 1992. In: Bodo von Borries, Jörn Rüsen u.a.: Geschichtsbewusstsein im interkulturellen Vergleich. Zwei empirische Pilotstudien. Pfaffenweiler (Centaurus) 1994, S. 13-77 und Bodo von Borries: Exploring the Construction of Historical Meaning: Cross-Cultural Studies of Historical Consciousness among Adolescents. In: Wilfried Bos, Rainer H. Lehmann (eds.): Reflections on Educational Achievement. Papers in Honour of T. Neville Postlethwaite. Münster/New York 1995, S. 25-49.
(3) So bezeichnet man die Wahl sorgfältig überlegter und breit gestreuter, mit guten Gründen als typisch geltender Personen bzw. Klassen, wenn reine Zufallsziehung nicht möglich oder nicht finanzierbar ist.
(4) Wegen ihrer Ähnlichkeiten werden die vier UdSSR-Nachfolgestaaten und Bulgarien im folgenden oft als "Osteuropa" oder "Ost" bezeichnet, die übrigen fünf "postsozialistischen" Länder als "Ostmitteleuropa oder Ostmittel".
(5) Die Niederlande haben erst 1996 mit Verspätung ihre Daten abgeliefert, die daher als Anhang behandelt werden.
(6) In einigen der zitierten statistischen Analysen sind Griechenland, Portugal, Spanien und Italien (mit Südtirol) als "Südwest", Skandinavien, Großbritannien, Frankreich, Belgien und Deutschland als "Nordwest" zusammengefasst. [/S. 210:]
(7) In vielen angeführten Analysen sind die Türkei, Israel und Palästina als "Nahost" zusammengefasst; es ist jedoch festzustellen, dass in manchen Fällen eine Einbeziehung von Griechenland in die "Levante" und von Israel nach "Mitteleuropa" noch klarere Ergebnisse liefern würde.
(8) In der Studie werden z. B. "enthusiastische" Länder mit stärkerer Bejahungstendenz gegenüber allen Aussagen und "reservierte" Kulturen mit größerer Skepsis bei jeder Frage gefunden. Dieser Unterschied betrifft auch die Bereitschaft zu vollständigen Antworten, d.h. zur Bearbeitung aller Fragen.
(9) M meint Mittelwert, MOverall den Mittelwert aller Befragten. Der erste zitierte Wert zeigt, wie oben erwähnt, dass die Neuntklässler im Durchschnitt "Demokratie" zwischen "weder - noch" und "etwas wichtig" ansiedeln, der zweite dagegen bedeutet eine mittlere Einschätzung von "Meinungsfreiheit" zwischen "etwas wichtig" und "sehr wichtig".
(10) Zu den Gruppierungen "Ost", "Ostmittel", "Südwest", "Nordwest" und "Nahost" vgl. Fußnoten (4), (6) und (7).
(11) Es besteht auch eine recht hohe Korrelation beider Items, so dass sie gemeinsam als Kurzskala zu verwenden sind. [/S. 214:]
(12) Statistisch misst man solche Ähnlichkeiten als "Korrelationen" (r), d. h. als Quadratwurzeln gemeinsamer Varianz. Der hier vorliegende Koeffizient (r = .37, d. h. 13,7 % erklärte Varianz) ist beachtlich. [/S. 215:]
(13) Ein Fünftel Skalenpunkte Abstand ist das absolute Maximum; die Korrelation ist überragend (r = .66 oder 43,6% gemeinsame Varianz). [/S. 217:]
(14) Statistisch handelt es sich um orthogonale Faktoren; in diesem Sinne erzwingt also die Rechenoperation die Unabhängigkeit.
(15) Als Beispiele erwarteter, aber fehlender bzw. sehr niedriger Zusammenhänge seien genannt: Wichtigkeit von Frieden um jeden Preis und Bereitschaft zur Gewaltanwendung bei Wiedergewinnung eines verlorenen Territoriums (r = -.08), Wichtigkeit eigener Ethnizität und Wahlrecht für alle Ausländer (r = -.01), Befürwortung strafferer Polizei-Ordnung (gegen Ausländerzuzug) und Hitler als Ordnungsstifter und Vermischungsgegner (r ≈ .00) und Kolonialismus als Ausbeutung und Kolonialreparationen nach dem Prinzip von Schuld und Vergeltung (r = .17).Literatur
Angvik, Magne; Borries, Bodo von (eds.) (1997): Youth and History. A Comparative European Survey an Historical Consciousness and Political Attitudes among Adolescents. Volume A: Description. Volume B: Documentation (containing the Database an CD-ROM). Hamburg: Körber-Stiftung.
Becher, Ursula A. J.; Borries, Bodo von u.a. (1997): Jugend-Politik-Geschichte. Ergebnisse des europäischen Kulturvergleichs "Youth and History". Hamburg: Körber-Stiftung. [/S. 209:].
Borries, Bodo von (unter Mitarbeit von Magne Angvik u.v.a.) (1994): Jugendliches Geschichtsbewußtsein im europäischen Kulturvergleich. Verfahren und Erträge einer empirischen Pilotstudie 1992. In: Borries, Bodo von; Rüsen, Jörn u.a.: Geschichtsbewußtsein im interkulturellen Vergleich. Zwei empirische Pilotstudien. Pfaffenweiler: Centaurus, Seite 13-77.
Borries, Bodo von (1995): Exploring the Construction of Historical Meaning: Cross-Cultural Studies of Historical Consciousness among Adolescents. In: Bos, Wilfried; Lehmann, Rainer H. (eds.): Reflections on Educational Achievement. Papers in Honour of T. Neville Postlethwaite. Münster, New York, Seite 25-49.
Eder, Klaus (1990): Kollektive Identität, historisches Bewusstsein und politische Bildung
1. Kollektive Identität und historisches Bewusstsein
1.1 Die Historiographisierung von Modernisierung
Was wir von der Geschichte, von vergangenen Ereignissen festhalten, sind immer selektive Erinnerungen. Das gilt für Individuen, die ihre Geschichte in eine Biographie (1) einbauen. Das gilt auch für Gesellschaften, die vergangene Ereignisse in ihre Historiographie einbauen. Die erinnerte Geschichte ist also immer weniger als die Abfolge von Ereignissen. Sie ist aber zugleich mehr als das: Eine Historiographie gibt – wie eine Biographie – vergangenen Ereignissen einen Sinn (2). Die in modernen Gesellschaften evolutionär sich steigende Historiographisierung vergangener Ereignisse führt somit in ein Paradox: Sie zwingt einerseits zu immer mehr Selektivität und sie erzeugt immer mehr Sinn.
Das Paradox besteht darin, dass die steigende Selektivität des historischen Bewusstseins das Sinnproblem zum Thema macht. Man kann dann diese Selektivität beklagen. Das führt zur Moralisierung des historischen Bewusstseins (3). Historisches Bewusstsein wird des Vergessens angeklagt und Erinnerungsarbeit wird eingefordert. Oder man verzichtet auf einen emphatischen Begriff von historischem Bewusstsein und akzeptiert, dass jede Selektivität irgendeinen Sinn hat. Das führt zu Zynismus (4). Das historische Bewusstsein wird Kontingent gesetzt. Je komplexer die vergangenen Ereignisse werden, um so beliebiger wird das, was wir als Erinnerung, als historisches [/S. 352:] Bewusstsein, festhalten. Steigende Selektivität in der Wahrnehmung von Geschichte provoziert also Reaktionen, die zugleich mehr Sinn erzeugen. Moralismus und Zynismus sind Umgangsformen mit Geschichte, die im Beklagen der Selektivität neuen Sinn im Umgang mit der Geschichte erzeugen.
Die heute zu beobachtende Historisierung der Vergangenheit – etwa in Broszats Vorschlag einer Historisierung der Nazizeit – verschärft das oben genannte Paradox noch (5). Die Forderung nach einem historischen Bewusstsein führt zur Thematisierung der Selektivität kollektiver Wahrnehmungs- und Erfahrungsmodi der Vergangenheit und provoziert zugleich die Suche nach Sinn in der Vergangenheit. Sie zwingt uns zu sehen, dass das, was wir wahrnehmen wollen, nicht mehr von den vergangenen Ereignissen abhängt. Es hängt davon ab, welches historische Bewusstsein wir haben wollen. Es hängt davon ab, welchen Gebrauch wir von der Geschichte machen wollen (6). Je selektiver wir mit Geschichte umgehen, um so mehr Sinn wird erzeugt. Und je mehr Sinn produziert wird, um so mehr nimmt Kommunikation über Geschichte zu. Man kann dies als einen Rationalisierungseffekt von »Modernität« sehen: Je moderner die Gesellschaft ist, um so umfassender wird historische Kommunikation – bei gleichzeitigem Rückgang unseres Wissens über Geschichte als solche! »Modernität« besteht darin, dass historisches Bewusstsein kommunikativ verflüssigt wird.
1.2 Zur Funktion kollektiver Identitätssuche
Kommunikative Verflüssigung verunsichert. Das gehört zur Grunderfahrung der Aufklärung und damit zur Grunderfahrung von Modernität. Es gibt nichts mehr, das kommunikativem Zugriff entzogen werden kann (7). Diese Verunsicherung provoziert den Rückgriff auf Selbstverständliches. Der Rückgriff auf eine Volksseele, auf eine Kulturnation und heute auf regionale Zugehörigkeit sind Gegenstrategien gegen die kommunikative Verflüssigung der Welt. Auch der Rückgriff auf ein objektiviertes historisches Bewusstsein gehört zu diesen Gegenstrategien. Die Objektivität einer Vergangenheit – ob positiv oder negativ bewertet, spielt zunächst keine Rolle – gibt Sinn im Fluss sich beschleunigender Kommunikation über Gesellschaft in der Gesellschaft. Hier hat der Begriff der kollektiven Identität seinen theoriestrategischen [/S. 353:] Platz (8). Kollektive Identität ist ein Versuch, ein Identisches im Fluss der Kommunikation festzuhalten. Gegen die kommunikative Verflüssigung der Welt wird – in der Praxis wie in der Theorie – Identität gesetzt.
Doch die kommunikative Verflüssigung historischen Bewusstseins macht auch vor kollektiver Identität nicht halt. Der Rückgriff auf ein Identisches entkommt nicht dem Phänomen kommunikativer Verflüssigung. Identitätskommunikation erschwert den unmittelbaren Rückgriff auf historische Muster kollektiver Identität. Über kollektive Identität lässt sich trefflich streiten. Wenn heute nationale Identität gegen »neue« politische Identitäten ausgespielt und zu europäischer Identität hochstilisiert wird, dann handelt es sich um das, was ich Identitätskommunikation nennen möchte (9).
Am Beispiel der Identitätskommunikation in den neuen sozialen Bewegungen möchte ich diese neue Stufe historischer Bewusstseinsbildung und kollektiver Identitätsbildung diskutieren. Die Frage nach neuen kollektiven Identitäten in den neuen [/S. 354:] sozialen Bewegungen wirft darüber hinaus die Frage auf, ob wir heute mit dem Begriff der kollektiven Identität überhaupt noch sinnvoll arbeiten können oder ob ihm notwendig jene Naturalisierung sozialer Beziehungen innewohnt, die mit kommunikativer Verflüssigung inkompatibel ist. Es scheint zumindest schwierig zu sein, ein »postkonventionelles« Konzept kollektiver Identität durchzuhalten (10). Letztlich stellt sich damit die Frage, ob ein postkonventioneller Begriff kollektiver Identität überhaupt möglich ist. Wenn man zu dieser abschätzigen Schlussfolgerung gezwungen wäre, dann läge der Verdacht immer nahe, dass kollektive Identitätssuche in einer kommunikativ durchrationalisierten Welt pathogener Natur ist (11).
Die Suche nach Identität ist zwar der Stachel, der zu permanenter Kommunikation zwingt. Doch Identität gefunden zu haben bedeutet auch das Ende von Kommunikation. Darin liegt das pathogene Potential von Identitätssuche systematisch begründet. Doch dagegen arbeitet der Prozess der Identitätskommunikation. Jede Analyse aktueller Identitätsbildung ist daher gezwungen, Identitätssuche und Identitätskommunikation scharf zu trennen. Die Annahme eines pathogenen Potentials in den aktuellen Versuchen kollektiver Identitätskonstruktion ist daran zu messen, inwieweit Identitätskonstrukte kommunikabel, das heißt strittig bleiben beziehungsweise inwieweit sie diese Kommunikation beenden können. Am Grade der Blockierung von Identitätskommunikation ist deshalb das Rationalitätspotential aktueller Formen kollektiver Identitätssuche zu messen (12).
2. Identitätssuche in der politischen Gegenkultur
2.1 Neue soziale Bewegungen und Aufklärungskritik
Identitätssuche seit dem Beginn der Moderne ist immer mit einer Kritik am Rationalismus der Aufklärung verbunden gewesen. Der der Aufklärung eigene Kosmopolitismus hat die Identitätsbedürfnisse nicht befriedigen können. Im Gegenteil. Er hat diese gerade provoziert. Die romantische Gegenbewegung gegen die Aufklärung hat dieser Aufklärungskritik die intellektuelle Variante geliefert (13). Diese Aufklärungskri[/S. 355:]tik darf aber nicht auf romantische Gegenbewegungen reduziert werden; sie findet sich ebenso in bürgerlichen wie proletarischen Gegenbewegungen (14).
Die neuen sozialen Bewegungen stehen ganz in dieser doppelten Tradition. Sie verkörpern ebenso die Aufklärung wie ihre Kritik. Was die neuen von den alten Bewegungen unterscheidet, ist die quantitative wie qualitative Bedeutung der Aufklärungskritik in diesen Bewegungen. Die neuen sozialen Bewegungen sind insofern neu, als die Aufklärungskritik nicht mehr bloße Reaktion auf Aufklärung, nicht mehr bloße konservative Reaktion ist. Sie sind insofern neu, als Aufklärungskritik diese Bewegungen antreibt und zum Movens der Modernisierung moderner Gesellschaften wird (15).
Die radikalste Form dieser Aufklärungskritik findet sich in jenen Teilen der neuen sozialen Bewegungen, die sich als Träger eines Vergesellschaftungsmodus verstehen, der an die Stelle rationaler Argumentation die Körpersprache und an die Stelle des Rationalismus den Mythos setzt, der – abstrakt formuliert – dem unterdrückten Anderen der Vernunft wieder zu seinem Recht verhilft. Beide Argumente verweisen auf die paradoxe Struktur einer die Aufklärung vorantreibenden Aufklärungskritik. Die Körpersprache kann man als einen Faktor kommunikativer Verständigung verstehen, der mit der Rationalisierung und Bürokratisierung der modernen Welt auf Inseln privater Verständigung zurückgedrängt worden ist – und selbst dort noch dank massenmedialer Kontrolle unterzugehen droht. Das Argument der Körpersprache als Opfer rationaler Argumentation leitet das Plädoyer für nichtargumentative Formen kollektiven Handelns an. Der Schlüsselterminus wird das »Sich Einbringen«. Die Körpersprache muss ihr Recht erhalten, der Anteil gestischer Kommunikation an menschlicher Kommunikation rehabilitiert werden. Theoretisch konsequent wird das dann im Versuch gedacht, Körpersprache zur Grundlage menschlicher Kommunikation überhaupt zu machen – nach dem Motto, dass Kopf und Bauch Teile eines Körpers seien. Es geht dieser radikalen Rationalitätskritik darum, die Identität von Kopf und Bauch wiederherzustellen.
Die Aufklärungskritik der neuen sozialen Bewegungen ist damit auf einer eigentümlich elementaren Ebene eng verbunden mit der Wiederaufnahme der Identitätsfrage. In der Formulierung »Identität von Kopf und Bauch« bleibt die Identitätsfrage allerdings noch auf das Individuum zentriert. Doch mit der zunehmenden sozialen und politischen Rolle dieser Bewegungen lässt sich diese Subjektperspektive nicht mehr durchhalten. Es liegt dann nahe, auch Gesellschaft wie einen »Körper« zu sehen. Die Identitätsfrage wird auf Gesellschaft projiziert. Sie lautet dann: Wie ist kollektive Identität des gesellschaftlichen »Körpers« möglich? [/S. 356:]
Nationale Identität war die klassische Lösung, um kollektive Identität jenseits von kosmopolitischer – also rein kognitiver – Identität in der Einheit von kollektiven Wir-Gefühlen und staatlicher Souveränität zu verankern. In der Auseinandersetzung mit dieser klassischen Lösung kommt es zur politischen Bewährungsprobe der Identitätskommunikation in den neuen sozialen Bewegungen (16).
Wie mit der von den neuen sozialen Bewegungen wieder eröffneten Identitätsfrage umgegangen wird, lässt sich nur klären, wenn wir sie im historischen Kontext sehen. Wir müssen deshalb die neuen sozialen Bewegungen in Deutschland als eine historisch spezifische Form des Konstruktionsprozesses der Moderne, als eine spezifisch deutsche Ausdrucksform politischer Modernisierung sehen. Wir müssen also – wenn wir über neue soziale Bewegungen und das Ende der Aufklärung reden wollen – Reflexionen über den spezifischen deutschen Weg in die Moderne einbauen. Sind die neuen sozialen Bewegungen eine Fortsetzung des deutschen Sonderweges in die Moderne oder rehabilitieren sie eine andere Moderne, die im deutschen Sonderweg missbraucht und dann denunziert worden ist? Handelt es sich um das Ende der Aufklärung oder um das Ende eines falschen beziehungsweise verzerrten Modells von Aufklärung?
Die entscheidende Frage – die die radikale Aufklärungskritik in den neuen sozialen Bewegungen nur zuspitzt – ist, wer im Gesellschaftlichen Körper« wen kontrolliert: der »Kopf« den »Bauch« oder der »Bauch« den »Kopf«? Dies wird zur zentralen Frage aktueller Identitätskommunikation, wenn heute – von wem auch immer und in welch kritischer Distanzierung auch immer – an die klassische »nationale« Lösung angeschlossen wird. Die klassische deutsche Lösung privilegierte den »Bauch«. Die Analyse der von den neuen sozialen Bewegungen initiierten Identitätskommunikation ist ein Weg, die Chancen einer den »Kopf« privilegierenden Antwort zu identifizieren. Der Indikator für die letztere Lösung ist die Fähigkeit, Identitätskommunikation auf Dauer zu stellen. Die klassische Lösung wäre dann in dem Maße zu erwarten, wie Identitätskommunikation blockiert wird.
2.2 ldentitätskommunikation in den neuen sozialen Bewegungen
Die deutsche Geschichte wirkt notwendig in irgendeiner Weise auf die neuen sozialen Bewegungen in Deutschland zurück. Wieweit die nationale Vergangenheit die neuen sozialen Bewegungen einholt, lässt sich an drei Beispielen diskutieren:
- am Beispiel der Suche nach Identität in einer überschaubaren Lebenswelt,
- am Beispiel der Suche nach dem guten Leben, nach der authentischen Lebenswelt, [/S. 357:]
- am Beispiel der Suche nach einem Identitätsbewusstsein
An diesen drei Beispielen lässt sich zeigen, inwieweit die Distanz zu der klassischen Form kollektiver Identitätsfindung hergestellt werden kann. Die These lautet, dass diese Suchstrategien bislang eher zur Blockierung denn zur Kontinuierung von Identitätskommunikation beitragen.
Ein »typisch deutscher« Umgang mit dem Identitätsproblem artikuliert sich erstens in der Suche nach einer nationalen beziehungsweise regionalen Identität. Das Eigenartige der deutschen Diskussion besteht darin, dass es eine Faszination für regionale Bewegungen gibt und dass zugleich eine regionale Bewegung fehlt. Das hat sicher auch mit der Unterdrückung regionaler Unterschiede im Faschismus zu tun, wo der Mythos deutscher Gemeinsamkeit alle anderen Herkunftsmythen überlagert hat. Andererseits ist gerade das Fehlen einer nationalen Identität in Deutschland eine Ursache für die Faszination, die von regionalen Herkunftsidentitäten ausgeht (17). Das führt bis hin zu sprachlichen Enttabuisierungen. So ist etwa das Wort Heimat wieder diskursfähig geworden (18).
Daraus ergibt sich ein Diskurs, der mit eigentümlichen Umkehrungen und Entgegensetzungen arbeitet. Gegen die Gesellschaft, wo nur das Habenwollen zählt (Interessen), wo zentrale Bürokratien entscheiden, wird das Volk, genauer die volkliche Vielfalt als Kampfbegriff gesetzt. Gegen das Vaterland wird die Muttersprache gesetzt, gegen das Waldsterben das Plädoyer für einheimische (sic!) Pflanzen. Gegen die Gesellschaft werden Stämme gesetzt; denn nur »Stämme werden überleben« (19). Die Sehnsucht nach dem Kleinen, Überschaubaren entspringt einem tiefverwurzelten Bedürfnis – »Graswurzelrevolution« ist ihre begrifflich weitestgehende Thematisierung – und verrät doch zugleich die Ambivalenz zur Moderne, die Nähe zum Diskurs, in dem sich die Pathogenese der Moderne artikuliert. Man kann an diesen Diskursfragmenten sehen, wie das Problem, eine kollektive Identität in einer modernen Gesellschaft auszubilden, durch den Rekurs auf Vorgegebenes oder Mythisches gelöst wird. Hier wird eine Blockierung von Lernprozessen reproduziert, die bereits die politische Kultur des letzten Jahrhunderts gekennzeichnet hat.
Diese Blockierung endet in der Mythisierung des Staates. Die Identifikation mit einer Herkunftsidentität ist das Komplement zum starken Staat. Wenn der Staat sich [/S. 358:] dieser Sehnsüchte nach kollektiver Identität annimmt, dann wird der Gesellschaft (als dem Gegenüber des Staates) der Stachel gezogen. Sie wird sich, wo Identitätsfindung nur mehr staatlich garantiert werden kann, mit diesem identifizieren (20).
Eine zweite Form der Identitätssuche ist die Suche nach einer authentischen Lebenswelt. Diese Suche nimmt in Deutschland eine besondere (gerade auch die Nachbarn jenseits des Rheins irritierende) Form an: Sie besteht vor allem in der Suche nach dem Natürlichen, nach dem gesunden Leben oder nach dem gesunden Essen (21). Hier zeigt sich eine eigentümliche Thematisierung des Problems einer nach Verwertungsgesichtspunkten durchrationalisierten Konsumtionssphäre: Die Lebenswelt wird verteidigt, indem das »Gewachsene« gegen das »Künstliche«, die »Natur« gegen die »Chemie« (als dem Inbegriff von Unnatur) gesetzt wird.
Zu Ende gedacht führt das zu einer Biologisierung der Bedürfnisse. Die Reduktion von Gesellschaft auf Natur verkennt systematisch die gesellschaftliche Geformtheit der Natur. Die reine und unverschmutzte Natur gibt es nicht. Sie hat mit dem Beginn der Kultur ihre Unschuld unwiderbringlich verloren. Und sie verkennt damit die Bedingungen der eigenen gesellschaftlichen Rolle: sich mitten in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen über die Form der Aneignung der Natur zu befinden (22). Die Authentizität von Lebenswelt ist gerade nicht in einer Natur jenseits von Kultur und Gesellschaft zu finden. Identitätskommunikation, die sie dort sucht, führt zu einem modernen Fundamentalismus, der Identitätskommunikation letztlich verhindert.
Mit dieser Biologisierung der Bedürfnisse geht drittens eine Psychologisierung des Umgangs mit diesen Bedürfnissen einher. Die »Tyrannei der Intimität« ist eine neue Form der Selbstentmachtung in der Geschichte der Moderne (23). Sie verweist auf einen weiteren Mechanismus der Blockierung von Lernprozessen, nämlich die Übertragung der Verantwortung für das eigene politische Handeln auf einen Stellvertreter. Dieser Stellvertreter ist allerdings nicht mehr der Staat. Die Externalisierung der Verantwortung für das eigene Handeln wird vielmehr durch eine neuartige Form der »Selbsttechnokratisierung« des Bewusstseins ersetzt (24): Die Psychologisierung des eigenen [/S. 359:] Handelns gibt dem professionellen Wissen über diese Psyche die Macht. Die Authenzität der Lebenswelt verdankt sich schließlich ihrer psychologischen Kontrolle. Die therapeutischen Institutionen werden zum Stellvertreter für die Instanzen der Über-ich Kontrolle. Sie blockieren damit die Möglichkeit, in der Auseinandersetzung mit dieser Instanz Identitätskommunikation in Gang halten zu können.
Alle drei Aspekte, die Mythisierung der Gesellschaft, die Biologisierung der Bedürfnisse und die Psychologisierung des Umgangs mit den Bedürfnissen, erinnern an die deutsche Romantik in ihrer doppelten Ausdrucksform als Theorie und als popularisierte Praxis. Von den neuen sozialen Bewegungen als neuromantischen Bewegungen zu reden (25) ist deshalb mehr als eine bloße Analogisierung. Dieses Reden thematisiert die Kontinuität eines Weges in die Moderne, der eine erste Stufe im Rückzug der romantischen Generation in der frühbürgerlichen Gesellschaft und eine bislang letzte Stufe im Rückzug eines nicht unbedeutenden Teils der Protestgeneration in der spätbürgerlichen Gesellschaft vom Feld politischer Auseinandersetzungen gefunden hat (26).
In den neuen sozialen Bewegungen in Deutschland wird also eine nationale Tradition des Diskurses – sowohl was seine Inhalte als auch was seine Produktionsbedingungen anbelangt – reproduziert. Die Pathogenese der frühbürgerlichen Gesellschaft setzt sich in der Pathogenese einer spätbürgerlichen Gesellschaft fort, die das »Bürgerliche« unter neuen technisch/ökonomischen Bedingungen sichern muss (27).
Die Identitätsfrage ist der Schlüssel zur Frage nach dem Bruch mit einer spezifischen Tradition der Aufklärungskritik. Für das Verständnis der neuen sozialen Bewegungen bedeutet das, dass wir es weniger mit dem Ende der Aufklärung als mit einer Blockierung der sich selbst aufklärenden Aufklärung zu tun haben. Die Suche nach Identität, das ungelöste Problem der modernen Aufklärung, wird in eine Form der Identitätskommunikation eingebunden, die Gefahr läuft, zugleich die Bedingungen von Identitätskommunikation zu zerstören. Die Mechanismen der Blockierung, die den deutschen Weg in die Moderne kennzeichnen, greifen weiterhin: Der [/S. 360:] Rückzug auf die private Lebenswelt (der Konsumtion) und die Restriktion der Erfahrung auf das unmittelbar körperlich Erfahrbare, auf die von Gesellschaft gereinigte Natur, sind zumindest Zeichen dafür, dass die Blockierungsmechanismen der Illusionierung, Naturalisierung und Ideologisierung weiterhin am Werke sind. In der Identitätskommunikation in den neuen sozialen Bewegungen ist eine pathogene Fortsetzung deutscher Geschichte weiterhin möglich. Weniger ein produktiver Bruch denn ein pathogener Bruch mit der Aufklärung, weniger Aufklärung über Aufklärung denn Abräumen von Aufklärung ist denkbar. Welche Chancen gibt es dann noch für gelingende Identitätskommunikation?
2.3 Angstkommunikation und die Suche nach Identität
Gegen die Vorstellung einer bruchlosen Fortsetzung einer pathogenen Geschichte in der aktuellen Identitätskommunikation spricht – paradoxerweise – ein Phänomen, das die neuen sozialen Bewegungen mit den Bewegungen verbindet, die die antidemokratische Tradition in Deutschland getragen haben: nämlich Angstkommunikation (28). Angst war das zentrale Motiv in den antidemokratischen Bewegungen der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (29). Angst vor der sich demokratisierenden Gesellschaft, Angst vor der Erosion des Selbstverständlichen, Angst vor dem Verlust traditional eingelebter Identität wurde durch die Identifikation mit dem Staats schließlich mit dem Charisma eines Führers kompensiert. Angst verstärkte also die Blockierung von Identitätskommunikation. Sie blockierte damit die Idee einer sich selbst konstituierenden Gesellschaft, deren Identität gerade nur in der Fähigkeit bestehen konnte, partikulare Identität als partikulare zu institutionalisieren.
Angst in den neuen sozialen Bewegungen ist davon grundverschieden. Sie richtet sich nicht mehr gegen die Gesellschaft, sondern gegen den die Gesellschaft überformenden und mediatisierenden Staat (30). Wo sich Angst mit der Kritik am konkreten [/S. 360:] staatlichen Handeln verbindet, etwa mit der Kritik am politisch institutionalisierten und reproduzierten Umgang mit äußerer und innerer Natur, gelingt es, Staat und Autorität voneinander abzukoppeln. Das eröffnet einen neuen Spielraum für das Experimentieren mit Identität.
In dem Maße, wie diese »neue« Angstkommunikation mit Identitätskommunikation verknüpft wird, wird es – so die These – möglich, letztere zu »entblockieren«. Die neue Angstkommunikation eröffnet Perspektiven
- der Desillusionierung (Entzauberung der Aufklärung),
- des kollektiven Lernens (Institutionalisierung von Frühwarnsystemen) und der
- Erinnerungsarbeit (Auflösung pathogener Rationalisierungsprozesse).
Die erste Möglichkeit, die moderne Angstkommunikation eröffnet, ist ein desillusionierender Umgang mit der Aufklärung. Angstkommunikation thematisiert das Problem, dass Aufklärungsdiskurse unter der Bedingung hoher Unbestimmtheit ablaufen. Angstkommunikation desillusioniert über das Ritual des Aufklärungsdiskurses, der Angstfreiheit unterstellt. Damit verliert der Aufklärungsdiskurs ein Moment der Selbstillusionierung, das ihm von Anfang an eigen war: zu unterstellen, dass sich Aufklärung von selbst einstellt.
Die bürgerliche Bewegung war noch davon überzeugt, dass kognitive Einsicht die Aufklärung voranbringt. Die kleinbürgerliche Bewegung hat dagegen argumentiert, dass nur normative Orientierungen, nämlich Werte wie Ordnung, Fleiß und Gerechtigkeit die Aufklärung in die richtige Richtung lenken können. Die neuen sozialen Bewegungen argumentieren – und hier gehen sie über die alten kleinbürgerlichen Bewegungen hinaus – auch mit Empfindungen und Gefühlen, über die Aufklärung notwendig sei, damit Aufklärung stattfinden kann. Man kann diesen Umgang mit der Aufklärung als ein Problem des Aufklärungsstils bezeichnen (31). Es handelt sich um einen veränderten Stil des Miteinanderredens. Angstkommunikation ist dann eine Variante des Aufklärungsdiskurses. Sie bricht mit der kognitiven und normativen Illusion, die Stilfragen als sekundär betrachtet hat.
Eine zweite Funktion aktueller Angstkommunikation besteht darin, wie ein Frühwarnsystem zu funktionieren, das Sensibilität erhöht und dem Immunsystem »Gesellschaft« Zeit gibt, sich auf eine bedrohliche Umwelt einzustellen (32). Man kann dieses Frühwarnsystem historisch und sozial kontextuieren und damit genauer [/S. 362:] bestimmen. Was die neuen sozialen Bewegungen tun, ist nichts anderes als das, was die frühen bürgerlichen Emanzipationsbewegungen schon versucht haben: durch Verständigung auf gemeinsam betreffende Probleme sich einer formalrationalen »Traktierung« von Problemen entgegenzustellen und Bedürfnisse einzuklagen, die ansonsten systematisch ausgeschlossen würden. Was die neuen sozialen Bewegungen »objektiv« tun, ist nichts anderes, als den Bereich relevanter Bedürfnisse und damit auch die Komplexität von Entscheidungskriterien auszuweiten. In diesem Sinne kann man dann von einer Ersetzung der »Gerechtigkeitsformel« durch die Formel des »guten Lebens« sprechen. Aber die Form, in der diese Einklagen konstituiert und reproduziert werden, bleibt identisch: nämlich die Organisation kollektiver Lernprozesse außerhalb formal rationaler Institutionen, die Herstellung politischer Öffentlichkeit – das ist der altmodische Begriff dafür – durch Assoziation, Diskussion und kollektive Aktion. Angstkommunikation wird so zum Kristallisationspunkt einer Form politischer Kommunikation, deren Dynamik sich auch Identitätskommunikation nicht mehr entziehen kann (33).
Eine dritte Funktion wäre die Reflexivität von Angstkommunikation. Was in der Angstkommunikation in den neuen sozialen Bewegungen transportiert werden kann, ist eine neue Form von kollektiver Erinnerungsarbeit: nämlich die Idee der Aufklärung über sich selbst. Das würde bedeuten, das kollektive Gedächtnis, das sich in der Pathogenese der Moderne abgelagert hat, selbst im Prozess der Radikalisierung der Moderne auf und durchzuarbeiten, Erinnerungsarbeit als Aufklärung über die Aufklärung zu betreiben. Und dazu gehört gerade auch Erinnerungsarbeit über misslungene Kommunikation, Erinnerungsarbeit über Identitätskommunikation (34).
3. Politische Bildung ein kollektiver Bildungsprozess?
3.1 Eine alternative Konzeption politischer Identität
Aus dieser Diskussion lässt sich eine erste Schlussfolgerung ziehen. Identitätskommunikation kann nur dann gelingen, wenn Identität im Hinblick auf Vergangenheit erinnerungsfähig bleibt und sich im Hinblick auf Zukunft nicht festlegt. Abstrakter formuliert: Wenn Identität im Hinblick auf Vergangenheit und Zukunft offen ist.
Für eine solche Identitätskonzeption eignet sich der Begriff des citoyen. Der citoyen, der politische Bürger im Gegensatz zum Staatsbürger (35), ist derjenige, der kollektive Identität jenseits partikularer Zugehörigkeiten formuliert. Seine kollektive Identität besteht in der fiktiven Gemeinschaft der am Gemeinwesen Interessierten. In der aktuellen Identitätskommunikation wird jedoch diese fiktive Gemeinschaft substantiell ausgefüllt. Wer nationale Identitätssurrogate symbolisch bekräftigt, der sollte sich nicht wundern, wenn sich im Rücken dieser Identitätskommunikation wieder jene blutige Tradition europäischer Kultur – von der die deutsche ja ein Teil ist (36) – durchsetzt, wie sie bereits die Jahrhunderte seit Beginn der Neuzeit kennzeichnete.
Gegen diese Tradition ist die Idee des citoyen gedacht worden. Denn der citoyen ist zunächst citoyen und erst dann Teil einer Herkunftsgemeinschaft. Dies ist die Voraussetzung für reflexive Identitätskommunikation. Denn der citoyen sieht kollektive Identität nicht als Faktum, sondern als Problem. Er geht nicht in kollektiver Identität auf, sondern verhält sich reflexiv zu ihr. Der citoyen weiß, dass er – wie alle anderen – einen sozialen Gebrauch von kollektiver Identität macht. Kollektive Identität ist ein Politikum. Kollektive Identität ist jenes Gefühl der Gemeinschaft – jener »Konsens« –, das zu bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten dann entsteht, wenn es um die Mobilisierung von sozialen Gruppen für oder gegen politische Entscheidungen geht. Kollektive Identität ist Identität, die im Prozess kollektiven Handelns entsteht und wieder vergeht. Sie kann sich – je nach Problemlage und Problemdefinition – ethnischer, religiöser, ökonomischer oder sonstiger partikularer Interessen bedienen. Entscheidend ist, dass die Bezugspunkte kollektiver Identität als partikulare Interessen erkennbar bleiben und nicht in Identitätsunterstellungen verschwinden. Das, was als Gemeinsames bleibt, ist nur mehr die Unterstellung, dass man citoyen, ein politischer Bürger ist. Identität wird in einem so verstandenen Politikbegriff entsubstantialisiert.
3.2 Die kollektive Konstruktion historischen Bewusstseins
Eine solche Kompetenz setzt die reflexive Distanzierung zur Vergangenheit voraus. Sie ist gleichbedeutend mit historischem Bewusstsein. Historisches Bewusstsein ist die Fähigkeit, eine kollektive Identität reflexiv anzueignen und substantielle Identitätsunterstellungen zu relativieren.
Historisches Bewusstsein ist also mehr als gelingende Erinnerungsprozesse. Historisches Bewusstsein ist zugleich Bewusstsein davon, dass jede Erinnerung eine soziale [/S. 364:] Konstruktion ist, eine Selektion aus möglichen Erinnerungen. Diese Selbstrelativierung historischen Bewusstseins zwingt zur Relativierung jeder Identitätsunterstellung. Jede kollektive Identität ist ein selektiver Rückgriff auf Vergangenes, der auch anders aussehen könnte. Wie kollektive Identität letztendlich aussieht, ist von sozialen Konstruktionsleistungen abhängig, ist das Ergebnis politischer Auseinandersetzungen. Identitätsbildung ist immer zugleich Medium und Ergebnis von Identitätskommunikation (37). Und nur an solche sozialen Prozesse kann man sinnvoll die Meßlatte gelingender Identitätskommunikation anlegen.
Ein empirischer Begriff von Identitätsbildung muss deshalb die Akteure und das Publikum solcher Konstruktionsprozesse benennen können. Die soziale Konstruktion von kollektiver Identität beteiligt zahlreiche Akteure. Sie beteiligt vor allem auch professionalisierte Akteure. Das Ergebnis dieser Professionalisierung hat in Deutschland den Namen politische Bildung erhalten. Politische Bildung ist ein ausdifferenziertes System, ein Betrieb der Produktion von Reflexion auf kollektive Identität geworden. Politische Bildung ist – wenn man die Euphemisierungsstrategien bildungsbürgerlicher Illusionen beiseitelässt – Produktion von politischer Identität durch Symbole. Der soziale Konstruktionsprozess kollektiver Identität ist von der professionellen Organisation dieses symbolischen Produktionsprozesses zunehmend abhängig geworden.
Dieses System der Produktion kollektiv geteilter Symbole bleibt zugleich an die Sozialstruktur gebunden. Es lässt sich nicht »autonom« setzen und funktional spezifizieren. Im institutionalisierten und professionalisierten Konstruktionsprozess kollektiv geteilter Identitätssymbole gibt es die Besitzer von Produktionsmitteln für kollektiv geltende Symboliken und diejenigen, die von diesem Besitz ausgeschlossen sind. Wir kennen die klassische Situation, in der das Bildungsbürgertum Produktionsmittelbesitzer war. Mit dem Aufstieg des Kleinbürgertums wurde auch der kleine Mann Kleinbesitzer solcher symbolischer Produktionsmittel: Es begann die Periode der Politik des kleinen Mannes. Und in dieser Periode befinden wir uns weiterhin.
Dieser sozialstrukturelle Wandel verändert die politischen Deutungsmuster, innerhalb derer Identitätssuche und Kommunikation organisiert wird. Die Alternativen sind uns heute geläufig: Umdeutungen im Sinne des traditionellen Kleinbürgertums und solche im Sinne des neuen Kleinbürgertums. Die Alternativen heißen: Faschismus oder Radikaldemokratie (38). Das zwingt dazu, den semantischen Raum, mit dem das Politische gefasst werden kann, zu ändern. Nicht mehr die Begriffe »extreme Rechte« oder »extreme Linke« definieren ihn angemessen. Der semanti[/S. 365:]sche Raum dieser Form symbolischer Produktion ist nicht mehr in der Dreiteilung: rechts, mitte, links, oder: konservativ, liberal, sozialistisch zu finden. Überfällig ist die Ersetzung dieses Klassifikationsprinzips. Alternativen sind die Differenz »utilitaristisch« und »kommunikativ« oder »monologisch« und »dialogisch«.
Welche Form der Klassifikation der politischen Welt sich durchsetzen wird, ist offen. Wir können nur Aussagen darüber machen, welche Trägergruppen, welche »symbolischen« Unternehmer, welche »Moralunternehmer« (39) mit welchen Strategien den Konstruktionsprozess kollektiver Identität bestimmen. Sie entscheiden darüber – unter den gegebenen historischen Randbedingungen, die sich unabhängig und/oder durch den Konstruktionsprozess kollektiver Identität verändern –, welche Definitionen kollektiver Identität gehandelt werden. Die Rationalität des Ergebnisses hängt aber nicht von den Akteuren selbst ab, sondern von den Beziehungen zwischen Akteuren. Alles hängt davon ab, wie Identitätskommunikation organisiert ist. Und nichts hängt davon ab, was von einzelnen Akteuren Rationales oder Irrationales kommuniziert wird. Wir sollten uns nicht auf einzelne Akteure verlassen, sondern auf Gesellschaft. Denn sie entscheidet darüber, welche Akteure zum Zuge kommen können.
4. Schlussfolgerung
Kollektive Identität ist nur mehr als kontingent gesetzte Identität möglich. Alle Versuche, eine substantielle kollektive Identität wiederherzustellen, erweisen sich als paradox: Man provoziert die Kommunikation über sie in dem Maße, in dem man sie festschreiben will. Kommunikation über Identität schließt entweder Identität oder Kommunikation aus. Beides ist versucht worden. Einer dieser Wege ist nicht mehr gangbar: nämlich Kommunikation über Identität zu blockieren. Damit bleibt nur mehr die Option, Identität der Kommunikation zu überantworten. Hieraus ergeben sich alternative Bezugspunkte für politische Lernprozesse: nicht mehr die »Pflege« von Geschichte und Identität, sondern die Dauererinnerung an Vergangenes und die permanente Rekonstruktion von Identität, nicht mehr Aufklärungskritik. sondern Kommunikation der Aufklärungskritik.
Anmerkungen
(1) Die Konjunktur, die Biographieforschung heute hat, ist auch auf die aktuelle Thematisierungswelle von Vergangenheit zurückzuführen. Zum jüngsten Stand dieser Diskussion vgl. H. G. Brose/B. Hildenbrand, Vom Ende des Individuums zur Individualität ohne Ende, Opladen 1988.
(2) Die Sinnfrage gehört zu den Modethemen aktueller Diskussionen um das historische Bewusstsein. Geschichte wird als neues Sinnreservoir nicht nur von Historikern, sondern auch von Politikern entdeckt.
(3) Der Historikerstreit gibt dafür beredtes Zeugnis ab. Siehe die Beiträge in R. Augstein u. a., »Historikerstreit«. Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung, München 1987, insbesondere die Beiträge von Nolte und Stürmer.
(4) Ein Beispiel dafür ist Luhmanns Umgang mit Geschichte. Vgl. etwa N. Luhmann, Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft (l. Bd.), Frankfurt/M. 1980. Es nimmt nicht wunder, dass die problematischen Phasen moderner Geschichte, insbesondere der deutschen Geschichte, kaum behandelt werden.
(5) Dieses oft missverstandene Plädoyer für Historisierung sollte gerade Platz schaffen für die Sinnfrage. Denn solange die nationalsozialistische Vergangenheit als objektivierbares Forschungsproblem gesehen werden konnte, ließ sich die Dynamik der Sinnfrage einigermaßen steuern. Das geht nicht mehr, sobald man die Erkenntnisbedingungen von Vergangenheit thematisiert.
(6) Das ist natürlich mit einer Desillusionierung über die Objektivität historischer Erkenntnis verbunden. Sie führt notwendig in wissenssoziologische Relativierungen. Die – mit dem Namen Bourdieu verbundene – Soziologisierung von Erfahrungs und Wahrnehmungsmodi dürfte mit der gegenwärtigen Thematisierung und Problematisierung des Wirklichkeitsverhältnisses zu tun haben. Vgl. etwa P. Bourdieu, Die feinen Unterschiede, Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt/M. 1982; ders., Homo Academicus' Paris 1984.
(7) Vgl. zu dieser Klage im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert K. Eder, Geschichte als Lernprozess? Zur Pathogenese politischer Modernität in Deutschland, Frankfurt/M. 1985, S. 129ff.
8) Ich spreche ausdrücklich nicht vom »theorietechnischen« Platz, weil Theoriebildung nicht ein monadisches, sondern ein zutiefst interaktives Unternehmen ist. Man mag dieses »Interaktive« als dialogisch idealisieren; in der Praxis ist es in der Regel ein strategisches Unternehmen.
(9) Mit diesem Begriff greife ich auf die kommunikationstheoretischen Ansätze zurück, wie sie gleichermaßen von J. Habermas (Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt/M. 1981) und N. Luhmann (Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frankfurt/ M. 1984) vorgeschlagen wurden. Am Begriff der Identitätskommunikation lässt sich vermutlich zeigen, dass viel mehr kommunizierbar ist, als Habermas theoretisch vorsieht, und dass weit mehr Restriktionen für einen gehaltvollen soziologischen Kommunikationsbegriff nötig sind, als Luhmann vorschlägt.
(10) Siehe dazu die Arbeiten von J. Habermas, Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, Frankfurt/M. 1976, R. Döbert/G. Nunner Winkler, Adoleszenzkrise und Identitätsbildung, Frankfurt/M. 1975, und K. Eder, Die Entstehung staatlich organisierter Gesellschaften. Ein Beitrag zu einer Theorie sozialer Evolution, Frankfurt/M. 1976; ders. (Anm. 7). Ein neuerer Versuch der Wiederaufnahme findet sich in H. Honolka, Schwarzrotgrün. Die Bundesrepublik auf der Suche nach ihrer Identität, München 1987. S.57ff. Eine eher kultursoziologische Konzeptualisierung formuliert Ch. Graf von Krockow, Zur Anthropologie und Soziologie der Identität, in: Soziale Welt, 36 (1985), S. 142-152.
(11) Dazu K. Eder (Anm. 7), S. 297 ff. Dort habe ich einen ersten Versuch unternommen, die Suche nach nationaler Identität in den Kontext einer rationalistisch begriffenen Evolution politischer Modernität zu stellen.
(12) In dieser Diskussion nehme ich vor allem auch Anregungen von Max Miller zur Makroanalyse blockierter kollektiver Lernprozesse auf. Siehe dazu M. Miller, Kollektive Erinnerungen und gesellschaftliche Lernprozesse (Vortragsmanuskript), Bad Homburg 1988.
(13) Siehe P. Honigsheim, Romantik und neuromantische Bewegungen, in: Handbuch der Sozialwissenschaften, Bd. 9, Göttingen 1956, S. 26-41.
(14) Zur Diskussion dieser Gegenbewegungen vgl. K. Eder, Counterculture Movements Against Modernity. Nature as a New Field of Class Struggle (Manuskript). München 1989. Die dort diskutierten Phänomene sind vor allem bürgerliche Fluchtbewegungen. Einer genaueren historischen Erforschung bedarf noch die populäre Gegenkultur gegen die Rationalisierung der Arbeitswelt und der öffentlichen Sphäre.
(15) Diese mag für die mehr in der Aufklärungstradition stehenden Teile der neuen sozialen Bewegungen oft misslich sein. Doch der Konflikt zwischen »Fundamentalismus« und »Realismus« lässt sich nicht mehr wie in den alten Bewegungen als eine bloß ephemere Erscheinungsform, als ein »Stadium« im Lernprozess der neuen sozialen Bewegungen abtun. Andererseits wäre die Reduktion der neuen sozialen Bewegungen auf die radikale Aufklärungskritik ebenso irreführend.
(16) Zur Kritik der Wiederaufnahme der Diskussion um nationale Identität und nationale Frage siehe für viele andere den Beitrag von S. Meuschel, Für Menschheit und Volk. Kritik fundamentaler und nationaler Aspekte in der deutschen Friedensbewegung, in: W. Schäfer, Neue soziale Bewegungen: Konservativer Aufbruch im linken Gewand?, Frankfurt/M. 1983. Eine ausführliche Diskussion bietet H. Honolka (Anm.10), insbes. S.38ff. Eine neue Variante findet sich in der aktuellen Diskussion um eine »civil religion«. Zum klassischen Gebrauch siehe J. A. Coleman, Civil Religion, in: Social Analysis, 31 (1970), S. 67-77. Zum normativen Gebrauch vgl. jetzt den Essay von U. Rödel/G. Frankenberg/H. Dubiel, Die demokratische Frage, Frankfurt/M. 1989, S. 117ff.
(17) Siehe dazu H. Eichberg, Nationale Identität. Entfremdung und nationale Frage in der Industriegesellschaft, München 1978; ders.. Balkanisierung für jedermann? Nationale Frage, Identität und Entfremdung in der Industriegesellschaft, in: Befreiung, 19/20 (1981), S. 46-69. Es gibt eine unleugbare Nähe zwischen konservativen Positionen und Regionalismus. Das ist nicht per se ein Argument gegen regionalistische Ideen. Vielmehr steht der Begriff des Konservativismus selbst auf dem Spiel. Vgl. auch R. Spaemann, Ende der Modernität?, in: P. Koslowski/R. Spaemann/R. Löw (Hrsg.), Moderne oder Postmoderne? (Civitas Resultate Bd. 10), Weinheim 1986, S. 19-40.
(18) Dazu I. M. Greverus, Auf der Suche nach Heimat. München 1979. Eine Kritik dieser Heimatsuche findet sich in A. Schmieder, Neue Innerlichkeit oder Ein verändertes Bedürfnis nach Heimat, in: Frankfurter Hefte, Zeitschrift für Kultur und Politik, 37 (1982), S. 49-54.
(19) Eine suggestive Formulierung von H. Eichberg (Anm. 17).
(20) Siehe dazu die ausführliche Diskussion über den deutschen Sonderweg und den für ihn konstitutiven Staatsbegriff. Statt vieler anderer und zusammenfassend K. Eder (Anm. 7). Vgl. auch Ch. Graf von Krockow, Nationalismus als deutsches Problem. München 1970, insbes. S. 77 ff.
(21) Diese Betonung von Natur gegenüber Kultur setzt eine bestimmte Form der Überhöhung von Natur in der deutschen Tradition fort. Es soll dabei aber nicht übersehen werden, dass in dieser Tradition auch die Wurzeln eines alternativen gesellschaftlichen Naturverständnisses liegen, das neuartige Identitätskommunikation möglich macht. Siehe dazu K. Eder, Die Vergesellschaftung der Natur. Studien zur sozialen Evolution der praktischen Vernunft, Frankfurt/M. 1988, S. 225 ff.
(22) Das ist das Thema von Moscovicis Theorie der Menschengeschichte der Natur. Siehe S. Moscovici, Versuch über die menschliche Geschichte der Natur, Frankfurt/M. 1982.
(23) Darauf hat R. Sennett in den beiden Arbeiten: Destruktive Gemeinschaft, in: A. Touraine/H. P. Dreitzel/S. Moscovici/R. Sennet u. a. (Hrsg.), Jenseits der Krise. Wider das politische Defizit der Ökologie, Frankfurt/M. 1976, sowie: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität, Frankfurt/M. 1983, hingewiesen und daraus das Plädoyer für die Stadt gegen das Land, für Kultur und gegen Natur gezogen. Anstatt für Authentizität plädiert er für die Fähigkeit, in der Öffentlichkeit Theater spielen zu können. Doch genau das wird in dieser Denktradition blockiert.
(24) Dieser Begriff wurde von U. Oevermann benutzt, um die technokratischen Züge moderner psychologisch vermittelter Selbstkontrolle zu bezeichnen. Siehe U. Oevermann, Versozialwissenschaftlichung der Identitätsformation und Verweigerung der Lebenspraxis. Eine aktuelle Variante der Dialektik der Aufklärung, in: B. Lutz (Hrsg.), Soziologie und gesellschaftliche Entwicklung (22. Deutscher Soziologentag in Dortmund), Frankfurt/M. 1985. S. 463 ff.; ders., Eine exemplarische Fallanalyse zum Typus versozialwissenschaftlichter Identitätsformation, in: H. G. Brose/B. Hildenbrand (Hrsg.), Vom Ende des Individuums zur Individualität ohne Ende, Opladen 1988, S. 243-286.
(25) Vgl. U. Schimank, Neoromantischer Protest im Spätkapitalismus: Der Widerstand gegen die Stadt und Landschaftsverödung. Bielefeld 1983.
(26) Eine solche Behauptung übergeneralisiert notwendig eine Tendenz in den neuen sozialen Bewegungen. Es gibt aber zwei Gründe, eine solche Übergeneralisierung zu formulieren. Der erste ist die relative Bedeutung aufklärungskritischer Impulse in den neuen sozialen Bewegungen. Der zweite ist der historisch kulturelle Kontext des deutschen Wegs in die politische Moderne, in dem Aufklärungskritik eine destruktive Rolle gespielt hat. Es gibt deshalb Kontextbedingungen, die Rückzugstendenzen aus der Politik eine Bedeutung jenseits der Bedeutung geben, die ihr die Rückzügler selbst geben. Es bleibt dabei unbestritten, dass eine optimistische Deutung auf die innovativen Aspekte eines neuen Politikverständnisses in den neuen sozialen Bewegungen abstellen kann. Doch solche Deutungen sind empirisch nicht entscheidbar. Sie sind selbst Teil des Feldes politischer Auseinandersetzungen und können insofern nur wissenssoziologisch angemessen analysiert werden.
(27) Wir haben es – das dürfte kaum strittig sein – in den neuen sozialen Bewegungen mit Forderungen und Einklagen zu tun, die Folgeprobleme spätindustrieller Entwicklung sind. Strittig ist sicherlich die Behauptung, dass die von den neuen sozialen Bewegungen reklamierte Diskontinuität eine Diskontinuität mit der Aufklärung in der Kontinuität mit der deutschen Geschichte ist.
(28) Dieses Thema ist von verschiedenen Seiten aufgenommen worden. Vgl. dazu N. Luhmann, Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen?, Opladen 1986; K.P. Japp, Neue soziale Bewegungen und die Kontinuität der Moderne, in: J. Berger (Hrsg.), Die Moderne – Kontinuitäten und Zäsuren, Sonderband 4 der Soziale Welt, Göttingen 1986, S. 304-334; C. Offe, New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics, in: Social Research, 52 (1985), S. 817-868; und K. Eder, Soziale Bewegung und kulturelle Evolution. Überlegungen zur Rolle der neuen sozialen Bewegungen in der kulturellen Evolution der Moderne, in: J. Berger (Hrsg.), Die Moderne – Kontinuitäten und Zäsuren, Sonderband 4 der Sozialen Welt. Göttingen 1986, S. 335-357.
(29) Das Hauptmotiv der antidemokratischen Bewegungen wurde – nicht ohne eine gewisse Berechtigung – mit der Angst des Kleinbürgers vor der Unordnung demokratisch geregelter Formen von Vergesellschaftung in Zusammenhang gebracht. Vgl. etwa die aus dem Jahre 1930 stammende Arbeit von S. Kracauer, Die Angestellten. Aus dem neuesten Deutschland, Frankfurt/M. 1985, der die Bedeutung dieses Motivs in den Angestelltenschichten im Berlin der Weimarer Zeit aufgezeigt hat.
(30) Dabei darf nicht übersehen werden, dass sich in dieser normativ motivierten Wendung gegen den Staat eine neue Form des strategischen Umgangs mit dem Staat entwickelt, die das Verhältnis zum Staat und das arbeitet gegen ideengeschichtliche und mentalitätsgeschichtliche Traditionen in Deutschland »normalisiert«. »Antistaatliche« Motive in den neuen sozialen Bewegungen sind deshalb doppeldeutig: Sie können Ausdruck historischer Normalisierungsleistungen sein (die die Einübung eines strategischen Umgangs mit dem Staat ermöglichen). Sie können aber auch – in impliziter Anerkennung von Staatsidealisierungen – in traditioneller Weise antistaatlich sein.
(31) Das Stilkonzept geht über ein bloß intellektualistisches Konzept von argumentativer Verständigung hinaus. Es zwingt dazu, argumentative Prozesse zu kontextuieren und kultursoziologisch zu analysieren. Man kann dabei argumentative Struktur und kulturellen Kontext unterschiedlich gewichten. Vgl. dazu etwa M. Miller, Culture and Collective Argumentation. in: Argumentation, 1987, S. 127-154, und H. U. Gumbrecht/L. K. Pfeiffer (Hrsg.), Stil. Geschichte und Funktionen eines kulturwissenschaftlichen Diskurselements, Frankfurt/ M. 1986.
(32) Diese Funktionsbestimmung ergibt sich offensichtlich zwangsläufig aus systemtheoretischen Ansätzen. Dazu mit sehr unterschiedlichen Intentionen N. Luhmann, Öffentliche Meinung, in: ders., Politische Planung, Opladen 1971, S. 9-34, und C. Offe, Strukturprobleme des kapitalistischen Staates, Frankfurt/M. 1972.
(33) Hier wird wieder der zentrale Stellenwert einer Theorie kollektiver Lernprozesse deutlich. Begriffe wie »Frühwarnsystem« sind einfach unzureichend, um den »agency« Aspekt angemessen begrifflich fassen zu können. Zu weiterführenden Versuchen vgl. M. Miller, Kollektive Lernprozesse. Studien zur Grundlegung einer soziologischen Lerntheorie. Frankfurt/M. 1986; K. Eder (Anm. 7); P. Strydom, Collective Learning: Habermas' Concessions and their Theoretical Implications, in: Philosophy and Social Criticism, 13 (1987), S. 265-281.
(34) Dazu die Arbeit von M. Miller (Anm. 12). Der Historikerstreit kann gerade unter diesem Gesichtspunkt in objektivierender Weise gelesen werden: als ein Versuch der Öffnung von Kommunikation über Vergangenheit mit offensichtlichen Folgeeffekten für die weitere Form der Identitätskommunikation. Zu dieser Diskussion vgl. die Beiträge in der neuen Zeitschrift »History and Memory« (1989).
(35) Dazu aufschlussreich U. Rödel/G. Frankenberg/H. Dubiel (Anm. 16). Sie gehört in den Kontext der neueren Diskussion um das Konzept einer »civil society«. Siehe auch die Beiträge zum Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen, Sonderheft/89: »40 Jahre Soziale Bewegungen: von der verordneten zur erstrittenen Demokratie«, insbesondere die Beiträge von Rolke und Roth.
(36) Man darf nicht vergessen, dass auch die Ersatzidentität eines europäischen Bürgers nur das Problem der Erinnerung an Vergangenes verdeckt. Der Rekurs auf Europa – ausgespielt gegen die deutsche Vergangenheit – würde nur wieder neue Illusionen produzieren. Dies wäre als Kritik an Euphemisierungsversuchen Europas wie dem von E. Morin, Penser l'Europe, Paris 1987, anzumelden.
(37) Ein derartig »prozeduralisierter« Identitätsbegriff ließe sich als das notwendige Komplement zu einem prozeduralisierten Volkssouveränitätsbegriff verstehen, der an die Stelle eines substantialisierten Volkskörpers wie Nation einen abstrakten Begriff von kollektiven Akteuren setzt, deren Identität im Prozess der Beteiligung an diskursiven Prozessen konstituiert wird. Vgl. dazu jetzt J. Habermas, Volkssouveränität als Verfahren. Ein normativer Begriff von Öffentlichkeit, in: Merkur, 43 (1989), S. 465-477.
(38) Diese Alternative ist Ausdruck der sozialen Ambivalenz der Trägergruppen: des Kleinbürgertums. Der Rückgriff auf diesen Begriff ist in einem doppelten Sinne gerechtfertigt. Er bezieht sich auf soziale »Klassen«, die etwas besitzen, nämlich symbolische Produktionsmittel und materielle Reproduktionsmittel. Als Kleineigentümer in Kultur und Ökonomie erleben sie die Ambivalenz ihrer sozialen Position. Die politische Orientierung spiegelt diese Ambivalenz nur wider.
(39) Dieser Begriff bezeichnet jene professionalisierten Experten der Rechtfertigung und Vermittlung politischer Argumente und Symbole, die ins Zentrum der kulturellen Reproduktion moderner Gesellschaften getreten sind. Siehe zur Analyse dieser Gruppe B. Giesen, Moralische Unternehmer und öffentliche Diskussion, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, (1983) 2, S. 230-254.
Literatur
Augstein, Rudolf u. A. (1987): "Historikerstreit". Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung, München.
Bourdieu, Pierre (1982): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main. [/S. 366:]
Bourdieu, Pierre (1984): Homo Academicus. Paris.
Brose, Hanns Georg; Hildenbrand, B. (Hrsg.) (1988): Vom Ende des Individuums zur Individualität ohne Ende. Opladen.
Coleman, James A. (1970): Civil Religion. In: Sociological Analysis 31 (1970), 67-77.
Döbert, Rainer; Nunner Winkler, Gertrud (1975): Adoleszenzkrise und Identitätsbildung. Frankfurt am Main.
Dubiel, Helmut; Frankenberg, Günter; Rödel, Ulrich (1989): Die demokratische Frage. Frankfurt am Main.
Eder, Klaus (1976): Die Entstehung staatlich organisierter Gesellschaften. Ein Beitrag zu einer Theorie sozialer Evolution. Frankfurt am Main.
Eder, Klaus (1985): Geschichte als Lernprozess? Zur Pathogenese politischer Modernität in Deutschland. Frankfurt am Main.
Eder, Klaus (1986): Soziale Bewegung und kulturelle Evolution. Überlegungen zur Rolle der neuen sozialen Bewegungen in der kulturellen Evolution der Moderne. In: Berger, Johannes (Hrsg.) Die Moderne Kontinuitäten und Zäsuren. Sonderband 4, Soziale Welt. Göttingen, 335-357.
Eder, Klaus (1988): Die Vergesellschaftung der Natur. Studien zur sozialen Evolution der praktischen Vernunft. Frankfurt am Main.
Eder, Klaus (1989): Die »Neuen sozialen Bewegungen«: Moralische Kreuzzüge, politische pressure groups oder eine soziale Bewegung? In: Wasmuht, Ulrike C. (Hrsg.), Alternativen zur alten Politik. Die neuen sozialen Bewegungen in der Diskussion. Darmstadt, 177-195.
Eder, Klaus (1989): Politik und Kultur. Zur kultursoziologischen Analyse politischer Partizipation. In: Honneth, Axel; McCarthy, Th.; Offe, Claus; Wellmer, A. (Hrsg.) Zwischenbetrachtungen. Im Prozess der Aufklärung. Jürgen Habermas zum 60. Geburtstag. Frankfurt am Main, 563-592
Eder, Klaus (1989): Counterculture Movements Against Modernity. Nature as a New Field of Class Struggle, Manuskript.
Eichberg, Henning (1978): Nationale Identität. Entfremdung und nationale Frage in der Industriegesellschaft. München.
Eichberg, Henning (1982): Balkanisierung für jedermann? Nationale Frage, Identität und Entfremdung in der Industriegesellschaft. In: Befreiung 19/20 (1982), 46-69.
Forschungsgruppe Neue soziale Bewegungen (Hrsg.) (1989): 40 Jahre Soziale Bewegungen: von der verordneten zur erstrittenen Demokratie. Sonderheft des Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen.
Giesen, B. (1983): Moralische Unternehmer und öffentliche Diskussion. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 2 (1983), 230-254.
Greverus, Ina Maria (1979): Auf der Suche nach Heimat. München.
Gumbrecht, Hans Ulrich; Pfeiffer, K. Ludwig (Hrsg.) (1986): Geschichte und Funktionen eines kulturwissenschaftlichen Diskurselements. Frankfurt am Main.
Habermas, Jürgen (1976): Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus. Frankfurt am Main.
Habermas, Jürgen (1981): Theorie des kommunikativen Handelns, 2 Bde., Frankfurt am Main.
Habermas, Jürgen (1989): Volkssouveränität als Verfahren. Ein normativer Begriff von Öffentlichkeit. In: Merkur, 43 (1989), 465-477.
Honigsheim, Paul (1956): Romantik und neuromantische Bewegungen. In: Handbuch der Sozialwissenschaften (Bd. 9). Göttingen, 26-41.
Honolka, Harro (1987): Schwarzrotgrün. Die Bundesrepublik auf der Suche nach ihrer Identität. München.
Japp, Klaus Peter (1986): Neue soziale Bewegungen und die Kontinuität der Moderne. In: Berger, Johannes (Hrsg.) Die Moderne Kontinuitäten und Zäsuren. Sonderband 4, Soziale Welt. Göttingen, 304-334.
Kracauer, Siegfried (1985): Die Angestellten. Aus dem neuesten Deutschland, Frankfurt am Main. (Original 1930).
Krockow, Christian Graf von (1970): Nationalismus als deutsches Problem. München.
Krockow, Christian Graf von (1985): Zur Anthropologie und Soziologie der Identität. In: Soziale Welt 36 (1985), 142-152.
Luhmann, Niklas (1971): Öffentliche Meinung. In: ders., Politische Planung. Opladen, 9-34.
Luhmann, Niklas (1980): Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft (1. Band). Frankfurt am Main.
Luhmann, Niklas (1984): Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main. [/S. 367:]
Luhmann, Niklas (1986): Die Zukunft der Demokratie. Akademie der Künste, Berlin: Der Traum der Vernunft Vom Elend der Aufklärung. 2. Folge. Neuwied, 207-233.
Luhmann, Niklas (1986): Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen? Opladen.
Miller, Max (1986): Kollektive Lernprozesse. Studien zur Grundlegung einer soziologischen Lerntheorie. Frankfurt am Main.
Miller, Max (1987): Culture and Collective Argumentation. In: Argumentation 1 (1987), 127-154.
Miller, Max (1988): Kollektive Erinnerungen und gesellschaftliche Lernprozesse (Vortragsmanuskript). Bad Homburg.
Morin, Edgar (1987): Penser l'Europe. Paris.
Moscovici, Serge (1982): Versuch über die menschliche Geschichte der Natur. Frankfurt am Main.
Oevermann, Ulrich (1985): Versozialwissenschaftlichung der Identitätsformation und Verweigerung der Lebenspraxis. Eine aktuelle Variante der Dialektik der Aufklärung. In: Lutz. Burkart (Hrsg.) Soziologie und gesellschaftliche Entwicklung. 22. Deutscher Soziologentag in Dortmund. Frankfurt am Main, 463 ff.
Oevermann, Ulrich (1988): Eine exemplarische Fallanalyse zum Typus versozialwissenschaftlichter Identitätsformation. in: Brose, Hanns Georg; Hildenbrand, B. (Hrsg.) Vom Ende des Individuums zur Individualität ohne Ende. Opladen, 243-286.
Offe, Claus (1972): Strukturprobleme des kapitalistischen Staates. Frankfurt am Main.
Offe, Claus (1985): New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics. In: Social Research 52 (1985), 817-868.
Schäfer, Wolf (Hrsg.) (1983): Neue soziale Bewegungen. Konservativer Aufbruch im linken [richtig: bunten; d. Red.] Gewand? Frankfurt am Main.
Schimank, Uwe (1983): Neoromantischer Protest im Spätkapitalismus. Der Widerstand gegen die Stadt- und Landschaftsverödung. Bielefeld.
Schmieder, A. (1982): Neue Innerlichkeit oder Ein verändertes Bedürfnis nach Heimat. In: Frankfurter Hefte, Zeitschrift für Kultur und Politik 37 (1982), 49-54.
Sennett, Richard (1976): Destruktive Gemeinschaft. In: Touraine, Alain; Dreitzel, Hans Peter; Moscovici, Serge; Sennett, Richard; u. a. (Hrsg.) Jenseits der Krise. Wider das politische Defizit der Ökologie. Frankfurt am Main.
Sennett, Richard (1983): Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität, Frankfurt am Main.
Spaemann, Robert (1986): Ende der Modernität? In: Koslowski, Peter; Spaemann, Robert; Löw, Reinhard (Hrsg.), Moderne oder Postmoderne? Zur Signatur des gegenwärtigen Zeitalters (Civitas Resultate Bd. 10). Weinheim, 19-40.
Strydom, Piet (1987): Collective Learning. Habermas' Concessions and their Theoretical Implications. In: Philosophy and Social Criticism 13 (1987), 265-281.
Redaktionelle Änderungen durch sowi-online: Format der Literaturangaben geändert, Vornamen in Literaturliste ergänzt.
Hedtke, Reinhold (2003): Historisch-politische Bildung – ein Exempel für das überholte Selbstverständnis der Fachdidaktiken
Historisch-politische Bildung ist einerseits eine häufige, beliebte und oft emphatisch vorgetragene Forderung. Peter Steinbach etwa bekennt, "politische Bildung ist für mich nur als historische Bildung denkbar, und historische Bildung wird immer auch politische Bildung sein. Mit dieser Festlegung (...) artikuliere ich eine Aufgabe, die ich fast als Mission empfinde: die Integration von Perspektiven historischer und politischer Bildung in der Ausbildung von Sozialkundelehrern und in der politischen Bildung, also im historisch-politischen Unterricht" (Steinbach 1998, 113).
Andererseits stehen viele Geschichtsdidaktiker diesem Integrationsbegriff skeptisch gegenüber. So kritisiert Jörn Rüsen, dass der Bindestrich der historisch-politischen Bildung einen Abgrund ungeklärter Fragen enthalte, und fordert nachdrücklich eine klare Unterscheidung von historischer und politischer Bildung (Rüsen 1996, 504).
Hans-Jürgen Pandel betont nicht nur die grundlegenden Unterschiede zwischen den Zielen - historisches Bewusstsein hier und politisches Bewusstsein dort - sondern bezweifelt mit wissenschaftstheoretischen Argumenten, dass die intendierte fachübergreifende Bildung überhaupt sinnvoll und möglich sei (Pandel 1997 u. 2001).
Folgt man Bernhard Sutor, sind Geschichtsunterricht und Politikunterricht zum einen zwei grundsätzlich eigenständige Pfeiler politischer Bildung (Sutor 1997, 332). Zum anderen überschneiden sich Politik- und Geschichtsunterricht sowohl inhaltlich als auch kategorial, aber doch nur teilweise. Politische Bildung will er "als politisch-zeitgeschichtlichen Unterricht an[zu]legen mit dem Ziel, der nachwachsenden Generation den Erwerb von Orientierungs-, Urteils- und Handlungskompetenz in politischen Gegenwartsfragen im Kontext ihrer Geschichte zu ermöglichen" (S. 336).
Das Verhältnis von politischer und historischer Bildung scheint also einigermaßen unübersichtlich und schwierig zu sein. Zuständig für dessen theoretische Klärung sind in erster Linie Geschichtsdidaktik und Politikdidaktik; von ihrem Selbstverständnis, von ihren Paradigmen und von ihrem Verhältnis zueinander hängt es wesentlich ab, ob und wie die beiden Bildungen aufeinander bezogen werden können.
Wo liegen die theoretischen Schwierigkeiten einer historisch-politischen Bildung? Kann man sie überwinden, und wenn ja, wie? Die Probleme wurzeln vor allem in der wachsenden disziplinären und methodologischen Unübersichtlichkeit der Sozial- und Kulturwissenschaften, in der Art und Weise, wie sich Fachdidaktiken als Fach konstituieren, etablieren und differenzieren und in den dadurch entstehenden Pfadabhängigkeiten, sowie nicht zuletzt in den Fächerfiktionen, mit denen Fachdidaktiken arbeiten. [/S. 113:]
Ich argumentiere in vier Schritten. Zunächst beschäftige ich mich sehr kurz mit dem Selbstverständnis von Geschichtsdidaktik und Politikdidaktik sowie den Intentionen, die diese mit historischer und politischer Bildung verbinden. Dann prüfe ich, ob und wie sich diese Fachdidaktiken über den Disziplinbezug und über typische Erkenntnisweisen definieren können. Drittens zeige ich, wie Fachdidaktiken ihre Fachwissenschaften fachdidaktisch rekonstruieren können. Schließlich mache ich viertens einige Vorschläge zum Verhältnis von Geschichtsdidaktik und Politikdidaktik.
1. Geschichtsdidaktik und Politikdidaktik als Disziplinen
Geschichtsdidaktik versteht sich seit etwa einem Vierteljahrhundert mehrheitlich als Wissenschaft vom Geschichtsbewusstsein und vom historischen Lernen (z. B. Jeismann 2000a, 81, Rohlfes 1999, 19 f.). Diese Neuaufstellung als Disziplin entwickelte sich aus einer Position der Defensive. Sie stand in engem Zusammenhang mit dem Versuch von Geschichtswissenschaft und Historik, der Dominanz naturwissenschaftlicher Wissenschaftsnormen - vor allem: nomologische Erklärungsstruktur und Idee der Einheitswissenschaft - und dem Siegeszug der Sozialwissenschaften etwas entgegenzusetzen. In diesem Kontext wurde das narrativistische Paradigma in Fachwissenschaft und Fachdidaktik stark gemacht. Es etabliert das historische Erzählen realer vergangener Vorkommnisse als einen eigenen Erklärungstyp. "Erzählen macht aus Zeit Sinn, indem es die Zeitfolge von Vorkommnissen (...) in einen inneren Zusammenhang dieser Vorkommnisse selbst bringt" und dabei "eine Orientierungsfunktion" in der Gegenwart übernimmt (Rüsen 1996, 508). Mit diesem breiten Selbstverständnis hat sich Geschichtsdidaktik als eigenständige Disziplin von Geschichtswissenschaft und Erziehungswissenschaft emanzipiert und zugleich die Dominanz von Schul- und Unterrichtsbezug überwunden; gleichwohl ist ihr Status nicht unumstritten (S. 505).
Politikdidaktik versteht sich mehrheitlich als Wissenschaft vom politischen Lernen. Sie positioniert sich als doppelte Teildisziplin, einerseits von Politikwissenschaft - manche nehmen Bezüge zu Soziologie und Ökonomik hinzu -, andererseits von Erziehungswissenschaft (Sander 1997, 19 u. 21). Damit bleibt der disziplinäre Geltungsanspruch des politikdidaktischen Mainstreams bescheidener als der der Geschichtsdidaktik. Das gilt sowohl in der Dimension des Forschungsgegenstandes als auch in der des disziplinären Selbstbewusstseins.
Betrachtet man Geschichtsdidaktik und Politikdidaktik auf der Ebene von Zielvorstellungen und Prinzipien, findet man bei historischer und politischer Bildung eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Gemeinsame Felder bilden beispielweise Aufklärung und reflektierte Distanz gegenüber der Gegenwart und kommunikative Verflüssigung ihrer verfestigten Verhältnisse, Multiperspektivität, Perspektivenwechsel und Fremdverstehen, Pluralität und Kontroversität sowie Diskursfähigkeit trotz divergenter politischer Normen und Positionen.
Die meisten Dimensionen des Pandelschen Konzepts von Geschichtsbewusstsein gehören auch zum Kern der Politikdidaktik: Wirklichkeitsbewusstsein, Identitätsbewusstsein, politisches [/S. 114:] Bewusstsein, ökonomisch-soziales Bewusstsein und moralisches Bewusstsein (Pandel 1987, 132-138).
So viel Gemeinsamkeit bei Programmatik und Prinzipien lässt eine historisch-politische Bildung als naheliegend, sinnvoll und wünschenswert erscheinen. Aber auf der Ebene der allgemeinen Ziele zeigen sich nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern auch Divergenzen zwischen politischer und historischer Bildung. Politische Bildung, so argumentiert Hans-Jürgen Pandel, solle Orientierung in der Gegenwart und für die absehbare Zukunft und für politisches Handeln geben, historische Bildung dagegen beanspruche Orientierung in der Zeit, ohne handlungsbezogen sein zu können (Pandel 1997, 321). Der "Bindestrichbegriff" politisch-historische Bildung verdecke diese beiden grundsätzlich unterscheidbaren Bewusstseinsstrategien, die gleichwohl aufeinander bezogen seien (S. 321). Politisches Bewusstsein sei auf Handeln in der Dimension Macht und Herrschaft gerichtet; historischem Bewusstsein dagegen gehe es um die kontingenten Erfahrungen der Lebenspraxis und darum, sie so zu deuten, dass ein sinnvoller Zeitzusammenhang, eine Geschichte konstruiert werden könne (S. 321 f.). Politisches Bewusstsein mache Bedingungen und Möglichkeiten des Handelns klar und verfügbar, historisches Bewusstsein gebe politischem Handeln Orientierung (S. 322).
Das Verhältnis der Disziplinen Politikdidaktik und Geschichtsdidaktik scheint seit langem durch eine merkwürdige Spannung zwischen Fremdheit und Nähe, Divergenz und Konvergenz, Konkurrenz und Kooperation geprägt. Beide blicken - aus unterschiedlichen Perspektiven - auf eine gemeinsame, wechselvolle Geschichte zurück. Man denke nur an die Auseinandersetzungen um die Eigenständigkeit einer politischen Bildung neben dem Schulfach Geschichte, an die heftigen Konflikte um die Hessischen Rahmenrichtlinien Gesellschaftslehre oder an die faktische Fächerhierarchie der gymnasialen Oberstufe.
Das Verhältnis der beiden Fachdidaktiken ist unklar und ambivalent, eine historisch-politische Bildung steht theoretisch auf unsicherem Boden. Das zeigt auch ein kurzer Blick auf die Versuche, das Problem der fachdidaktischen Identität und der interdisziplinären Abgrenzung zu lösen, indem man auf unterschiedliche Disziplinbezüge und Erkenntnisweisen setzt.
2. Disziplinbezüge und Erkenntnisweisen als Problem
Fachdidaktiken und fachlich definierte Bildungen müssen sich zu möglichen wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen, Erkenntnisweisen und Paradigmen in ein Verhältnis setzen. Sie müssen entscheiden, worauf sie sich beziehen wollen und worauf nicht. Als vorrangig wird traditionell der Disziplinbezug betrachtet. Von der Bezugsdisziplin erwarten viele Fachdidaktiken die entscheidende Stütze ihrer Identität. Zumindest in den Sozial- und Kulturwissenschaften wird diese Stütze aber immer brüchiger.
2.1 Bezugsdisziplinen
Bei den jeweils vorherrschenden Bezügen auf fachwissenschaftliche Disziplinen haben historische und politische Bildung zu Beginn des 21. Jahr- [/S. 115:] hunderts wenig Gemeinsamkeiten. Die Fachdidaktik der historischen Bildung bezieht sich eher eindeutig und dominant auf Geschichtswissenschaft, die Fachdidaktik der politischen Bildung eher mehrdeutig und in wechselnden Gewichtungen auf Politikwissenschaft, Soziologie und Ökonomik; auch Zeitgeschichte spielt eine gewisse Rolle. Diese Differenz bezeichnet Pandel als Asymmetrie auf der Ebene der Bezugsdisziplinen (1997, 319). Seine Diagnose einer Asymmetrie gilt allerdings nur noch bedingt, da sich in der Politikdidaktik die Anhänger eines monodisziplinären Bezugs auf die Politikwissenschaft eher aus fachpolitischen denn aus fachdidaktischen Gründen immer mehr durchsetzen. Nichtsdestotrotz: Geschichtsdidaktik und Politikdidaktik beziehen sich auf unterschiedliche Disziplinen.
Verlässt man die globale Ebene dieser Großdisziplinen und betrachtet ihre Binnendifferenzierung, relativiert sich die bezugsdisziplinäre Differenz, und die traditionelle disziplinäre Trennschärfe verblasst. Einerseits differenzieren sich die traditionellen Disziplinen immer stärker aus und werden zu Großdisziplinen, deren Leitdifferenz in eine Mehrzahl unterschiedlicher Teildifferenzen zerfällt.
Andererseits arbeiten viele der Disziplinen, die zu einer der Großdisziplinen Geschichtswissenschaft, Politikwissenschaft oder Soziologie, aber auch Ökonomik, gehören, immer häufiger mit überdisziplinär geteilten Paradigmen. Es bilden sich disziplinübergreifende Paradigmen mit gemeinsamen Theoriekonzepten und Methodologien heraus. Beispiele sind der Rational-Choice-Ansatz in Soziologie, Ökonomik und Politikwissenschaft oder der Neue Institutionalismus in Ökonomik, Politikwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte (vgl. Hedtke 2002).
Aus diesen Gründen wird es immer schwieriger, im Bezug auf eine Großdisziplin ein unterscheidungskräftiges und kommunikationsfähiges Proprium für Geschichtsdidaktik und für Politikdidaktik zu finden.
2.2 Erkenntnisweisen
Erkenntnisweisen könnten eine verlässlichere Orientierung als Großdisziplinen bieten. Die paradigmatisch unscharfe Gestalt der Disziplinen könnte durch deren unterschiedliche Erkenntnisweisen oder Methodologien schärfer konturiert werden. Man kann versuchen, über die Erkenntnisweisen eine je spezifische disziplinäre Identität zu begründen. Dazu benötigt man als Grundlage eine Typologie von Erkenntnisweisen. Für die Kulturwissenschaften hat Hans-Jürgen Pandel jüngst eine Typologie vorgeschlagen (Pandel 2001): historisch-hermeneutische, kritisch-dialektische, empirisch-analytische, quantitativ-statistische, narrativ-faktuale und empathisch-fiktionale Erkenntnisweise.
Aber auch hier stößt man bald wieder auf das Problem der Trennschärfe: Man kann diese Erkenntnisweisen - und auch sämtliche Erkenntnisweisen, die man durch andere Typologien erhalten würde - nicht disziplinär trennscharf einzelnen Fachwissenschaften zuordnen. Eine bestimmte Erkenntnisweise kann zum Fundament mehrerer Disziplinen gehören, eine Disziplin kann sich auf mehrere Erkenntnisweisen gründen. [/S. 116:] Nehmen wir die quantitativ-statistische Verfahrensweise als Beispiel. Wir finden sie als prominentes methodologisches Muster in Disziplinen aus unterschiedlichen Großdisziplinen: in der Wirtschaftsgeschichte, in der Wirtschaftssoziologie, in der Wahlforschung, in der Wirtschaftsstatistik und in der empirischen Makroökonomik. Wenn nicht Gegenstände, sondern Erkenntnis- und Frageweisen Disziplinen konstituieren, stehen sich die genannten Disziplinen wechselseitig wesentlich näher als den Großdisziplinen, denen sie jeweils zugerechnet werden.
Ein zweites Beispiel ist die historisch-hermeneutische Verfahrensweise. Auch sie wird multidisziplinär verwendet. Prominente Exempel dafür sind die historisch-kulturvergleichende Kapitalismusanalyse von Max Weber, die Sinndeutung des Demokratiebegriffs durch Wilhelm Hennis (Hennis 1973), phänomenologische Analysen von Lebenswelten in der Schütz'schen Tradition oder wissenssoziologische Untersuchungen nach dem Berger-Luckmann-Ansatz (Berger/Luckmann 1969).
Die Einsicht in die Unschärfe der Relation Großdisziplin - Erkenntnisweise bedeutet nun keineswegs, dass man auf eine möglichst scharfe Unterscheidung der wissenschaftlichen Erkenntnisweisen verzichten könnte oder sollte. Ganz im Gegenteil, die Erkenntnisweisen repräsentieren spezifische Sichtweisen auf die Welt, und zusammen mit den angewendeten Methoden konstruieren sie erst die unterschiedlichen Welten und ihre Gegenstände (Pandel 2001).
Deshalb könnten die Erkenntnisweisen nur um den Preis eines radikalen Erkenntnisverlustes aufgegeben werden (Pandel 1997 u. 2001). Insbesondere aus fachdidaktischer Sicht halte ich es für kontraproduktiv, Erkenntnisweisen unkontrolliert zu mischen und tendenziell zu homogenisieren. Ganzheitlichkeit ist ein fachdidaktischer Irrweg.
2.3 Neuordnung der Disziplinen?
Es bleibt festzuhalten, dass man die traditionelle Ordnung der Disziplinen nicht mehr überzeugend mit deren spezifischen Erkenntnisweisen begründen kann. Wenn Erkenntnisweisen konstitutive Faktoren von Disziplinen (und von Erkenntnisobjekten) sind, viele Disziplinen aber mit mehreren Erkenntnisweisen arbeiten und viele Erkenntnisweisen zu mehreren Disziplinen gehören, dann müsste man die Disziplinenordnung reorganisieren - wenn man Wert auf eine klare Systematik legen würde.
Wissenschaftsgeschichtliche und wissenschaftssoziologische Grundeinsichten warnen aber vor diesem Unterfangen. Zwar sind fachwissenschaftliche und fachdidaktische Strukturen historisch kontingent, aber daraus Hoffnungen abzuleiten, man könne sie ändern und neu schneiden, ist recht kühn. Bereits die öffentliche Absichtserklärung, diese Strukturen auch nur kommunikativ verflüssigen zu wollen, bedeutet eine Herausforderung. Dennoch: Die Debatte muss geführt werden - auch und gerade in den sozial- und kulturwissenschaftlichen Fachdidaktiken.
Denn in der zunehmenden Lockerung der festen Kopplungen zwischen Erkenntnisweisen und Disziplinen liegen Chancen für die Fachdidaktiken. Sie können und müssen nun nach fachdidaktischen Kriterien entscheiden, welche Erkenntnisweisen für ihre Leitziele, Leitthemen und Leitkategorien [/S. 117:] - und für ihre fachpolitische Profilierung - besonders geeignet sind und welche nicht. Wie weit sie dabei gehen können, ist noch unklar. Kann man etwa eine Großdisziplin "historisch-sozialwissenschaftliche Didaktik" denken, deren unterschiedliche Disziplinen sich nach Erkenntnisweisen konstituieren? Könnte sich beispielsweise eine dieser Disziplinen durch die Kombination von historisch-hermeneutischer (intentionale Erklärung) und narrativ-faktualer (narrativistische Erklärung) Erkenntnisweise konstituieren? Diese Fragen müssen hier noch offen bleiben.
Die Fachdidaktiken müssen natürlich auch entscheiden, wie sie die ausgewählten Erkenntnisweisen curricular anordnen, thematisieren, methodisch realisieren und zueinander in Beziehung setzen wollen. Im Feld historisch-politischen Lernens kann ein sinnvolles Arrangement der einschlägigen Erkenntnisweisen nur erreicht werden, wenn die beteiligten Fachdidaktiken miteinander kommunizieren und kooperieren. Das gilt nicht nur für schulische, sondern auch für universitäre Bildung.
2.4 Fachinterne Divergenz und Integration
Die Großdisziplinen entpuppen sich also bei näherer Betrachtung als multimethodologisch und die Erkenntnisweisen als multidisziplinär. Innerhalb der Großdisziplinen bilden sich eigenständige Disziplinen heraus, charakteristisch ist fachinterne Divergenz. Die Vorstellung eines methodologisch mehr oder weniger geschlossenen Faches, auf das sich Fachdidaktik beziehen zu können meint, entpuppt sich immer mehr als fachpolitische Strategie und fachdidaktische Fiktion - und es kann sein, dass das fachdidaktische Bild von der Bezugsdisziplin in den Sozial- und Kulturwissenschaften nie etwas anderes als Fiktion gewesen ist.
Geschichtsdidaktik hat es schon längst mit Geschichtswissenschaften statt mit Geschichtswissenschaft zu tun, und Politikdidaktik sieht sich mit einer Mehrzahl von Politikwissenschaften konfrontiert - von der Soziologie ganz zu schweigen. Pandel konstatiert, "[d]ie quantitativ arbeitende Wirtschaftsgeschichte hat methodisch mehr Gemeinsamkeiten mit der Ökonomie als mit der weitgehend hermeneutischen Mediävistik" (Pandel 2001). Damit stellt sich die fachdidaktische Aufgabe einer Integration unterschiedlicher Fächer und Erkenntnisweisen schon innerhalb der jeweils ausgewählten einzelnen Bezugsdisziplin. Es ist eine verbreitete Illusion zu glauben, dass die Spannweite und Diversität dessen, was didaktisch innerhalb einer Großdisziplin zu integrieren wäre, wesentlich geringer sei als zwischen zwei Großdisziplinen wie Geschichtswissenschaft und Politikwissenschaft.
2.5 Fachinterne Divergenz und Integration
Wir haben es also im kultur- und sozialwissenschaftlichen Feld mit einem ausgeprägten Pluralismus der Erkenntnisweisen, Disziplinen und Paradigmen zu tun, der vielgestaltige Kombinationen hervorbringt und erlaubt. Diese Situation gibt den Fachdidaktiken der historischen und der politischen Bildung einen relativ hohen Freiheitsgrad bei ihren konstitutiven Entscheidungen: der Wahl von Erkenntnisweisen und Bezugsdisziplinen. [/S. 118:]
So gesehen wird die historisch gewachsene und fachpolitisch gesteuerte Zuordnung und Ausdifferenzierung von Großdisziplinen und Disziplinen für Fachdidaktiken zu einem, aus theoretischer Sicht zweitrangigen Aspekt ihres Selbstverständnisses. Das gilt besonders für Fachdidaktiken, die sich an Leitkategorien wie Geschichtsbewusstsein orientieren oder die sich an Politikbewusstsein oder Wirtschaftsbewusstsein orientieren könnten. Sie machen es sich zur Aufgabe, diese gesellschaftlich konstruierten, kollektiv geteilten und unterschiedlichen "Bewusstseine" zur Sprache zu bringen, erlebbar zu machen, zu beschreiben, zu irritieren, aufzuklären, weiterzuentwickeln und zu reflektieren. Als Wissenschaften vom fachspezifischen Lernen könnten sie ihr Interesse auf die nachwachsende Generation konzentrieren. Wie sich Fachdidaktiken auf Disziplinen und Erkenntnisweisen beziehen, sollten sie danach entscheiden, welche Erkenntnisweisen und welche Disziplinen leistungsfähige Beiträge zur Bearbeitung der fachdidaktischen Leitfragen und zur Aufklärung ihres Forschungsgegenstandes liefern können. So würde sich etwa eine Politikdidaktik, die sich durch die Leitkategorie Politikbewusstsein definiert, wesentlich stärker als bisher auf Kommunikationssoziologie, Medienforschung, Wissenssoziologie, Sozialpsychologie, Sozialisationsforschung und Demoskopie beziehen müssen - und auf Geschichtswissenschaft und Geschichtsdidaktik!
3. Fachdidaktische Rekonstruktion der Fachwissenschaft
Vor dem skizzierten Hintergrund ändert sich das Verhältnis von Fachdidaktiken und Fachwissenschaften. Fachdidaktiken, deren Perspektive sich auf Entwicklung, Formen und Inhalte gesellschaftlichen Bewusstseins und auf die damit verbundenen Sozialisations-, Lern- und Verständigungsprozesse richtet, können gegenüber den Fachwissenschaften an Autonomie und Selbstbewusstsein gewinnen. Denn diese Perspektive können sie auch auf die Fachwissenschaften selbst richten, um die Fachwissenschaft fachdidaktisch zu rekonstruieren. Fachdidaktische Rekonstruktion heißt, die implizite Didaktik der jeweiligen Bezugsdisziplin und ihres Verhältnisses zur externen (und internen) Öffentlichkeit zu beschreiben, zu erklären und möglicherweise zu kritisieren und umzugestalten. Fachdidaktiken, die Geschichtsbewusstsein, Politikbewusstsein oder Wirtschaftsbewusstsein in einer Gesellschaft in das Zentrum ihres Interesses stellen, machen auch didaktische Intentionen und Funktionen der einschlägigen Fachwissenschaften, die in der gesellschaftlichen Kommunikation über Geschichte, Politik und Wirtschaft zum Tragen kommen, zum fachdidaktischen Forschungsgegenstand. Fachdidaktik analysiert die implizite - und explizite! - Didaktik der Fachwissenschaften und stellt sie so in einen auf gesellschaftliche Kommunikation gegründeten und gerichteten Kontext. Tilman Grammes' kommunikative Fachdidaktik, die die unterschiedlichen Wissensformen zentral stellt (Grammes 1998), erhält dann eine neue Dimension: Fachdidaktik kann zu einem Ort der Selbstreflexion von Fachwissenschaft werden (vgl. Bergmann 1997, 248). Wollen Fachdidaktiker so unbescheiden sein? [/S. 119:]
Das didaktische Interesse und die didaktische Wirkung der Fachwissenschaft ist der Geschichtsdidaktik offensichtlich bewusst (S. 248 f.). So betont Jeismann, dass die Geschichtswissenschaft nicht unwesentlich zur "Selbstverständigung der Gegenwart" beitrage und "in Motivation und Wirkung didaktischer Natur" sei (Jeismann 2000a, 82). Diese Diagnose gilt meines Erachtens erst recht für Politikwissenschaft, Soziologie oder Ökonomik. Der ökonomische Mainstream beispielsweise ist tief erfüllt von der Mission, der Gesellschaft die Überlegenheit des marktwirtschaftlichen Koordinationsmechanismus nachzuweisen und sie dazu zu bringen, ihre Institutionen nach dem Modell des Marktes neu zu gestalten.
Die fachdidaktische Rekonstruktion der Fachwissenschaft scheint der Geschichtsdidaktik mit der Leitkategorie Geschichtsbewusstsein ein Stück weit gelungen zu sein, während die Politikdidaktik mehrheitlich noch weit davon entfernt ist. Andere Fachdidaktiken müssen beides noch entdecken. Allerdings relativiert Bodo von Borries mit empirischen Befunden aus seinen groß angelegten Studien die bewusstseinsprägende Rolle der Geschichtswissenschaft und betont die Prägekraft nationaler Geschichtskulturen (von Borries 1999, 374). In ähnlicher Weise beklagen einige Politikwissenschaftler Wissenslücken, Vorurteile und Lernwiderstände der Bürger (z. B. Patzelt 1996) - und dokumentieren damit zugleich den didaktischen Impetus ihrer Disziplin und dessen begrenzte Wirkung.
4. Differenzierung und Integration über Leitkategorien und Erkenntnisweisen
Angesichts des unübersichtlichen theoretischen Status der Fachdidaktiken im gesellschafts- und geschichtswissenschaftlichen Feld kann man zur Zeit weder eine Integration historisch-politischer Bildung noch deren klare Trennung theoretisch überzeugend begründen.
Das traditionelle Muster, mit dem Fachdidaktiken ihre disziplinäre Identität herstellen und sichern wollen, besteht darin, sich mehr oder weniger eindeutig auf Großdisziplinen und/oder auf deren typische Erkenntnisweisen zu beziehen. Dieses Muster wird angesichts der Doppelbewegung von Differenzierung und Konvergenz der Disziplinen zunehmend obsolet: einer starken disziplinären und binnendisziplinären Ausdifferenzierung der Sozial- und Kulturwissenschaften stehen paradigmatische und methodologische Konvergenzen zwischen den Disziplinen gegenüber. Auch die aktuelle Debatte um das integrative Paradigma der Kulturwissenschaft und einer kulturwissenschaftlichen Methodologie schwächt das traditionelle Muster fachdidaktischer Identität. Vor allem in den siebziger Jahren hat sich die Geschichte mit dem Paradigma der Historischen Sozialwissenschaft in ihrer Fragestellung und ihrer Methodologie den Sozialwissenschaften angenähert. In der jüngsten Vergangenheit kann man nun feststellen, dass sich die Sozialwissenschaften unter dem Paradigma der Kulturwissenschaft ihrerseits der historischen Methodologie annähern. Das gilt insbesondere für die so genannte "kulturwissenschaftliche Wende" der Soziologie, die sich auf die Leitkategorien wie Sinn, Kultur und Historizität richtet (vgl. Lichtblau 2001; Barrelmeyer/Kruse 2002). [/S. 120:]
Vor diesem Hintergrund ist es dringender und schwieriger denn je, historische und politische Bildung von einander zu unterscheiden und unter Aufrechterhaltung und Akzentuierung ihrer Unterschiedlichkeit aufeinander zu beziehen. Die fehlende disziplinäre Trennschärfe der fachwissenschaftlichen Erkenntnisweisen wäre dann für Fachdidaktiken weniger ein Problem als eine Chance, wenn diese sich als eigenständige Disziplinen begreifen oder dazu werden wollen.
Ein eigenständiges, sowohl gemeinsames wie unterschiedenes theoretisches Fundament könnten die Fachdidaktiken des sozial- und kulturwissenschaftlichen Feldes in der Leitkategorie "gesellschaftliches Bewusstsein" und deren Ausdifferenzierung in historisches, politisches und ökonomisches Bewusstsein finden. Darüber hinaus könnte jede Fachdidaktik ihr Spezifikum durch die begründete Wahl derjenigen Erkenntnisweisen schärfen, auf die sie sich konzentrieren will. Geschichts-, Politik- und Wirtschaftsdidaktik wären damit einerseits integriert, nämlich über die allgemeine Leitkategorie gesellschaftliches Bewusstsein und über die Schnittmengen und wechselseitigen Zusammenhänge von historischem, politischem und ökonomischen Bewusstsein. Andererseits wären sie deutlich differenziert, nämlich durch die je unterschiedlichen Leitkategorien Geschichts-, Politik- und Wirtschaftsbewusstsein, durch die spezifischen Erkenntnisweisen, mit denen sie diese Leitkategorien bearbeiten, und nicht zuletzt durch die wesentlichen Differenzen in der Handlungsdimension (auf die ich hier nicht näher eingehen kann).
Mit der Leitkategorie Geschichtsbewusstsein und der Fokussierung auf das narrativistische Paradigma scheint die Geschichtsdidaktik in dieser Richtung bereits einigermaßen erfolgreich zu sein, jedenfalls erfolgreicher als die Politikdidaktik, die sich zunehmend unter die Obhut der Politikwissenschaft flüchtet. Würden sich Politikdidaktik auf die Leitkategorie politisches Bewusstsein und Wirtschaftsdidaktik auf die Leitkategorie ökonomisches Bewusstsein orientieren, könnten sie mit der Geschichtsdidaktik an einem gemeinsamen Ziel arbeiten: Geschichts-, Politik-, Wirtschafts- und Gesellschaftsbilder als perspektivische und aufeinander bezogene Konstrukte durchschaubar zu machen und "die gegenwärtige Gesellschaft in ein 'bewusstes' Verhältnis" zu ihrer Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft zu setzen (Jeismann 1990/2000, 47). Im Spannungsfeld zwischen Erwartung und Erinnerung würde damit zugleich die von Jörn Rüsen eingeforderte "kulturelle Erinnerungsarbeit" zur "Öffnung des historischen Bewusstseins für die Zukunftsgestaltung" möglich (Rüsen 1998, 232 u. 228).
Wie weit die Leitkategorie "gesellschaftliches Bewusstsein", der wechselseitige Zusammenhang von Geschichts-, Politik- und Wirtschaftsbewusstsein und die didaktische Rekonstruktion der Fachwissenschaften tragen, wäre aber auch empirisch zu überprüfen. Das zeigt sich exemplarisch am Geschichtsbewusstsein. Der Vorschlag, Geschichtsbewusstsein prospektiv für die Zukunft zu aktivieren, überzeugt im Jeismann-Rüsen-Konzept zwar theoretisch; aber von Borries zeigt, dass sich dazu zumindest bei Jugendlichen empirisch kaum ein Korrelat findet (von Borries 1999, 378-381). Dieses Forschungsfeld, das sich für Denkmuster und [/S. 121:] Denkprozesse des gesellschaftlichen Bewusstseins bei Jugendlichen interessiert und zusätzlich nach den didaktischen Effekten der einschlägigen Fachwissenschaften fragt, kann gut mit der empirischen Unterrichtsforschung verknüpft werden.
Angesichts des "Abgrunds ungeklärter Fragen" kann eine seriöse Theorie einer historisch-politischen Bildung und ihrer Fachdidaktiken derzeit nicht vorgelegt werden. Die Fachdidaktiken des kultur- und sozialwissenschaftlichen Feldes, nicht nur die Geschichts- und die Politikdidaktik, müssen eine Debatte darüber beginnen, wie sie sich angesichts der wissenschaftstheoretischen Unübersichtlichkeit positionieren und zueinander verhalten wollen. Fachdidaktische Selbstentwürfe, die voluntaristisch oder autistisch argumentieren, bleiben allemal unterkomplex. Einen einigermaßen rationalen und wissenschaftstheoretisch anspruchsvollen Diskurs unter den einschlägigen Fachdidaktiken zu beginnen, der über eine rein fachstrategisch motivierte Kommunikation hinausreicht, ist zwar mühsam, aber unvermeidlich.
Literatur
Barrelmeyer, Uwe; Kruse, Volker (2002): Sind die methodologischen Arbeiten Max Webers für die gegenwärtige kulturwissenschaftliche Soziologie nicht anschlussfähig? Einige Überlegungen zu Klaus Lichtblaus Aufsatz "Soziologie als Kulturwissenschaft?". In: Soziologie (3). Seite 5-22.
Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (1969): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt am Main: Fischer.
Bergmann, Klaus (1997): Geschichte in der didaktischen Reflexion. In: Bergmann, Klaus; Fröhlich, Klaus; Kuhn, Annette; Rüsen, Jörn; Schneider, Gerhard (Hg.): Handbuch der Geschichtsdidaktik. Seelze-Velber: Kallmeyer, Seite 245-254.
Bergmann, Klaus; Fröhlich, Klaus; Kuhn, Annette; Rüsen, Jörn; Schneider, Gerhard (Hg.) (1997): Handbuch der Geschichtsdidaktik. 5. Aufl. Seelze-Velber: Kallmeyer, Seite 319-323.
Borries, Bodo von (1995): Das Geschichtsbewusstsein Jugendlicher. Eine repräsentative Untersuchung über Vergangenheitsdeutungen, Gegenwartswahrnehmungen und Zukunftserwartungen von Schülerinnen und Schülern in Ost- und Westdeutschland. Weinheim, München: Juventa.
Borries, Bodo von (1999): Jugend und Geschichte. Ein europäischer Kulturvergleich aus deutscher Sicht. (Schule und Gesellschaft; 21). Opladen: Leske + Budrich.
Eder, Klaus (1990): Kollektive Identität, historisches Bewusstsein und politische Bildung. In: Umbrüche in der Industriegesellschaft. Herausforderungen für die politische Bildung. Bonn: Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung 284, Seite 351-368. s. auch in sowi-online
Grammes, Tilman (1998): Kommunikative Fachdidaktik. Politik, Geschichte, Recht, Wirtschaft. Opladen: Leske + Budrich.
Hedtke, Reinhold (2002): Wirtschaft und Politik. Über die fragwürdige Trennung von ökonomischer und politischer Bildung. Schwalbach/Ts.: [/S. 122:] Wochenschau.
Hennis, Wilhelm (1973): Die missverstandene Demokratie. Demokratie - Verfassung - Parlament. Freiburg/Br.: Herder.
Jeismann, Karl-Ernst (1990/2000): "Geschichtsbewusstsein" als zentrale Kategorie der Didaktik des Geschichtsunterrichts. In: Jeismann, Karl-Ernst: Geschichte und Bildung. Beiträge zur Geschichtsdidaktik und zur Historischen Bildungsforschung. Hg. von Wolfgang Jacobmeyer und Bernd Schönemann. Paderborn, München, Wien, Zürich: Schöningh, Seite 46-72. (Orig. 1990).
Jeismann, Karl-Ernst (2000): Geschichte und Bildung. Beiträge zur Geschichtsdidaktik und zur Historischen Bildungsforschung. Hg. von Wolfgang Jacobmeyer und Bernd Schönemann. Paderborn, München, Wien, Zürich: Schöningh.
Jeismann, Karl-Ernst (2000a): Zum Verhältnis von Fachwissenschaft und Fachdidaktik. In: Jeismann, Karl-Ernst: Geschichte und Bildung. Beiträge zur Geschichtsdidaktik und zur Historischen Bildungsforschung. Hg. von Wolfgang Jacobmeyer und Bernd Schönemann. Paderborn, München, Wien, Zürich: Schöningh, Seite 73-86.
Lichtblau, Klaus (2001): Soziologie als Kulturwissenschaft? Zur Rolle des Kulturbegriffs in der Selbstreflexion der deutschsprachigen Soziologie. In: Soziologie (1), 5.-21.
Pandel, Hans-Jürgen (1978): Integration durch Eigenständigkeit? Zum didaktischen Zusammenhang von Gegenwartsproblemen und fachspezifischen Erkenntnisweisen. In: Schörken, Rolf (Hg.): Zur Zusammenarbeit von Geschichts- und Politikunterricht. (Anmerkungen und Argumente zur historischen und politischen Bildung; 20). Stuttgart: Klett, Seite 346-379. s. auch in sowi-online.
Pandel, Hans-Jürgen (1987): Dimensionen des Geschichtsbewusstseins. Ein Versuch, seine Struktur für Empirie und Pragmatik diskutierbar zu machen. In: Geschichtsdidaktik. Jg. 12 (2). Seite 130-142. s. auch in sowi-online
Pandel, Hans-Jürgen (1997): Geschichte und politische Bildung. In: Bergmann, Klaus; Fröhlich, Klaus; Kuhn, Annette; Rüsen, Jörn; Schneider, Gerhard (Hg.) (1997): Handbuch der Geschichtsdidaktik. 5. Aufl. Seelze-Velber: Kallmeyer, Seite 319-323. s. auch in sowi-online
Pandel, Hans-Jürgen (2001): Fachübergreifendes Lernen - Artefakt oder Notwendigkeit? In: sowi-onlinejournal 2 (2001) 1. publiziert 01.07.2001. s. auch in sowi-online
Patzelt, Werner J. (1996): Ist der Souverän aufgeklärt? Die Ansichten der Deutschen über Parlament und Abgeordnete. Dresden.
Rohlfes, Joachim (1999): Geschichtsdidaktik: Geschichte, Begriff, Gegenstand. In: Geschichtsunterricht heute. Grundlagen, Probleme, Möglichkeiten. Sammelband: GWU-Beiträge der neunziger Jahre. Seelze-Velber: Kallmeyer.
Rüsen, Jörn (1996): Historische Sinnbildung durch Erzählen. Eine Argumentationsskizze zum narrativistischen Paradigma der Geschichtswissenschaft und der Geschichtsdidaktik im Blick auf nicht-narrative Faktoren. In: Internationale Schulbuchforschung , Jg. 18 (4), Seite 501-544.
Rüsen, Jörn (1998): Die Zukunft der Vergangenheit. In: Universitas. Jg. 53 (3) (Nr. 621). Seite 228-237.
Sander, Wolfgang (1997): Theorie der politischen Bildung: Geschichte, didaktische Konzeptionen, aktuelle Tendenzen und Probleme. In: Sander, (Hg.): Handbuch politische Bildung. (Politik und Bildung; 11). Schwalbach/Ts.: Wochenschau, Seite 1-47.
Sander, Wolfgang (Hg.) (1997): Handbuch politische Bildung. (Politik und Bildung; 11). Schwalbach/Ts.: Wochenschau.
Steinbach, Peter (1998): Geschichte. Vom Rückgrat politischer Bildung. In: Politische Bildung. Jg. 31 (4). Seite 112-126.
Sutor, Bernhard (1997): Historisches Lernen als Dimension politischer Bildung. In: Sander, Wolfgang (Hg.): Handbuch politische Bildung. (Politik und Bildung; 11). Schwalbach/Ts.: Wochenschau, Seite 323-337.
Jeismann, Karl-Ernst (1992): Thesen zum Verhältnis von Politik- und Geschichtsunterricht
1.
"Zur Zusammenarbeit von Geschichts- und Politikunterricht" - unter diesem Titel hat Rolf Schörken (1978) einen Sammelband herausgegeben. Sein Ziel war, die lange Diskussion über dieses Thema weiterzubringen in der Hoffnung, dass daraus eine auch in Richtlinien, Stundenplänen und Unterrichtsmaterialien fundierte Kooperation beider Fächer werden könne. Der Zeitpunkt war nicht schlecht gewählt: Die Curriculumrevision war in vollem Gange, die wissenschaftlichen und didaktischen Problemfelder der Fächer wurden neu vermessen. Das war Begleitumstand und Folge eines doch recht tiefgreifenden Prozesses der Umgestaltung der politischen Kultur einerseits, der historischen Perspektiven und Erkenntnisweisen andererseits, die seit zehn Jahren Bewegung in das politische und gesellschaftliche Selbstverständnis gebracht hatte. Lehrpläne und Unterrichtsmaterialien waren in der Öffentlichkeit und in Parlamenten zu politischen Streitpunkten geworden. Das Verhältnis von Geschichte und Gesellschaftswissenschaften, Geschichtsunterricht und politischem Unterricht war einer der Brennpunkte dieses Streites, der sich insbesondere in der Auseinandersetzung um die Hessischen Rahmenrichtlinien und die Rahmenpläne für die Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen zugespitzt hatte. Aus dieser, in den späten 70er Jahren steril werdenden und politisch instrumentalisierten Kontroverse sollte der Band herauszuführen helfen.
Schörken leitete ihn ein mit dem Satz: "Es gibt niemanden, der mit der Zusammenarbeit von Geschichts- und Politik-Unterricht (Sozialkunde), wie sie gegenwärtig an den Schulen der Bundesrepublik praktiziert wird, wirklich zufrieden ist." (Schörken 1978: 9).
Fragt man nach über einem Jahrzehnt, ob nunmehr Grund zur Zufriedenheit besteht, wird man schwerlich zu einer positiven Antwort finden. Die damals noch relativ offene Diskussion der Richtlinien ist inzwischen zur Ruhe gekommen. Auch wenn Lehrpläne immer wieder überarbeitet werden, so sind doch die curricularen Vorgaben verfestigt. Es ist nirgendwo gelungen, eine Kooperation von Geschichts- und Politikunterricht in den Richtlinien, in den Stundenplänen, in den Unterrichtsmaterialien oder durch institutionalisierte Zusammenarbeit von Geschichts- und Politiklehrern zur Regel zu machen. Vielmehr hat sich jedes Fach in seinen Bezirken eingerichtet. Dass hin und wieder ein Blick über die Grenzen geworfen wird, dass Unterrichtsmaterialien entstanden sind, die es dem engagierten Lehrer ermöglichen, eine Verbindung der Perspektiven und Lernziele beider Fächer zustande zu bringen, ist sicher richtig, kann aber nicht über das Scheitern der Ansätze einer didaktisch fundierten, im Curriculum verorteten wechselseitigen Beziehung beider Fächer hinweg täuschen (2).
Ich habe nun nicht zu sprechen über die kulturpolitischen und auch standespolitischen Hintergründe, über die schulpraktisch-organisatorischen, stundenplantechnischen Schwierigkeiten, die einer solchen Zusammenarbeit im Wege standen und stehen. Ich will vielmehr einige grundsätzliche Gedanken zum Problem der Zusammenarbeit beider Fächer äußern.
2.
Beide Fächer gehören, wie der Religionsunterricht, aus dem sie, historisch betrachtet, sich ableiten, zu jener schwierigen Fächergruppe, deren Aufgabe nicht die Vermittlung von Kulturtechniken und Fertigkeiten im spezifischen Sinne ist - wie es für die Fremdsprachen, die Mathematik, die Naturwissenschaften, die Leibeserziehung zutrifft: Fächer, die zwar auch einen &Uml;berschuss über diese Techniken enthalten, aber zunächst doch auf die operationalisierbare und evaluierbare Vermittlung von Fertigkeiten zielen. Es geht in unseren Fächern vielmehr um ein Bündel von nie eindeutig zu gebenden Antworten auf die Frage, was der Mensch und was seine Mitmenschen seien und wie sie ihr Zusammenleben gestaltet haben oder gestalten sollten - die alte Frage Walthers von der Vogelweide: "wie man zer werlte solte leben". Diese Fächer sind, weil sie dem historischen Wandel stärker unterliegen als andere, in hohem Grade selbst "historische" Fächer, Kinder ihrer Zeit; sie sind, weil sie die jeweils gegenwärtigen Bedürfnislagen und Zustände von Staat und Gesellschaft als unvermeidliche Bestimmungsfaktoren in sich tragen, auch unmittelbar politische und also umstrittene Fächer. Wie sie sich im Bildungsganzen definieren, wie sie ihren Zusammenhang untereinander und mit anderen Fächern sehen, das ist Ausdruck der gesellschaftlichen Befindlichkeit des Raumes und der Zeit, in der sie stehen.
Ich kann nicht der Versuchung nachgeben, das Verhältnis dieser beiden Fächer anhand bildungsgeschichtlicher Perspektiven in die historische Dimension zu rücken. Als Prinzipien des Unterrichts, längst ehe sie zu eigenen Fächern mit eigenen Fachlehrern wurden, waren historische und politische Bildung zeitspezifisch immer in den verschiedensten Formen vorhanden und miteinander verbunden; der Blick auf die Geschichte dieser Verbindung hätte den Vorzug, festgefahrene Positionen der Gegenwart zu verflüssigen und in ihrer Relativität zu verdeutlichen. Ich muss statt des langen Weges durch die Geschichte den kurzen Weg systematischer Bestimmung dieser Fächer wählen - ungeachtet der damit verbundenen Notwendigkeit zu grober Vereinfachung - und erst zum Schluss wieder zum Eingang zurückkehren mit der Frage, ob die Diskussion der 70er Jahre uns nicht doch emsige grundsätzliche Einsichten und pragmatische Hinweise hinterlassen hat, an die anzuknüpfen sich lohnt, wenn man der Zusammenarbeit beider Fächer wieder näher treten will.
3.
In Thesenform und scharf zugespitzt will ich das, was den Geschichtsunterricht und den Politikunterricht - wobei ich ihn nicht im engen Sinne einer Staatsbürgerkunde, sondern im modernen Sinne als Gesellschaftslehre fasse - verbindet und was sie trennt, formulieren. Dieser Versuch impliziert wissenschaftstheoretische und didaktische Entscheidungen, die wie ich denke, deutlich werden, ohne dass ich sie vorab entwickle. Drei Thesen beziehen sich auf den Gegenstand, die Bezugswissenschaften und die Lern- oder Bildungsziele beider Fächer. These 1: Geschichtsunterricht und Gesellschaftslehre haben es mit demselben Wirklichkeitsbestand, also mit demselben Gegenstand oder "Stoff" zu tun.
Dies mag überraschen und mit den Befunden in den Lehrplänen und Schulbüchern nicht übereinstimmen; darauf komme ich zurück. Gleichwohl gilt, dass grundsätzlich die Begriffe der Gesellschaft und der Geschichte voneinander nicht getrennt werden können. Die Geschichte ist der Prozess der Gesellschaft oder, wie man früher sagte, der "Menschheit"; der jeweilige Gesellschaftszustand mit all seinen verschiedenen Sektoren ist ein Augenblick im Prozess der Geschichte, der Vergangenheit und Zukunft in sich enthält.
These 2: Geschichtswissenschaft und Politikwissenschaft (Sozialwissenschaften) konstituieren sich angesichts des gemeinsamen Gegenstandes als eigene Disziplinen nicht durch ihren Stoff, sondern durch ihre Erkenntnisziele und Fragestellungen.
Die Wissenschaftsgeschichte zeigt die enge Verbindung beider Disziplinen: Der Historiker Dahlmann schrieb eine vielbeachtete "Politik" und Sozialwissenschaftler, Max Weber an herausragender Stelle trieben die historische Forschung weiter. Dennoch entstehen durch die spezifische Erkenntnisrichtung - Kant hat gesagt, es sei nicht der Gegenstand, sondern die "Idee", die eine Disziplin schaffe - spezifische Unterschiede. Man hat sie zu Beginn unseres Jahrhunderts in der Methode zu finden gesucht: die Geschichtswissenschaft gehe idiographisch, das Individuelle suchend vor, während die Sozialwissenschaften das Systematische, das Generelle und Allgemeine auf den Begriff zu bringen suchten. Jene sei hermeneutisch verstehend, diese analytisch erklärend angelegt.
Diese Unterscheidung, wenngleich immer noch durchschimmernd, ist nicht mehr spezifisch. Spezifisch hingegen ist der Unterschied zwischen dem Willen, Vergangenheit in Zustand und Prozess als solche wahrzunehmen einerseits, und dem Ziel andererseits, die gesellschaftlichen Verhältnisse, ob gegenwärtige oder vergangene, als Modelle von Vergesellschaftung in ihren theoretischen und praktischen Formen und Voraussetzungen zu begreifen, ihre Wirkungsweise auf den Begriff zu bringen und schließlich auch, in nicht nur erklärender, sondern praktischer Absicht für die Gegenwart Handlungsmaximen zu begründen - Politikberatung entweder wissenschaftlich zu fundieren oder gar selber zu sein. Geschichtswissenschaft versteht sich als Explikation des Humanen, wie es sich in der Vergangenheit zeigt, die Sozialwissenschaft ist die Explikation von Formen der Vergesellschaftung mit dem Interesse an der Erklärung der Gegenwart. In der Beschreibung der Genese der Gegenwart oder der Untersuchung von Analogien überschneiden sich beide Wissenschaften; dennoch gibt ihnen das unterschiedliche Erkenntnisziel unterschiedliche Profile. Dass dabei insbesondere die Zeitgeschichte und die Politikwissenschaft enger zusammenrücken, ist nur ein akzidentieller, kein systematischer Befund.
These 3: So wie sich die Bezugswissenschaften beider Fächer durch ihre Erkenntnisrichtungen berühren und unterscheiden, so die Fächer in der Schule durch ihre grundlegenden Lern- oder Bildungsziele.
Da im Unterricht nicht die gleiche Unendlichkeit und Freiheit der Fragestellungen und Themenwahl herrschen kann wie in der Wissenschaft, treten, erzwungen durch die Notwendigkeit scharfer didaktischer Reduktion und durch die jeweiligen Lerngruppe, einerseits die Spezifika beider Fächer schärfer hervor als in den Bezugswissenschaften; andererseits sind aber auch die Ansprüche der eng verwandten Fächer stärker, die jedes auf den Gegenstands- und auf den Bildungsbereich des anderen macht. Die bekannte Argumentationsfigur, dass die wahre und richtige politische Bildung nur durch den Geschichtsunterricht erfolgen, und die gegenteilige, dass eine relevante, zu verantwortende historische Bildung nur im Rahmen eines bestimmten Politikverständnisses erfolgen könne und von daher zu entwerfen sei, sind hinlänglich bekannt.
4.
Vor diesem Hintergrund unterscheide ich im folgenden allein für den Bereich des Unterrichts - 3. These - in scharfer Verkürzung drei gleichsam "reine Formen" des Verhältnisses von Politik- und Geschichtsunterricht. Sie sind keine willkürlichen didaktischen Setzungen, sondern erfassen didaktische Konzeptionen und Zustände im Grundsätzlichen; diese sind wiederum Ausdruck gesellschaftlicher Verfasstheit und Selbstinterpretation, die sich in der Organisation des staatlich veranstalteten Unterrichts niederschlägt. Diese historisch wechselnden Beziehungen sind im weitesten Sinne selbst ein Politikum, Gegenstand nicht nur wissenschaftstheoretischen und didaktischen, sondern vor allem politischen Streites.
Drei Grundformen des Verhältnisses beider Fächer verdeutliche ich an dem - natürlich schiefen - bildlichen Vergleich, indem ich es mir als unterschiedliches Verhältnis von Kreisen vorstelle.
4.1
Beide Fächer verhalten sich wie konzentrische Kreise. Welcher den anderen in sich enthält ist In den Konzeptionen verschiedener Zeiten unterschiedlich, im Grunde aber auch belanglos. Die jüngste Konzeption ist das in den 70er Jahren vieldiskutierte "Integrationsmodell".
Dieses Verhältnis war lange Zeit das herrschende - solange, bis sich aus der noch zaghaften Entwicklung der Staatsbürgerkunde und auf der Basis der Entwicklung der Sozialwissenschaften schließlich ein eigenes Fach herauskristallisierte, das nicht nur als "Gemeinschaftskunde" spezifische Prinzipien bündelte, sondern sich autonom verstand als politischer Unterricht, Gesellschaftslehre, Sozialkunde.
Der Geschichtsunterricht hat sich seit seiner Institutionalisierung im frühen l9. Jahrhundert immer auch als das Fach der politischen Bildung verstanden. Der Konflikt zwischen historischer und politischer Bildung wurde in den Grenzen des Faches selbst ausgetragen Ich erinnere an den Protest Oskar Jägers gegen die Versuche in der Wilhelminischen Zeit den Geschichtsunterricht politisch zu instrumentalisieren, seinen Kreis also genau in den übergeordneten Kreis politischer Bildung einzupassen: "Wenn man fragt, wie sich unser Unterricht national, nationaler, am nationalsten, deutsch, deutscher, am deutschesten gestalten lasse, so antworten wir einfach - indem man sich ... bemüht, ihn immer wahrer zu gestalten."(zit. nach Weymar 1961: 222). Jäger war kein Kritiker des nationalen Staates, war kein Gegner deutscher nationaler Bildung, aber er war ein Gegner der Subordination historischen Lernens unter politische Ziele, anders ausgedrückt, er verteidigte mit dem, was er "Wahrheit" der Historie nannte, den über die "Deutschheit" räumlich, zeitlich und sachlich hinausreichenden Bildungs- und Erkenntnisraum der Geschichte. Anders als Jäger hat der letzte bedeutende Geschichtsdidaktiker, der aus der Weimarer Zeit bis in unsere Epoche nach dem Zweiten Weltkrieg hinaus gewirkt hat, Erich Weniger, den Geschichtsunterricht in didaktischer Reduktion den Zielen der politischen Bildung untergeordnet. Das Verständnis der Entwicklung des nationalen, republikanischen Staates, der ihn erhaltenden Kräfte und die Fähigkeit, in solchem Staate Verantwortung zu tragen, galt ihm als das "Herz" des Geschichtsunterrichtes, der eine spezifische Form der politischen Bildung sei. Dass Geschichtsunterricht überhaupt sei, wird aus seiner politischen, staatsbürgerlichen Funktion legitimiert (3). Auf ganz andere Weise haben die rudimentären Ansätze einer Neuordnung des Geschichtsunterrichts im Nationalsozialismus und die elaborierten geschichtsmethodischen Instrumente in den kommunistischen Staaten, besonders konsequent in der DDR, den Geschichtsunterricht als politischen Unterricht verstanden - in dem weiten Sinne freilich, dass man auch umgekehrt den politischen Unterricht - Marxismus-Leninismus oder Staatsbürgerkunde - als weltgeschichtlich historischen Unterricht hätte bezeichnen können. Das war möglich durch die Grundannahme des Histomat, die als wissenschaftliche Wahrheit verstandene Geschichtsphilosophie (4).
Die konzentrische Kreisform des Verhältnisses beider Fächer deutet auf ein politisches und historisches Bewusstsein hin, das sich des Sinnes und Zieles der Universalgeschichte oder begrenzterer Sinngebungen, etwa der nationalen Geschichte, gewiss ist und diese Gewissheiten nicht befragen lässt, sondern als historisch evident setzt. Formal macht es dabei keinen Unterschied, ob die politische Bildung, welche den Geschichtsunterricht in ihren Dienst nimmt, auf den dynastisch-monarchischen Staat, die nationale Republik, die "Volksgemeinschaft", die klassenlose Gesellschaft hinzielt: Immer ist es das Ziel politischer wie historischer Bildung, den Heranwachsenden zu befähigen, in &Uml;berzeugung und Handlungsbereitschaft sich in den Dienst dieser historisch-politisch als fraglos richtig verstandenen Zielvorgabe zu stellen.
An dieser Stelle des Gedankens wird man sich die schwierige Frage vorlegen müssen, ob ein solches Verhältnis der Fächer mit seinen Auswirkungen auf die Wahl des Gegenstands, auf Deutung und Werturteil zu verurteilen oder zu rechtfertigen ist, je nachdem, ob die Überzeugung vom Geschichtsverlauf und von der zu erhaltenden oder zu erreichenden politisch-gesellschaftlichen Ordnung richtig oder falsch, besser: erwünscht oder unerwünscht ist. Wir kämen bei einer solchen Behauptung in eine heikle Situation, sobald unser als richtig verstandenes Ziel politischer Bildung möglicherweise durch den Verlauf der Geschichte selbst Korrekturen erfährt. In der deutschen Geschichte dieses Jahrhunderts ist dies bislang dreimal der Fall gewesen, aber in der Diskussion des Verhältnisses von Geschichts- und Politikunterricht spielt die Figur der konzentrischen Kreise bis in unsere Tage weiterhin eine bedeutende Rolle, indem die Sinn- und Zielrichtungen der Geschichte zugleich mit den Normen richtiger politischer Ordnung neu definiert werden.
So hat Hermann Giesecke in einer lesenswerten Fortführung und Erweiterung der Konzeption von Erich Weniger den Geschichtsunterricht politisch begründet, indem er den noch formalen, republikanischen Staatsbegriff Wenigers erweiterte zum Begriff einer demokratisch verfassten Gesellschaft - nicht etwa wie sie existiert sondern wie sie werden soll (Giesecke 1978). Die Geschichte wird für die Geburt der besseren, der wahrhaft demokratischen Welt zu Hilfe gerufen als Nachweis dafür, dass nichts so bleibt, wie es ist, dass die Welt veränderbar ist, die Zukunft die bessere Alternative zur Vergangenheit sein müsse. Dahinter steht ein Totalentwurf der menschlichen Gesellschaft, wie sie sein soll; daher ist nach Giesecke ohne den Bezug auf die "Kritische Theorie" eine Begründung und Legitimierung des Geschichtsunterrichtes nicht möglich. Bei Annette Kuhn erscheint dann die Geschichte in gleicher Tendenz als eine Kette von Defiziten, aus der die Versuche erinnerungswürdig sind, sie zu überwinden (Kuhn 1974: 15f.) - das ist eine alte Denkfigur, viel klarer als bei den Modernen, aber auch viel vorsichtiger schon dargestellt in Kants Skizze zur Idee einer Universalgeschichte in weltbürgerlicher Absicht (Kant 1968).
Diese Rechtfertigungen historischen Lernens aus emanzipatorisch politischer Zielsetzung sind nur dem Vorzeichen, nicht der Struktur nach unterschieden von jenen, welche die Geschichte als Tradition beschwören, nicht zur Emanzipation, sondern zur Identitätsbildung aufrufen, entweder, um die gegenwärtigen Zustände als gewordene zu rechtfertigen, oder aber, um sie angesichts besserer Vergangenheit zu kritisieren und zur Rückkehr aufzufordern. Ein Musterbeispiel für die "emanzipatorische" Konstruktion des Verhältnisses der beiden Fächer des konzentrischen Kreises waren die Hessischen Rahmenrichtlinien für Gesellschaftslehre (1972). Der letzte gegenläufige, affirmativ-konservative Versuch, politische Bildung durch Geschichte unmittelbar zu legitimieren und Geschichte als Beweis des Existenzrechts gegenwärtiger Ordnung zu nehmen, waren die kräftigen - keineswegs aber durchschlagenden - Initiativen einer monarchisch-nationalistischen historisch-politischen Didaktik (5).
Diese Konzepte, mehr oder weniger stringent, mehr oder weniger dogmatisch angelegt, wurzeln in einer Geschichtsgewissheit - begründet in Tradition oder durch Utopie - und im Glauben an die Normativität einer Gesellschaftsvorstellung. Indem sie das historische Lernen darauf ausrichten und in Selektion der Thematik wie der Wertungen allein in diese Perspektive einstellen, verzichten sie darauf, das kritische Potential an der eigenen Interpretation zu mobilisieren, welches die Geschichte bereithält, und fixieren den Schüler auf eine bestimmte historische Lehre. Das ist im Sinne der Traditionalisten politisch verständlich, ganz unverständlich aber in der Denkweise derer, die Emanzipation als Sinn der Geschichte propagieren, jedoch die historischen Formen von Emanzipation selbst der Kritik entziehen. Das zeigt sich z.B. in den didaktischen Entwürfen dieser Art am undifferenzierten, unreflektierten Gebrauch des Begriffs der "Demokratie". Er erscheint als nicht mehr hinterfragbarer Legitimationsbegriff und wird abstrakt (6). Die Vergangenheit wird mediatisiert angesichts des Zukunftsentwurfs. Die ambivalente Geschichte dessen, was alles mit dem Demokratiebegriff sich rechtfertigte, verschwindet. Im Extremfall führt das zum Wirklichkeitsverlust und damit nicht nur zur Verkürzung der historischen, sondern auch zur Untauglichkeit der politischen Bildung. So läuft die Betrachtung des konzentrischen Verhältnisses beider Fächer auf die Frage zu, wie es zu verhindern ist, dass historisches Lernen zur bloßen Bestätigung politischer Doktrin und damit zur Verfälschung von Geschichte missrät - und umgekehrt.
4.2
Während man über die in konzentrischen Kreisen zu veranschaulichende Struktur an vielen Beispielen noch lange diskutieren könnte, ist die nächste Figur relativ kurz abzutun: Die nebeneinander stehenden, voneinander isolierten Kreise. Das wäre eine politische Bildung, die den Bezug zur Geschichte, zur Veränderbarkeit der Welt verloren hat und nur noch auf das Funktionieren in gegebenen Systemen abzielt. Eine Art kybernetische Didaktik, die Denken, Urteilen und Verhalten nach der systemimmanenten Rationalität einübt. Herwig Blankertz (1974: 51ff.) hat das beschrieben, und ich gehe hier nicht weiter auf solche Entwürfe ein. Die Entsprechung beim historischen Lernen wäre die Präsentation einer Geschichte, die mit der Gegenwart nichts zu tun haben will, Gegenwartsbezüge als Verformung der historischen Wahrheit ablehnt in der Ansicht, nur auf solche Weise Parteilichkeit und Verzerrung der Geschichte vermeiden zu können. Es gibt solchen gegenwartsabstinenten Positivismus nach großen historischen Enttäuschungen oder Zusammenbrüchen als eine Art Flucht in die Geschichte; aber im Grunde erliegt eine solche Konzeption der bekannten Selbsttäuschung, die ihre geheimen steuernden und sehr gegenwärtigen Antriebe nicht erkennt oder nicht wahrhaben will.
Theoretisch ist über diese Modell nicht viel zu diskutieren. Aber praktisch kann es sich sehr wohl einstellen, wenn sich die Vertreter des Politikunterrichts und des Geschichtsunterrichts, genervt durch jahrelange Auseinandersetzungen oder durch Lehrplan- und Stundentafeln getrennt, auf ihre Bastionen zurückziehen, wenn im Schulalltag kein fachliches Gespräch zwischen beiden zustande kommt, wenn die Lehrpläne nur ein isoliertes Nebeneinander vorsehen und wenn nicht die Lehrer selbst je für sich diese Schwächen durch einen Geschichts- oder Politikunterricht vermeiden, der die Gegenwartsdimension der Geschichte und den Prozesscharakter des Politischen berücksichtigt.
Durchdenkt man dieses Modell nicht bis in seine Konsequenzen, sondern sieht es pragmatisch, kann natürlich eine Menge an für die politische Bildung wichtigem Wissen und auch an nützlichen Verhaltensformen für die Gegenwart herauskommen, kann das Bildungspotential der Geschichte jenseits von politischer Bildung entfaltet werden, kann anschauende Kontemplation, Empathie, kann Staunen geweckt werden. Die Frage ist jedoch, ob dies dem Auftrag der öffentlichen Erziehung entspricht und ob es den Bildungsbedürfnissen der Jugendlichen angemessen ist, wenn der Politikunterricht absieht vom vergangenen Prozess und also auch von der kommenden Geschichte, von der Zukunft, der Geschichtsunterricht aber Menschen in einem Alter, das nach Selbstfindung, nach Deutung der gegenwärtigen Welt strebt, in ein Panoptikum führt, das der alte Mensch vielleicht einordnen kann in Lebenserfahrung und Bildungswissen, um, wie der späte Burckhardt, "weise für immer" zu sein, das dem jungen Menschen aber als belanglos, ohne Beziehung zu seiner eigenen Welt erscheinen wird.
4.3
Das dritte Modell lässt sich durch die Figur der sich überschneidenden Kreise veranschaulichen. Geschichtsunterricht und Politikunterricht sind in ihren Lernzielen und in ihren Bildungsperspektiven nicht identisch, aber aufeinander verwiesen. Sie haben ein Gebiet gemeinsamer Gegenstände, Methoden und Ziele sowie gemeinsamer Rückgriffe auf die Bezugswissenschaften. Diesen &Uml;berschneidungsbereich als das eigentliche Feld ihrer Zusammenarbeit gilt es zu bestimmen und von dem jeweils eigenen, geschichts- oder politikspezifischen Feld zu unterscheiden.
Obgleich immer wieder von den Prinzipien politischer Bildung im Geschichtsunterricht hier, von der historischen Perspektive im Politikunterricht dort gehandelt wurde, fehlt es an einer generellen Bestimmung des &Uml;berschneidungsbereiches beider noch weithin. Mit dem Hinweis auf den gemeinsamen Stoff, den die Zeitgeschichte liefert, ist zwar Richtiges, aber durchaus Vorläufiges über die Schwierigkeiten beider Fächer gesagt. Eine Annäherung an die Bestimmung der Gemeinsamkeiten lässt sich vielleicht am besten durch den Versuch erreichen, das Unterschiedliche zu benennen.
Historisches und politisches Lernen zielen gleichermaßen auf den Erwerb von Kompetenzen, sich in Gegenwart und Zukunft unserer Welt zuverlässig zu orientieren und verantwortlich zu verhalten. Aber in verschiedener Weise. Wie in den Bezugswissenschaften des politischen Unterrichts das Erkenntnisinteresse auf die gegenwärtige Gesellschaft zielt, sie zu erklären und ihren praktischen Handlungsbedarf zu ermitteln sucht, so geht es der poetischen Bildung um Erkenntnis der Grundstrukturen dieser Gegenwart und die Vermittlung der Fähigkeit, sich in ihnen angemessen zu orientieren und zu verhalten. Dem widerspricht nicht, dazu gehört vielmehr, dass Erkenntnis der Gegenwart angewiesen ist auf das Wissen und die Erfahrung des Gewordenseins und der Veränderlichkeit der gegenwärtigen Gesellschaft. Mit dieser historischen Perspektive wird nicht die Geschichte selbst zum Ziel der Erkenntnis. Greifen die Sozialwissenschaften in die Vergangenheit zurück, tun sie es, um entweder die Genese der Gegenwart oder, durch historischen Vergleich, ihre Strukturen deutlicher zu erfassen; so auch die politische Bildung, welche bestimmte, dazu dienliche geschichtliche Zustände oder Prozesse in Kontrast oder Ähnlichkeit oder in Betrachtung von Ursache und Wirkung, also als Vorgeschichte der Gegenwart zu deren Erklärung heranzieht. Historisches hat in dieser Perspektive keinen Eigenwert, sondern bleibt notwendig (und bisweilen problematisch) in einer Hilfsfunktion. &Uml;ber diese historischen Verständnishilfen hinaus gibt es für die politische Bildung angesichts der komplizierten gesellschaftlichen Verhältnisse einen so ausgeweiteten Kenntnis- und Einsichtbedarf, den der Geschichtsunterricht bei noch so intensivem Gegenwartsbezug nicht befriedigen könnte, dass schon allein deshalb der politischen Bildung ein breiter Raum eigener Kenntnis- und Einsichtsvermittlung verbleibt (7).
Noch wichtiger für die Begründung der Selbständigkeit politischen Unterrichts: Seine Bildungsziele umfassen den kognitiven Bereich, greifen aber darüber hinaus in den affektiven und instrumentalen Lernzielraum: politische Bildung erfährt ihre Vollendung nicht in der Kenntnis und Einsicht, sondern im politischen und sozialen Verhalten, das aus Einsicht und Engagement zugleich erwächst. Insofern ist der politische Unterricht handlungsorientiert. Hier entsteht nun sein ureigenstes Problem: In einer Gesellschaft hochgradiger Komplexität, in der nur noch Experten einen kleinen Bereich politischen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen Lebens zu durchschauen und zu beurteilen vermögen, gilt dennoch das Postulat universaler Partizipation, der Anspruch eines jeden - und an einen jeden -, mindestens über alles Grundsätzliche mitzubestimmen und auf den verschiedensten Wegen an Entscheidungsfindungen teilnehmen zu können, deren Auswirkungen er - häufig nicht einmal auf seine eigenen Interessen bezogen - kaum kalkulieren kann. In dieser Situation die Balance zwischen Kompetenz und Teilhabe zu gewinnen, ist die wichtigste und schwierigste Aufgabe politischer Bildung - der Geschichtsunterricht wird hier bestenfalls mittelbar helfen können.
Politischer Unterricht überschneidet sich - wie gesagt - mit dem Lernzielraum des Geschichtsunterrichts im genetischen oder vergleichenden Rückgriff auf die Geschichte. Der Geschichtsunterricht aber kann sich nicht im Aufweiß von Genese oder Analogie erschöpfen - kann nicht die "Gegenwart" allein zum Maß für die Wahrnehmung der Vergangenheit machen. Er richtet die Aufmerksamkeit darüber hinaus auf die Eigenart der Vergangenheit selbst, die durch ihre gegenwartsbestimmenden Erscheinungen nicht ausdefiniert ist, sondern immer einen &Uml;berschuss an Andersartigem, Fremdem enthält. Er kann uns als abgetan vorkommen und wird von den Fragerichtungen und Erkenntniszielen, auch von den Verhaltensnormen, die der Politikunterricht anstrebt, nicht erfasst, gehört aber zu den wesentlichen Elementen historischer Bildung. Geschichte ist nicht Echo der Gegenwart, sondern Frage, Kommentar, Widerspruch. Als Analogon und durch die Erhellung der Genese der Gegenwart leistet historische Bildung einen Beitrag zur politischen Bildung des Bürgers; als Bemühung um Erkenntnis der Fremdheit, der Andersartigkeit, der besonderen Existenz von Mensch und Gesellschaft, die ganz unabhängig von ihrer Gegenwartsbedeutung von Belang ist, bestimmt er seinen eigenen Lernzielbereich für eine Bildung des Menschen. Auf diesem "immediaten" Zugang zur Vergangenheit muss der Geschichtsunterricht schon deshalb bestehen, weil man nie weiß, welche Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft relevant werden wird - das führt uns heute die geschehende Geschichte in Ost- und Südosteuropa vor Augen.
Stärker als durch verborgene Kontinuitäten lässt sich die Eigenbedeutung der Vergangenheit durch unmittelbare humane Relevanz begründen: Gerade Anschauung und Verständnis der zeitlich, politisch, kulturell fremden, unvertrauten, ganz eigenartigen Lebens- und Denkweisen kann Solidarität mit der "Menschheit", ihren Leistungen und ihrem Leiden anbahnen, auch wenn uns beides nicht direkt und real betrifft. Der Geschichtsunterricht bietet damit ein Gegengewicht zum Gegenwartsbezug und zum Selbstbezug - beide haben ja neben ihren pädagogischen Vorzügen auch die Nachteile der Befangenheit. Deshalb wird der Geschichtsunterricht, so wenig er vor der genetischen Erklärung der Gegenwart oder dem Vergleich von Gegenwart und Vergangenheit zurückscheut, immer wieder auch Distanz zur Gegenwart schaffen müssen.
Mit dieser erkenntniserweiternden Distanz bringt er in die politische Bildung einen Reflexionswiderstand ein, der zur Vorsicht und Abwägung bei Urteilen mahnt und den schnellen direkten Handlungsimpuls bremst, den Drang zum Aktionismus zügelt. Dass politisch in der Gegenwart ohne letzte Sicherheit gehandelt werden muss, bleibt davon unberührt - aber es sollte im Wissen um diese letzte Unsicherheit gehandelt werden. Der "Machthaber" muss sich nicht auch als "Rechthaber", gar als alleiniger, fühlen dürfen, und die Bürger sollten aus historischer Kenntnis und Bildung so auftretenden Politikern nicht als den charismatischen Führern folgen, sondern sie mit Skepsis beurteilen können - auch das ist eine handlungsorientierte Zielvorstellung, in der sich Lernziele des Geschichtsunterrichts gerade wegen ihrer Distanz vom unmittelbaren Gegenwartsbezug wieder mit denen des politischen Unterrichts treffen.
Positiv kann man diese Reflexionshürde, die historische Bildung vor politisches Handeln setzt, als "Besonnenheit" bezeichnen. Kern dieser Besonnenheit ist das durch Vergegenwärtigung geschichtlicher Abläufe, Ursachen und Wirkungen gewonnene Wissen um die Ambivalenz und die Kontingenz politischer Programme und Maßnahmen, Planungen und Wirkungen, um die Bedeutung der ungewollten Nebenfolgen und letztlich um die Ungewissheit und also um die ständige Korrekturbedürftigkeit politischen Verhaltens und Handelns.Das ist kein Plädoyer für einen historisch legitimierten Quietismus. Historisches Lernen steht politischem Wollen und Handeln nicht im Wege. Die kognitiven und zugleich "empathischen", den Horizont des Verständnisses über die offensichtlichen Gegenwartsbelange hinaus weitenden Lernziele des Geschichtsunterrichts fügen der Handlungsorientiertheit, die aus politischem Willen, aus Interesse und Vision, aus Einsicht und Moral sich speist, den Verweis auf sekundäre Erfahrung hinzu. Sie kann zugleich Vorsicht und Entschiedenheit bewirken, vor allem aber &Uml;berhebung und falsche Selbstgewissheit verhindern.
Wie die schwierigste Aufgabe des politischen Unterrichts darin besteht, die Spannung zwischen allgemeinem Partizipationsanspruch und hochkomplexer Realität durch politische Bildung verantwortbar zu vermitteln, so die des Geschichtsunterrichts, die Unendlichkeit und Vielfalt historischer Anschauung zu historischer Bildung zusammenzufügen. Beliebigkeit des historischen Wissens, Blindheit des historischen Gefühls, des "Geschichtsbegehrens", ebenso zu vermeiden wie anmaßende Geschichtsgewissheit. Der Versuch, das Lernzielspektrum dieses Faches durch den Leitbegriff des "Geschichtsbewusstseins" zu bündeln und durch die Ausfächerung der dadurch bezeichneten Leistungen zu konkretisieren, steht im Dienst dieses Bemühens, das sich schon lohnt, wenn es nur annäherungsweise sein Ziel erreicht (8).
Dieser Ansatz braucht hier nicht entfaltet zu werden; er gehört zu den ausführlich diskutierten Themen der Geschichtsdidaktik. Im Hinblick auf die indirekte Bedeutung für die politische Bildung soll nur auf den Gegenwartsverständnis und Vergangenheitsdeutung verbindenden Bereich der historischen Wertungen verwiesen werden, die in der Regel in unmittelbarem Zusammenhang mit politischen Positionen der Gegenwart stehen. Alle Legitimierungen politischen Handelns oder politischer Zustände durch historische Bezüge lehrt ein so verstandener Geschichtsunterricht durch die Kritik des historischen Sachurteils und der Zeitanalyse zu schicken, auf ihre Stichhaltigkeit zu befragen, zu differenzieren und damit zuverlässiger zu machen oder als Agitationsfigur abzutun. Dass mit solcher Leistung kontroverse politische Positionen der Verhärtung entzogen und in ein diskursives Verhältnis zueinander gesetzt werden können, ließe sich am Beispiel der internationalen Schulbuchforschung nachdrücklich zeigen.
Der Gedankengang hat uns über den Versuch, den je eigenen Bereich des politischen und historischen Unterrichts zu umreißen, unversehens zu der Einsicht geführt, dass gerade bei Anerkennung der Eigenständigkeit des historischen Bildungsinteresses - neben den direkten Zusammenhängen beider Fächer, also dem Schnittmengenbereich - ein mittelbarer, indirekter Einfluss historischer auf politische Bildung sich ergibt - und zwar gerade dadurch, dass man die eine nicht von der anderen ableitet und beide in konzentrischen Kreisen integriert. Das lässt sich in Umkehrung der Betrachtung auch auf die indirekte Bedeutung eines seine eigenen Ziele entwickelnden politischen Unterrichts für die historische Bildung zeigen. Zur Erklärung und zum Verständnis historischer Zustände, Prozesse, Verhaltensweisen sind die Instrumente der politischen Wissenschaft und der Sozialwissenschaft für den Historiker unerlässlich und anwendbar auch auf vergangene gesellschaftliche, politische und kulturelle Formationen geworden. Der Beitrag der Sozialwissenschaften für die Geschichte als Wissenschaft, aber auch für die Geschichte als Unterricht braucht heute nicht mehr dargetan zu werden; dies ist eine unmittelbare Ergänzung und Hilfestellung, die der politische Unterricht dem Geschichtsunterricht geben kann und sollte. Indem er aber die Gegenwart selbst für Erkenntnis und Verhalten zum Bezugspunkt seiner Ziele macht, stellt er die der Geschichtsbetrachtung immer innewohnende Perspektive der Gegenwartserklärung und der Gegenwartsbezogenheit auch unmittelbar unter einen reflektierten Erkenntniszwang angesichts der nicht mehr unverstanden hingenommenen Gegenwart. Den einer bloß historisch ansetzenden Erklärung der Gegenwart innewohnenden Gefahren der vorschnellen Identifikation und Traditionsbildung, sei es konservativer, sei es progressiver Art, setzt der politische Unterricht durch Erhellung der Komplexität der Gegenwart ein kritisches Fragezeichen an die Seite, indem er seinen eigenen Lernzielen folgt. Wird also der Geschichtsunterricht z.B. jener Legitimierung der Gegenwart aus einem zu pauschalen Begriff der "Demokratie", wie ich ihn eben zitierte, mittels der historischen Erfahrung von der Widersprüchlichkeit dieser Erscheinung dem politischen Urteil Distanz und Besonnenheit geben, so wird der Politikunterricht durch Vergegenwärtigung der komplexen Strukturen unseres demokratischen Systems einer vorschnellen Traditionsbildung und damit falschen Identitätsstiftung, welche etwa von der athenischen Demokratie über die Kommunen des Mittelalters, die ständischen Freiheiten der Magna Charta bis zur Oligarchie des englischen Parlamentarismus im 19. Jahrhundert eine scheinbar historisch schlüssige teleologische Linie zu ziehen geneigt ist, widersprechen müssen und die Eigenart der Gegenwart gegenüber einem falsch verstandenen historischen Traditionsanspruch zu behaupten haben (9).
Ich belasse es bei diesen Andeutungen. Es genügt, wenn daraus die Notwendigkeit hervorgeht, dieses Modell der sich überschneidenden Kreise genauer und am konkreten Fall zu durchdenken und für die Unterrichtsplanung in Richtlinien und Materialien fruchtbar zu machen. Dass dies nur in Zusammenarbeit von Vertretern beider Fächer geschehen kann, liegt auf der Hand.
5.
Ich will zum Schluss mit einigen Hinweisen auf den Beginn zurückkommen: Ist von den Bemühungen der 70erJahre gar nichts geblieben? Haben sich beide Fächer in ihren Stellungen verschanzt? Sind getrennte Lehrplangleise gezogen, die es nicht zulassen, dass die Zusammenarbeit zwischen Geschichtsunterricht und Politikunterricht nicht nur didaktisch und theoretisch begründet, sondern auch im Unterricht praktiziert werden kann?
Folgendes ist geblieben:
- Eine gründliche Diskussion von den verschiedensten Positionen her liegt bereit, ein Material, auf das man zurückgreifen muss, wenn man Zusammenarbeit von Geschichts- und Politikunterricht plant. Ich sehe dabei als wichtigste, bisher noch nirgends klar herausgearbeitete Erkenntnis, dass nicht "der" Politikunterricht und nicht "der" Geschichtsunterricht, sondern dass in beiden Fächern die unterschiedlichsten Konzeptionen das gegenseitige Verhältnis bestimmen. Ich habe indirekt durch die Illustration mit Hilfe der Kreise gesagt, welche Konzeptionen von Politik- und Geschichtsunterricht ich für untauglich halte für eine Zusammenarbeit, nämlich die isolationistischen einerseits und die holistischen andererseits. Immer wieder verweise ich in diesem Zusammenhang auf den Aufsatz von Dahrendorf (1964) "Ungewissheit, Wissenschaft und Demokratie", in dem politische Institutionen, wissenschaftliche Erkenntnisweisen und damit auch intentionale, öffentliche Lehre mit Wissen um die Begrenztheit und legitime Widersprüchlichkeit menschlicher Erkenntnis in ein Verhältnis gesetzt werden, das der wechselseitigen Begrenzung und Infragestellung bedarf, um der Dogmatisierung des Irrtums vorzubeugen.
- Neben diesem in den 70er und den frühen 80er Jahren produzierten Reflexionspotential bleiben uns auch eine Reihe praktischer und verwendbarer Materialien, auf die zurückgegriffen werden kann, die aber auch weiterzuentwickeln sind und im Alltag des Unterrichts brauchbar bleiben. Ich verweise auf die Vielzahl von Unterrichtseinheiten zum politischen und zum historischen Unterricht, die ein breites &Uml;berschneidungsspektrum aufweisen, auf die selbst in die Richtlinien eingegangenen nützlichen Hinweise zu Gemeinsamkeiten der Lernziele. Freilich bedarf es einiger Anstrengung des Lehrers, sich dieses Material zu eigen zu machen und es im Unterricht einzusetzen.
- Am wenigsten zufriedenstellend fällt die Erbschaft der 70er und 80er Jahre im Hinblick auf die Richtlinien aus. Nachdem für die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II der gleichsam imperialistische Zugriff der Gesellschaftslehre auf den Geschichtsunterricht scheiterte, entstand im breiten Feld bundesrepublikanischer Lehrpläne als Hauptlinie eben nicht eine durchdachte, in den Richtlinien vorgezeichnete Zusammenarbeit, sondern eine jeweils besondere Lehrplanspur der Fächer. Ich schwanke in meinem Urteil, ob dies eher schädlich oder eher nützlich ist. Nützlich insofern, als es problematisch ist, eine Zusammenarbeit in Amtsblättern mit Rechtskraft festzuschreiben, die didaktisch und methodisch nicht fundiert ist; schädlich insofern, als es von jeder Zusammenarbeit überhaupt abzusehen erlaubt.
Ich möchte zum Schluss eine Empfehlung geben, von der ich allerdings weiß, dass sie dem administrativen Perfektionsdrang ebenso wie dem curricularen Systemzwang widerspricht, der sich in der Erarbeitung der jetzt geltenden Richtlinien in so starker Weise niedergeschlagen hat und in den Neubearbeitungen, soweit ich sehe, sich wiederum zeigt - vielleicht haben die neuen Bundesländer in ihrer plastischen Situation die Chance, nicht nur die neueren Industrieanlagen, sondern auch besser koordinierte Richtlinien zu entwickeln. Richtlinien oder ministerielle Anweisungen sollten die Geschichtslehrer und die Lehrer des politischen Unterrichts an den Schulen auffordern, in Zusammenarbeit nach dem Prinzip der Anstaltslehrpläne für jede Klassenstufe Sequenzen zu entwickeln, die Geschichtsunterricht und politischen Unterricht an bestimmten Gegenständen und mit ausgewiesenen Lernzielen zusammenführen. Sie sollten Freiraum für solche Versuche lassen - und zwar in echter Form (10). Die Ministerien sollten Gelegenheit geben, wie es früher bei der Einführung neuer Lehrpläne üblich war, auf Fachtagungen den Austausch von Erfahrungen und Vorschlägen zwischen den verschiedenen Schulen zu ermöglichen. Die Aufsicht der Schulbehörde könnte sich auf die Kenntnisnahme und Approbation, gegebenenfalls Diskussion solcher Unterrichtssequenzen durchaus beschränken, zugleich aber fordern, dass sie umgesetzt und in Erfahrungsberichten zur Diskussion gestellt werden. Dies wäre ein Weg, die Zusammenarbeit von Politik- und Geschichtsunterricht, da sie sich didaktisch und administrativ mit Aussicht auf ihr Gelingen nicht von oben verordnen lässt, von unten in Gang zu setzen.
Anmerkungen
(1) Der Text lag einem Vortrag in Bad Harzburg am 30. November 1991 zugrunde. In den Anmerkungen gebe ich nur Nachweise oder Hinweise auf unmittelbar genannte oder berührte Literatur. Die wissenschaftstheoretische und didaktische Literatur zum Verhältnis von Geschichte und Politik in Wissenschaft und Unterricht ist kaum noch zu überblicken.
(2) Einen solchen Versuch hatte eine Herausgebergruppe gemacht. s. Behrmann, G. C. u.a. (1976) Geschichte und Politik. Didaktische Grundlegung eines kooperativen Unterrichts. Paderborn. und dies. (Hrsg.) (1976ff.) Geschichte/Politik. Unterrichtseinheiten für ein Curriculum. Paderborn. Die einzelnen Unterrichtseinheiten fanden weithin Anklang; die Gesamtkonzeption eines kooperativen Curriculums konnte sich nicht durchsetzen.
(3) Siehe Weniger, Erich (1949) Neue Wege im Geschichtsunterricht. Frankfurt/M. dazu Quandt, Siegfried (Hrsg.) (1978): Deutsche Geschichtsdidaktiker des 19. und 20. Jahrhunderts. Wege, Konzeptionen, Wirkungen. Paderborn. darin ders.: Weniger, Erich (1894-1961), S. 327-364; Weniger, Erich (1989) Erziehung, Politik, Geschichte. Politik, Gesellschaft, Erziehung in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik. Ausg. und komm. von Gaßen, Helmut. Bd.4. Weinheim, Basel.
(4) Auf die ausgedehnte Diskussion zum Verhältnis von Theorie und Praxis, das aus der marxistischen Geschichtsteleologie folgt, kann hier nicht im einzelnen verwiesen werden. Zu ihrem methodischen Niederschlag auf den Geschichtsunterricht s. die jüngeren Titel der DDR-Literatur in knapper Auswahl bei Schmid, Hans Dieter (1979) Geschichtsunterricht in der DDR, Stuttgart. und Jeismann, Karl-Ernst; Kosthorst, Erich (1956) Deutschlandbild und Deutsche Frage in den geschichtlichen Unterrichtswerken der Deutschen Demokratischen Republik. In: Wolfgang Jacobmeyer (Hrsg.) (1956): Deutschlandbild und Deutsche Frage in den historischen, geographischen und sozialwissenschaftlichen Unterrichtswerken der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik von 1949 bis in die 80cr Jahre. Braunschweig. (Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Bd. 43); ferner Gies, Horst (1989) Geschichtsbewusstsein und Geschichtsunterricht in der Deutschen Demokratischen Republik. In: GWU 40 (1989), S. 618-625; die marxistische Position während der letzten Jahrzehnte in der Bundesrepublik bei Jung, Ernst (Hrsg.): Marxismus im historisch-politischen Unterricht. Stuttgart 1979 (Anmerkungen und Argumente zur historischen und politischen Bildung, 24).
(5) Siehe Schneider, Gerhard (1988): Geschichtsdidaktik und Geschichtsunterricht am Ende des Kaiserreichs (vorwiegend in Preußen). In: Geschichtsunterricht und Geschichtsdidaktik vom Kaiserreich bis zur Gegenwart. Festschrift des Verbandes der Geschichtslehrer Deutschlands zum 75jährigen Bestehen. Stuttgart, 54-67. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Geschichtswissenschaft und Geschichtsunterricht Tendenzen, Urteile und Wertungen in der Geschichte übergeschichtlich - aber säkular - zu fundieren. Am bekanntesten die Schlusswendung Friedrich Meineckes(1948) in "Die deutsche Katastrophe", S. 168; s. auch Wilmanns, Ernst (1950) Geschichtsunterricht, Weltanschauung und Christentum. In: GWU 1, 1989, S. 65-80; und ders.: Geschichtsunterricht. Grundlegung seiner Methodik. Stuttgart 1949. Ein &Uml;berblick über diese Problematik bei Jeismann, Karl-Ernst (1989) Der Geschichtslehrer im Spannungsfeld von Politik, Erziehung und Wissenschaft. In: GWU 40 (1989), S. 515-533.
(6) Die immer wieder zu lesende Beschwörung eines "demokratischen Geschichtsunterrichts" ist bestenfalls eine Verkürzung dessen, was legitimerweise allein gemeint ist: Geschichtsunterricht in einem demokratischen, und zwar parlamentarisch-liberal verfassten demokratischen Rechts- und Sozialstaat. Sonst wäre "demokratischer" Geschichtsunterricht nichts anderes als dynastische (hohenzollernsche oder wittelsbach'sche), nationale ("deutsche"), nationalsozialistische, sozialistische usw. Indoktrinierung mit historischem Anschauungs- und Argumentationsmaterial. "Demokratisch" kann in diesem Zusammenhang nicht den Inhalt und die Urteile meinen, sondern allein das Verfahren der Urteilsbildung und Wertung, das sich auf Nachweis, Argument und Diskussion stützen und dogmatische, Herrschaft beanspruchende Auslegung nicht gelten lässt. Zum Begriff "Demokratie" und seinen Objektivationen in der Geschichte s. Meier, Christian; Reimann, Hans Leo; Maier, Hans; Koselleck, Reinhart; Conze, Werner (1972) Demokratie. In: Brunner, Otto; Conze, Werner; Koselleck, Reinhart (Hrsg.) (1972) Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 1. Stuttgart, 821-899. Zur aktuellen Problematik s. die differenzierte Diskussion in der Historischen Kommission der SPD bei Miller, Susanne (Hrsg.) (1985) Geschichte in der demokratischen Gesellschaft. Düsseldorf.
(7) Er ist in der didaktischen Grundliteratur zur politischen Bildung ebenso umschrieben wie in einer Vielzahl von Unterrichtsmodellen konkretisiert und braucht hier nicht näher bezeichnet zu werden. Schon 1971 zählte eine Bibliographie (Politische Bildung. Eine Bücherkunde. Hrsg. v.d. Landeszentrale für politische Bildung. Nordrhein-Westfalen, 4. Aufl. Bonn - Bad Godesberg 1971) 177 einschlägige Titel auf. Ich verweise nur auf einige grundlegende und die Formierungsphase des Politikunterrichts prägende Werke: Giesecke, Hermann (1972 ) Didaktik der politischen Bildung. Neue Ausgabe. München; Sutor, Bernhard (1971) Didaktik des politischen Unterrichts. Eine Theorie der politischen Bildung. 2. Aufl. Paderborn; Hilligen, Wolfgang (1985) Zur Didaktik des politischen Unterrichts. 4. Aufl. Opladen; Behrmann, Günther C.(1972) Soziales System und politische Sozialisation. Eine Kritik der politischen Pädagogik. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz; Schörken, Rolf (Hrsg.) (1974) Curriculum "Politik". Von der Curriculumtheorie zur Unterrichtspraxis. Opladen.
(8) Siehe dazu die Beiträge in Schneider, Gerhard u.a. (Hrsg.) (1988) Geschichte und Geschichtsbewusstsein. Jahrbuch der Geschichtsdidaktik 1. Pfaffenweiler. Die grundlegenderen neueren geschichtsdidaktischen Veröffentlichungen erschienen als Antworten auf die Herausforderungen durch die neuen Ansätze im politischen Unterricht (s. Anm. 7); Süssmuth, Hans (Hrsg.) (1972) Geschichtsunterricht ohne Zukunft- 2 Bde., Stuttgart. eröffnete, noch deutlich in älteren Diskussionen z. B. um das exemplarische Lernen befangen, die neue Periode der didaktischen Fundierung des Geschichtsunterrichts. Zum Fortgang der Diskussion s. die Hinweise in der umfangreichen Bibliographie bei Rohlfes, Joachim (1986) Geschichte und ihre Didaktik. Göttingen, 389 f.
(9) Das gilt selbst für die Rückbeziehung auf die deutsche nationaldemokratische Bewegung des Vormärz und der Revolution von 1848 in politisch-pädagogischer Absicht, wie sie der Bundespräsident Gustav Heinemann einem demokratisch-patriotischen Geschichtsunterricht zur historischen Identitätsstiftung empfahl (s. Susanne Miller S. 12 f.). So wichtig es ist, diese &Uml;berlieferung deutlicher in Forschung und Lehre zu kennzeichnen, als es in der Tradition des nationalstaatlichen, bildungsbürgerlichen Geschichtsunterrichts geschah, so wenig handelt es sich um eine einfache Ableitung unserer Gesellschaftsordnung aus unproblematischen historischen Beständen. Die sozial-psychisch verständliche Suche nach "founding fathers" bedarf der historischen Kritik, soll sie nicht zu erstarrten, schließlich falsch orientierenden Monumentalbildern führen, die, wie in den USA, nur mit großer Mühe und gesellschaftlichen Schmerzen auf das richtige Maß reduziert und in erkenntnisfördernde Beleuchtung gerückt werden können. Der Gefahr, aus "politisch-pädagogischem Wirkungswillen" in direkter Aktion geschichtliche Bildung in "Schwarz-weiß"-Bilder zu sortieren, ist auch Helga Grebing trotz aller vorweggeschickten Einschränkungen nicht entgangen: s. Grebing, Helga (1988) Bismarck und Bebel - zweierlei Kontinuität- Die schwarze und die weiße Linie in der deutschen Geschichte. In: Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (1988) Streitfall Deutsche Geschichte. Geschichts- und Gegenwartsbewusstsein in den 80er Jahren. Essen, 71-86.
(10) Nicht einlösbar wegen der Zahl verbindlicher Themen ist z. B. der in den Lehrplänen mehrerer Länder dem Lehrer eingeräumte Stundenfreiraum für eigene Schwerpunktsetzung - so z. B. in den Richtlinien für die gymnasiale Oberstufe in NRW von 1982; s. dazu Jeismann, Karl-Ernst; Schönemann, Bernd (1989) Geschichte amtlich. Lehrpläne und Richtlinien der Bundesländer. Analyse, Vergleich, Kritik. Frankfurt, S. 79 ff., 151.
Literatur
Behrmann, Günter C. u.a. (1976): Geschichte und Politik. Didaktische Grundlegung eines kooperativen Unterrichts. Paderborn: Schöningh.
Behrmann, Günter C. u.a. (Hg.) (1976): Geschichte/Politik. Unterrichtseinheiten für ein Curriculum. Paderborn: Schöningh.
Blankertz, Herwig (1974): Theorien und Modelle der Didaktik. 8. Aufl. München: Juventa.
Dahrendorf, Ralf (1964): Ungewissheit, Wissenschaft und Demokratie. In: Delius Harald; Patzig Günther (Hg.): Festschrift für Josef König. Göttingen.
Dahrendorf, Ralf (1972): Konflikt und Freiheit. Auf dem Weg zur Dienstklassengesellschaft. München: Piper.
Giesecke, Hermann (1978): Skizzen zu einer politisch begründeten historischen Didaktik. In: Neue Sammlung. Zeitschrift für Erziehung und Gesellschaft. Jg. 18. 1978. (1), Seite 55-73.
Gies, Horst (1989): Geschichtsbewußtsein und Geschichtsunterricht in der Deutschen Demokratischen Republik. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. Jg. 40, Seite 618-625.
Jeismann, Karl-Ernst; Kosthorst, Erich (1956): Deutschlandbild und Deutsche Frage in den geschichtlichen Unterrichtswerken der Deutschen Demokratischen Republik. In: Jacobmeyer, Wolfgang (Hg.): Deutschlandbild und Deutsche Frage in den historischen, geographischen und sozialwissenschaftlichen Unterrichtswerken der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik von 1949 bis in die 80er Jahre. Braunschweig: Georg-Eckert-Inst. für Internat. Schulbuchforschung (Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Bd. 43).
Jeismann, Karl-Ernst (1989): Der Geschichtslehrer im Spannungsfeld von Politik, Erziehung und Wissenschaft. In: GWU. Jg. 40, Seite 515-533.
Jung, Ernst (Hg.) (1979): Marxismus im historisch-politischen Unterricht. Stuttgart: Klett. (Anmerkungen und Argumente zur historischen und politischen Bildung, 24).
Kant, Immanuel (1968): Werke in 10 Bänden. Weischedel, Wilhelm (Hg.) Bd. 9. Darmstadt: Wiss. Buchges.
Kuhn, Annette (1974): Einführung in die Didaktik der Geschichte. München: Kösel.
Meinecke, Friedrich (1948): Die deutsche Katastrophe. Wiesbaden: Brockhaus.
Quandt, Siegfried (Hg.) (1978): Deutsche Geschichtsdidaktiker des 19. und 20. Jahrhunderts. Wege, Konzeptionen, Wirkungen. Paderborn: Schöningh.
Schmid, Hans Dieter (1979): Geschichtsunterricht in der DDR. Stuttgart: Klett.
Schneider, Gerhard (1988): Geschichtsdidaktik und Geschichtsunterricht am Ende des Kaiserreichs (vorwiegend in Preußen). In: Geschichtsunterricht und Geschichtsdidaktik vom Kaiserreich bis zur Gegenwart. Festschrift des Verbandes der Geschichtslehrer Deutschlands zum 75jährigen Bestehen. Stuttgart: Klett, Seite 54-67.
Schörken, Rolf (1978): Zur Zusammenarbeit von Geschichts- und Politikunterricht. Stuttgart: Klett.
Weniger, Erich (1949): Neue Wege im Geschichtsunterricht. Frankfurt/M: Schulte-Bulmke.
Weniger, Erich (1989): Erziehung, Politik, Geschichte. Politik, Gesellschaft, Erziehung in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik. Ausg. und komm. von Gaßen, Helmut. Bd.4. Weinheim, Basel.
Weymar, Ernst (1961): Das Selbstverständnis der Deutschen. Ein Bericht über den Geist des Geschichtsunterricht der höheren Schulen im 19. Jahrhundert. Stuttgart: Klett.
Wilmanns, Ernst (1949): Geschichtsunterricht. Grundlegung seiner Methodik. Stuttgart: Klett.
Wilmanns, Ernst (1950): Geschichtsunterricht, Weltanschauung und Christentum. In: GWU. Jg. 40 (1), Seite 65-80.
Körber, Andreas (2004): Der Abgrund im Bindestrich? Überlegungen zum Verhältnis von historischem und politischem Lernen
1. Einleitung
JÖRN RÜSEN hat einmal sehr nebenbei bemerkt, dass im Bindestrich der Formulierung "historisch- politische Bildung" oder "historisch-politisches Lernen" ein "Abgrund ungeklärter Fragen" stecke (1). Das Problem der Abgrenzung und/oder des Zusammenhanges mag als ungeklärt gelten, keineswegs aber ist es neu. Es zieht sich durch die Fachdidaktik in der deutschen Nachkriegsgeschichte hindurch, ist aber auch schon in den Ansätzen zur Entwicklung einer politischen Bildung als Prinzip für alle Unterrichtsfächer während der Weimarer Republik spürbar. Andererseits: Es ist kein ausgetretenes Thema, kein Scheinproblem, bei dem sich die Diskussion mit immer wiederkehrenden, gleichen Argumenten im Kreise drehen würde. Vielmehr sind deutliche Veränderungen in den Konzeptionen festzustellen, von denen ich einige im Folgenden aufzeigen möchte (2), bevor ich meine eigene Konzeption im partiellen Anschluss an eine aktuelle Position skizziere. Ich werde mich dabei an eine aktuelle Differenzierung von Kooperationsmodellen anlehnen, die DIRK LANGE kürzlich in seiner Dissertation vorgelegt hat (3). Er unterscheidet (Tab 1):
- integrative Modelle historischer und politischer Provenienz
- Kooperationsmodelle
- korrelative Modelle, denen er auch sein eigenes Konzept zuordnet.
Indem ich diese Unterscheidung aufgreife, möchte ich zeigen, wie sich die ihnen jeweils zu Grunde liegenden theoretischen Vorstellungen von Definition und Aufgabe der Fächer verändert haben, welche Möglichkeiten in dem Neuansatz stecken und wo ich noch Klärungsbedarf bzw. die Notwendigkeit weiteren Nachdenkens sehe.
|
2. Zur Begriffskombination "historisch-politisch"
Die Zusammenstellung der Adjektive "historisch" und "politisch" ist älter als die didaktische Diskussion um das Verhältnis der jeweils mit ihnen bezeichneten Disziplinen. Im 18. Jahrhundert findet sie sich in Johann Friedrich Camerers "Vermischte[n] historisch-politische[n] Nachrichten" aus Schleswig-Holstein (4),seit dem zweiten Drittel des 19. Jahrhundert im Titel Leopold von Rankes "Historisch-politische[r] Zeitschrift" (5), sowie in den "Historisch-politische[n] Blättern für das katholische Deutschland" (6). Dies nur als einige beliebig heraus gegriffene Beispiele. Eine ausgearbeitete Vorstellung des Verhältnisses von "Historischem" und "Politischem" findet sich dort - etwa in den programmatischen Eröffnungsartikeln - allerdings nicht.
In der didaktischen und methodischen Literatur wird die Begriffsdoppelung seit vielen Jahren in vielfältigen Publikationen verwendet (z.B. auch im Untertitel meiner eigenen Dissertation) (7) - aber auch hier, ohne dass ein einheitliches, geklärtes Verhältnis der Beziehungen festzustellen wäre.
Andererseits gibt es durchaus eine Tradition grundsätzlicher Überlegungen zum hier in Frage stehenden Problem, in die fachdidaktischen Diskussion haben sie vor allem seit der Einführung der "Hessischen Rahmenrichtlinien Gesellschaftslehre", Eingang gefunden, die selbst ein Ausdruck einer bestimmten Zuordnung der beiden Bereiche waren. Auf einige der Stationen und Positionen dieser Diskussion werde ich noch zurückkommen. Angemerkt sei hier zunächst lediglich noch, dass in der Handbuchliteratur das Thema keineswegs mehr den grundsätzlichen Stellenwert einnimmt, den die Formulierung Rüsens suggeriert. Im Handbuch für Geschichtsdidaktik zum Beispiel findet sich ein zentraler Aufsatz von Hans-Jürgen Pandel , der bereits in neuere Entwicklung zu den korrelativen Modellen hineingehört, ansonsten jedoch auch nur ein einziger Artikel mit der Begriffskombination im Titel - dieser ist jedoch wieder bezeichnenderweise ein Beitrag, der das Verhältnis gerade nicht systematisch untersucht, sondern einen Lernort (Bundeswehr) und seine Besonderheiten beschreibt (8). Allenfalls ist in diesem Band vom Titel her allenfalls noch der Aufsatz "Geschichte und politische Praxis" von Katherina Oehler einschlägig (9). Schon eher wird das Thema in den Handbüchern zum politischen Lernen thematisiert, sei es in Mickels Handbuch zur politischen Bildung und in Sanders Handbuch politische Bildung (10).
3. Von den integrativen zu den kooperativen Modellen
Das erste Modell, das integrative, prägte die didaktische Diskussion vor allem in den 50er und 60er Jahren. Es ging in seiner historischen Variante aus von der Vorstellung, dass ein eigenständiges politisches Lernfeld für junge Menschen nicht gegeben sei. Die Geschichte sei das Gebiet, welches die Themen, die Probleme und Konflikte bereitstelle, an denen allein politisch gelernt werden könne. Durch das Aufkommen der Politikwissenschaft als einer eigenständigen wissenschaftlichen Disziplin und der politischen Bildung, die nun gegenwartsbezogene politische Themen didaktisch bearbeitete, wurde die andere Variante in die Diskussion gebracht: Da Lernende zum Handeln in der heutigen Gesellschaft befähigt werden müssten, müsse sich das Lernen auf die Gegenwart konzentrieren. Geschichte sei nur noch insofern von Bedeutung, als die historischen Aspekte der gegenwärtigen politischen Problemlagen zu klären seien.
Die erste systematische Diskussion entspann sich daher an der Herausforderung des traditionellen Geschichtsunterrichts und seines Selbstverständnisses durch diese neueren Konzepte einer gegenwartsorientierten politischen Bildung bzw. durch die sozialwissenschaftliche Gesellschaftslehre in den 1960er Jahren. Die Diskussion darum war nicht zuletzt von geschichtsdidaktischer Seite auch ein Versuch, die in Frage gestellte Eigenständigkeit neu zu begründen. Diese frühe Diskussion war bei allen Versuchen, eine Kooperation zu etablieren, stark von einem Verständnis traditioneller Fachinhalte, vorgegebenen Unterrichtsgegenstände geprägt. Es ging nicht zuletzt auch darum, diese für das jeweils eigene Fach zu reklamieren (11). Dahinter stand eine Auffassung, welche die einzelnen Fächer durch von außen vorgegebene Gegenstände und ihnen angemessene Methoden definierte (12). Auf dieser Basis ergaben sich Konzepte punktueller Kooperation, wie z.B. zum einen dasjenige, jedem historischen Thema einen politischen Anhang beizugeben und umgekehrt, das schon früh von Rolf Schörken und nun neuerdings noch einmal von Hans-Jürgen Pandel (13) abgelehnt wurde, zum anderen die Konzeption, ausgewählte, aber voneinander getrennte historische und politikwissenschaftliche Themen ergäben nebeneinander stehend von selbst ein Gesamtbild ("Zahnrad"- oder "Puzzle"-Theorie) oder schließlich zum dritten die Vorstellung, jedes Fach solle am gleichen Gegenstand die ihm gemäßen Aspekte behandeln, ohne dass diese jedoch systematisch aufeinander bezogen werden ("Sehschlitz"-Methode bzw. "Prisma"-Theorie) (14). Erarbeitet wurden in dieser Phase der Diskussion Kooperationsmodelle, welche hauptsächlich darin bestanden, klassische Themen der beiden Fächer unter allgemeineren Oberbegriffen bzw. Problemen nebeneinander zu stellen. Ein Beispiel hierfür sind z.B. die Vorschläge von Karl-Ernst Jeismann von 1978 (15) Jedes Fach behält demnach "seine" Themen, trägt aber ideell zu einem gemeinsamen Lernen bei. Worin die Zuordnungen bestehen, welcher Logik sie folgen, blieb jedoch weitgehend ausgespart.
4. Modelle politischer Geschichtsdidaktik
Von diesen rein gegenstandsorientierten Konzepten ist eine andere (bei Lange nicht verhandelte) Gruppe zu unterscheiden, die nicht eigentlich in diesen Diskussionsstrang gehört, sondern aus einer anderen Tradition stammen. Es geht um didaktische Konzeptionen, bei denen bewusste oder unbewusste Grundentscheidungen im Feld des jeweils anderen Faches die Themenwahl, Zielsetzungen, Methoden bei der didaktischen Strukturierung des eigenen Faches präfigurieren, diese Vorentscheidungen selbst aber nicht zum Gegenstand gemacht werden. Derart "politische Geschichtsdidaktik" ist kein Phänomen dieser Zeit, weil sie aber eine bestimmte Form der Verbindung der beiden Disziplinen bedeuten, sollen sie wenigstens kurz erwähnt werden. Hierzu gehört z.B. ein Geschichtsunterricht, der durch eine politische Option zu Gunsten von "Gleichheit" vor "Freiheit" strukturiert ist, auch z.B. die emanzipatorische Geschichtsdidaktik, wohl auch die Geschichtsdidaktik von Horst-Wilhelm Jung und Gerda von Staehr (16). Auf der anderen Seite gehören dazu politikdidaktiktische Konzepte, denen ein nicht eigens reflektierter Sinnbildungstyp zu Grunde liegt, wie etwa eine fundamentale Fortschrittsorientierung.
4.1. Die Entwicklung des korrelativen Modells: Ansätze bei Karl-Ernst Jeismann
Gegenüber den älteren integrativen und den koordinativen Konzepten begann 1978 Karl-Ernst Jeismann mit Überlegungen, die Eigenständigkeit und damit auch die Koordinierbarkeit der Fächer auf einer anderen Ebene auszumachen: nicht mehr Unterschiede im "Stoff" (17) oder den als Verfahren begriffenen "Methoden" begründen die Trennung der beiden Wissenschaften und Fächer, sondern unterschiedliche Erkenntnisinteressen (Jeismann spricht von Erkenntnisrichtungen) (18).
Während die Sozialwissenschaften und auch der Politische Unterricht sich durch ihren Gegenwartsbezug konstituierten, und somit ihr Interesse an vergangenen Zuständen immer diesem Gegenwartsinteresse gegenüber funktional, instrumentell bleibe, sei für die Geschichtswissenschaft das Interesse an "der Vergangenheit" konstitutiv. Wir haben hier also inmitten der älteren Debatte bereits einen Ansatz für die neuere Reflexionsebene, die dann Rüsen und zuletzt Pandel sowie Lange fortgeführt haben. Das gilt umso mehr, als Jeismann vom Geschichtsunterricht fordert, die Geschichtsbewusstseinsformen von politischen Konzepten sowie politische Geschichtsverständnisse (durchaus auch die dem eigenen politischen Unterricht zu Grunde liegenden) zu erörtern, ebenso wie der Politikunterricht die politische Funktion vom Geschichtsunterricht zu thematisieren hätte (19).
| Thementyp für den GU | Kombinationslogik | Thementyp für den PU | |
|---|---|---|---|
| vom Geschichtsthema her: | |||
| 1a | genetisch vorgehende Erarbeitung eines breiten Prozesses, tendenziell alle Sektoren erfassend.Betrachtung unter rein historischen Gesichtspunkten | Kombination über einzelne, vom historischen Thema vorgegebene und didaktisch akzentuierte Elemente, z.B. Einflüsse des historischen Sachverhalts auf die Gegenwart. | eigenständige Unterrichtseinheiten, |
| 1b | Kombination durch Systematisierung und exemplarischen Vergleich | systematisierende Betrachtung mehrerer historischer Beispiele (z.B. Revolutionen) | |
| 2 | thematischer Längsschnitt | Ergänzung um Gegenwartsperspektive | systematische, unter politikdidaktischen Gesichtspunkten erfolgende Betrachtung eines gegenwärtigen Themas aus dem im Längsschnitt behandelten Bereich |
| 3 | Epochenrepräsentation, Epochenquerschnitt | Analogie | moderne Beispiele |
| 4 | Betrachtung der Genese des historischen Problems | historische Regression | gegenwärtiges politisches Problem |
| vom Politikthema her: | |||
| 5 | historische Verhaltensforschung für Unterricht (skeptisch beurteilt!) | Skepsis bezüglich der Historisierbarkeit | Themen zur individuellen Verhaltenskonditionierung |
| 6 | Behandlung historischer Beispiele von politischen Deutungsstrukturen (z.B. Erbfeindthesen etc.) | Exemplarik | Feindbilder, Stereotype |
| 7 | historische Fallanalyse | Fallanalyse | |
Dennoch bleibt Jeismanns Argumentation sowohl in der Theorie als auch und besonders in den Beispielen für die Koordination letztlich in herkömmlicher Weise der Gegenstandsorientierung verhaftet. Zwar ignoriert er nicht den konstitutiven Gegenwartsbezug, den Ausgangspunkt des Historischen aus gegenwärtigen Interessen - thematisiert aber werde dabei immer die Vergangenheit als solche (20), die "als sie selbst erfahren" werden solle (21).
Dies ist vor allem an den beiden von ihm behandelten Beispielen gut zu erkennen: Barrington Moores Untersuchungen früherer Sozialstrukturen im Interesse einer Aufklärung der Entstehung nationalistischer und nationalsozialistischer Charakteristika in Deutschland charakterisiert er als spezifisch sozialwissenschaftlich, nicht aber historisch, gerade weil das Erkenntnisinteresse letztlich auf die Gegenwart gerichtet sei. Ebenso zeigt seine Auseinandersetzung mit einem Konzept demokratiegeschichtlichen Unterrichts bei Hilligen, dass es ihm stärker noch um "realgeschichtliche" Prüfungen von Geschichtsvorstellungen geht, denen politische Optionen zu Grunde liegen: Geschichtswissenschaft und Geschichtsunterricht haben hier nicht die Funktion, die Logik des dem politischen Unterrichts zu Grunde liegenden historischen Denkens (nämlich die Fortschrittskategorie) aufzuzeigen, sondern hauptsächlich die empirische Triftigkeit des so konstruierten Geschichtsbildes zu prüfen bzw. zu kritisieren. "Die Geschichte" dient als Korrektiv politischer Vorstellungen. Auf der Basis der neueren Historik (auf die ich noch zu sprechen komme) ist der zitierten Charakterisierung des Vorgehens von Barrington Moores als eines Beispiels sozialwissenschaftlichen, nicht aber historischen Denkens durch Jeismann zu widersprechen denn ihr zufolge dient der historische Blick in die Vergangenheit konstitutiv und somit immer der Orientierung der Gegenwart. Sie hat inzwischen verschiedene Sinnbildungstypen herausgearbeitet, und kann so den Blick Moores auf die Sozialstruktur vergangener Zeiten in seinem Interesse, die Gegenwart aufzuklären, als eine bestimmte Ausprägung historischen Denkens beschreiben, das von gegenwärtigen Orientierungsbedürfnissen ausgeht, die sozialwissenschaftlich formuliert sind, sich aber eben historischer Denkweise bedient (in diesem Fall handelt es sich um eine Mischung aus exemplarischem und genetischem historischen Denken) (22).
4.2. Weiterführungen
Den so von Jeismann begonnenen, nicht aber konsequent weitergeführten Ansatz hat Jörn Rüsen 1989 (also sieben Jahre vor dem eingangs zitierten Diktum vom Abgrund) aufgegriffen. Bereits auf der Basis seiner grundlegenden Arbeiten zum historischen Denken begriff er Geschichte nicht mehr als ein auf eine vergangene Wirklichkeit bezogenes Denken, sondern erkannte es als ebenso fundamental in der Gegenwart wurzelnd und auf ein gegenwärtiges Interesse gerichtet an, wie das politische.
Für ihn bestand der Unterschied zwischen dem historischen und politischem Bewusstsein zwar auch in unterschiedlichen Erkenntnisinteressen und -richtungen, die jedoch nicht in einem äußeren Gegenstandsbereich vorgegeben waren. Vielmehr unterschied er zwischen zwei unterschiedlichen Aufgaben des historischen und des politischen Denkens als zweier Instrumente zur Bewältigung der Gegenwart: Während politisches Denken dazu diene, dass Menschen mit dem Phänomen der Macht bzw. der Herrschaft umgehen können, diene historisches Denken der Verarbeitung von Kontingenz (23). Beide koinzidierten "dort, wo politisches Handeln auf eine Orientierung angewiesen ist, die seine zeitliche Perspektive, die zeitliche Richtung politischer Absichten und den Zeitverlauf politischer Vorgänge" betreffe. Ein Geschichtsbewusstsein sei dann "historisch-politisch", wenn es "auf politisches Handeln als dessen Orientierung bezogen" sei (24).
Die praktische Umsetzung allerdings, wie Rüsen sie 1989 skizziert, erscheint demgegenüber wiederum eher klassisch: Er sieht zwei Möglichkeiten der "Koinzidenz" historischen und politischen Bewusstseins:
- Politisches Handeln selbst wird historisch thematisiert (übliche Variante) (25)
- Thematisierung anderer als politischer Inhalte im Geschichtsbewusstsein mit Verdeutlichung ihrer Bedeutung für Politik (26).
Wenn man die moderne, narrativistische Historik Rüsens ernst nimmt, hat sie jedoch noch weiter reichende Konsequenzen für das Verständnis von historischem Denken und Lernen. Das Problem des Zusammenhangs von historischem und politischem Denken und Lernen muss gerade wegen der Herausarbeitung und Betonung eines konstitutiven Gegenwartsbezugs des historischen Denkens neu gestellt werden. So kann historisches Denken und Lernen nicht mehr als ein Denken und Lernen über historische Gegenstände aufgefasst werden, über gewissermaßen als abgeschlossen geltende, in der Vergangenheit liegende Wissensbereiche, sondern muss als ein Denken und Lernen über den eigenen Bezug zu solchen zeitlich entfernten Gegebenheiten angesehen werden - kein Denken "in" Geschichte mehr, sondern ein Denken über Zeit. Geschichtswissenschaft hat es eben nicht mit der Vergangenheit zu tun, was sie von der Politikwissenschaft unterscheide, sondern ebenso mit Gegenwart und Zukunft (27).
Die letzte konzeptionelle Wendung dieser Historik, ihre kulturwissenschaftliche Orientierung, hat dann dieses historisches Denken als einen Bewusstseinsbereich eigener und spezifischer Logik herausgearbeitet, gleichzeitig aber betont, dass er in seiner Kontingenzbewältigungsfunktion - die Rüsen 1989 noch als das Spezifikum des Historischen definierte - nur eine von mehreren individuellen und kollektiven, bzw. kulturellen Formen von Kontingenzverarbeitung ist: nämlich Verarbeitung derjenigen Kontingenz, die durch Zeit entsteht. So hat Friedrich Jaeger auf dem Historikertag 2000 in Aachen herausgearbeitet, dass auch politisches Denken und politisches Bewusstsein eine Form von Kontingenzverarbeitung ist, nämlich der kontingenten Verteilung von Macht und Herrschaft bzw. von Institutionen und Verfahren der Willensbildung - denn das alles, insbesondere auch Machtverhältnisse, könnte anders sein, als es vorgefunden wird. Historisches und politisches Denken und Bewusstsein sind demnach zwei unterschiedliche Ausprägungen einer gemeinsamen mentalen Orientierungsfunktion (28). So formuliert schließlich auch Lange: "Historisch-politisches Lernen nimmt seinen Ausgang in politischen Deprivations- und zeitlichen Kontingenzerfahrungen der Gegenwart" (29).
"Politisch-historisch" wäre ein Denken und ein Bewusstsein demnach dann, wenn es zur Bewältigung aktueller politischer Kontingenz auch dessen zeitliche Veränderungskomponente mit bedenkt, also z.B. Entwicklungen und Veränderungen heranzieht, um Ungleichheiten, Machtverteilungen, Verfahren der Willensbildung und -beeinflussung etc. zu erklären und mit Sinn zu versehen, bzw. wenn historische Veränderungen jeweils auch mit Hilfe politischer Erklärungsmuster erklärt und auf ihre politische Bedeutung hin befragt werden.
Aber auch diese Definition ist nicht wirklich befriedigend. Letztlich bleibt das eine eher strukturzentrierte Definition eines politisch informierten historischen Denkens bzw. eines geschichtsbewussten politischen Denkens.
Ich schlage daher vor, sich auch im Hinblick auf historisch-politisches Lernen an eine neuere Wendung der Geschichtsdidaktik anzuschließen und noch stärker als bislang skizziert die jeweiligen Bewusstseinsformen in den Mittelpunkt zu rücken, indem als Kategorie und Ziel historischen und politischen Lernens jeweils die Reflexivität des eigenen denkenden Tuns gesetzt wird.
Bevor ich dies skizziere, muss ich mich aber noch mit zwei jüngeren Arbeiten zu diesem Thema auseinander setzen, nämlich mit dem bereits zitierten Aufsatz von Hans-Jürgen Pandel und der ebenfalls schon mehrfach angeführten Dissertation von Dirk Lange, denn beide haben die korrelative Form der Fächerverbindung weiter entwickelt.
4.3. Jüngere Arbeiten
Hans-Jürgen Pandel legt in seinem Aufsatz dar, dass Vorstellungen von fächerverbindendem Lernen nicht an den gegenwärtig existierenden Fächern ansetzen dürften. Das jeweilige Fächergefüge sei nämlich selbst Ergebnis kontingenter Kombinationen von Erkenntnisinteressen und Sachgebieten. Vielmehr müsse von einem überschaubaren Set von "hinter" den realen Disziplinen und Teildisziplinen liegenden Denk- und Erkenntnisformen ausgegangen werden, die den realen Fächern zumindest im sozial- und kulturwissenschaftlichen Bereich durchaus gemeinsam seien. Fächer überhaupt aufzulösen (30) sei kontraproduktiv, weil dadurch die je spezifischen Erkenntnisweisen der ideellen ‘Fächer’ (31) verwischt würden, wohl aber sei stärkere Gemeinsamkeit in Themen- wie in Methodenbezügen möglich. Hinzu kommt, dass Pandel nicht Ergebnisse der einzelnen Disziplinen als das zu Lehrende und zu Lernende ansieht, sondern die Methoden, die fachspezifischen Denkweisen selbst als die lernbaren Inhalte definiert. Mit diesen Überlegungen führt Pandel die Debatte ein gutes Stück weiter: Das Fachspezifische, das es zu bewahren, dann aber miteinander zu verschränken gelte, sind demnach die fachspezifischen Erkenntnisweisen, hier historisches und politisches Denken (32).
Nur kurz sei darauf hingewiesen, dass für Reinhold Hedtke eine Integration der Fächer in ihrer Eigenständigkeit gerade angesichts der kulturwissenschaftlichen Ausrichtung nur über ein übergreifendes Konzept eines "gesellschaftlichen Bewusstseins" möglich ist, innerhalb dessen dann Spezialisierung und Ausdifferenzierung entlang unterschiedlicher Erkenntnisweisen möglich werde. Inwieweit dies mehr ist als eine Verlagerung des Problems auf eine andere Ebene, bleibt zu diskutieren (33). Wichtig ist, dass für Hedtke die Grundlage hierfür nicht mehr eine Ausrichtung an verschiedenen Fachwissenschaften und ihre verschiedenen Erkenntnisweisen sein könne, weil diese nicht wirklich trennscharf differenzieren. Voraussetzung für eine solche Zusammenfassung und Differenzierung ist vielmehr die gemeinsame Emanzipation der Fachdidaktiken von ihren Bezugswissenschaften im Sinne der Entwicklung eines eigenständigen Forschungsfeldes, nämlich der Erforschung und Reflexion auch der Bedeutung und Rolle der Fachwissenschaften in der Gesellschaft selbst (34). Dies entspricht im Übrigen weitgehend der Emanzipation, die Karl-Ernst Jeismann für die Entwicklung der Geschichtsdidaktik zur Wissenschaft vom Geschichtsbewusstsein in der Gesellschaft reklamiert hat (35).
Auch Dirk Lange begründet in seiner umfangreichen Dissertation ein korrelatives Modell des historisch-politischen Lernens. Er entwickelt dazu in einiger Breite aus aktuelleren fachwissenschaftlichen Tendenzen beider Fächer die Vorstellung einer "historisch-politischen Wissenschaft" als der einer "historisch-politischen Didaktik" zugehörigen Fachwissenschaft. Das gemeinsame Moment beider besteht ihm zufolge in einer elementaren und radikalen Subjekt- und Alltagsorientierung, d.h. in der Konzentration des forschenden Blicks der Fachwissenschaft(en) auf subjektive Erfahrungen, Verarbeitungsweisen und Handlungsweisen von einfachen Menschen, die nicht den herkömmlichen Vorstellungen von "großer" Geschichte bzw. "hoher" Politik zuzuordnen sind. Sowohl in der Alltagsgeschichte wie in der Politikwissenschaft arbeitet er Ansätze heraus, die die konstruktivistisch verstandene Konstitution von Wirklichkeit durch denkende und handelnde Menschen in den Blick nehmen. In beiden Wissenschaften bedeutet dies u.a. die Abkehr von einem Modell strikter Trennung zwischen "politisch" und "nicht-politisch" (sei es "gesellschaftlich" oder "privat"), die Entgrenzung des Politikbegriffs, welche es ermöglicht, die Konstitution des Politischen in den Vorstellungen der Menschen selbst sowie ihre kommunikative Herstellung in der Gemeinschaft in den Blick zu nehmen.
Langes auf einem so verstandenen subjektivistischen Geschichts- und Politikbegriff aufbauendes Konzept der Differenz zwischen Geschichts- und Politikwissenschaft bzw. den dazugehörigen Didaktiken besteht in der Unterscheidung zweier unterscheidbarer Bewusstseinsbereiche (36). Er versteht unter historischem und politischem Bewusstsein im Sinne der konstruktivistischen Theorien "zwei unterschiedliche [...] Erklärungszusammenhänge, durch die der Mensch seine Wirklichkeitsvorstellungen sinnhaft aufbaut" (37), folgt also hier der schon bei Rüsen 1989 angelegten Denkrichtung. Auch er geht - ähnlich wie 2000 Jaeger - über Rüsens damalige Position hinaus und sieht in historischem und politischem Bewusstsein jeweils "modellhafte Vorstellungen von Teilbereichen einer allgemeinen kognitiven Struktur" (38), die durch jeweils eigene Sinnbildungsformen gekennzeichnet seien.
Dadurch werde es möglich, historisches und politisches Bewusstsein getrennt zu betrachten, aber beiden Bewusstseinsformen Gegenwartsbezug, Konsequenzen für das Handeln (also Orientierungsfunktion und Zukunftsbezug) sowie eine Spannung zwischen zur Wissenschaft und je subjektiver Erfahrung zuzugestehen (39).
|
LANGE strukturiert nun das Geschichtsbewusstsein in dreifacher Weise, nämlich hinsichtlich (Tab. 3)
- der Operationen des historischen Denkens durch die von ihm als "Kognitionstypologie" bezeichnete Jeismannsche Dreiheit von "Analyse, Sachurteil und Wertung",
- der narrativistischen Unterscheidung der Sinnbildungstypen von Jörn Rüsen sowie
- einer Typologie von Zeitvorstellungen (zirkulär, linear, punktuell), die allerdings mit den Sinnbildungstypen eng korreliert (40).
Nach diesem Vorbild konzipiert er dann - in Anlehnung an Grammes` Definition als das "Insgesamt der Vorstellungen und Einstellungen zu politischen Prozessen"- auch als den Forschungsgegenstand der Politikdidaktik: das Politikbewusstsein. Letzteres konstruiert demnach die Vorstellungen der Einzelnen über die gesellschaftlichen Mechanismen und Prozesse, mit denen individuelle Interessen in allgemeine Verbindlichkeit transformiert werden, in welchen politische Willensbildung funktioniert. Ähnlich wie Geschichtsbewusstsein nicht Wissen um vergangene Wirklichkeit enthält, sondern mit Hilfe verschiedener Deutungsmuster, Kategorien etc. erstellte Vorstellungen einer vergangenen Wirklichkeit, ist auch dies ein kognitives Schema (41).
Diese Konzeption des politischen Bewusstseins entspricht wiederum der oben referierten Position, dass auch politisches Denken Verarbeitung von Kontingenz ist, nämlich einer Differenz zwischen Sollen bzw. Möglichkeit einer- und Sein andererseits. Dabei reduziert LANGE (Tab 1) das politische Bewusstsein jedoch auf zwei Grundtypen von Herrschaft und ihre Legitimation, nämlich die demokratische und autoritäre Herrschaft, die sich in vier Dimensionen unterscheiden, nämlich hinsichtlich
- der dem einzelnen Menschen zugeschriebenen politischen "Basiskompetenz" (kompetente Selbständigkeit, Abhängigkeit),
- der Stellung des einzelnen in der Gesellschaft (Bürger, Untertanen),
- den vorgestellten Verhältnissen zwischen Individuen und Gruppe (Exklusion, Inklusion bzw. Partizipation) sowie
- der zu Grunde liegenden Herrschaftsrelation (Identität bzw. horizontal, Nicht-Identität bzw. vertikal) (42)
Zudem wird der "demokratische Sinnbildungsmodus" einer weiteren Unterteilung unterzogen (plebiszitär, repräsentativ, elektoral) (43).
Sinnbildungsform |
"politikgeschichtliches" Lernen |
"geschichtspolitisches" Lernen |
|---|---|---|
zirkulär |
es wird gelernt, Herrschaft durch Verweis auf ein "schon-immer-so" zu legitimieren |
|
punktuell |
es wird gelernt, Herrschaft durch Analogiebildung zu legitimieren |
|
linear |
es wird gelernt, Herrschaft so zu legitimieren, dass sie entwicklungslogisch erscheint |
|
autokratischer Typ |
es wird gelernt, dass verbindliche historische Sinnbildungen von einer Minderheit entwickelt werden sollen |
|
demokratischer Typ |
es wird gelernt, dass jeder an verbindlichen Sinnbildungen mitwirken kann |
Das "historisch-politische Bewusstsein" schließlich wird auf dieser Basis der strukturell gleichen Unterscheidung von historischem und politischem Bewusstsein konzipiert als ein Überschneidungsbereich der beiden Bewusstseinsformen, der eine eigene Substruktur mit zwei Ausprägungen auch von Lernen bildet (44):
- "Politikgeschichte" als die historische Argumentation auf verschiedenen Politikfeldern, d.h. politische Argumentation mit historischen Zuständen und Prozessen; sowie
- "Geschichtspolitik" als politische Auseinandersetzung um die Deutung von Vergangenheit allgemein; Geschichte werde selbst zum Politikfeld. Geschichtspolitik umfasse den Bereich, der das historische Denken der Gemeinschaft selbst zum Gegenstand habe. Dabei gehe es nicht um die Interpretationen als solche, sondern darum, wie individuelle Interpretationen in allgemeingültige transformiert werden. (Museen, Denkmäler, Medien etc.).
Nach diesem so strukturierten "historisch-politischen Bewusstsein" werden sodann die didaktischen Aufgabenfelder der empirischen Analyse, der Reflexion, der normativen Bestimmung erwünschter Ausprägungen sowie der Pragmatik zugeordnet (45).
In der konkreten Umsetzung (vgl. Tab. 4) erarbeitet Lange auf der Basis dieser Sinnbildungsformen verschiedene Typen historisch-politischen Lernens, die jeweils verschiedenen Kompetenzen zugeordnet sind. Diese können hier nicht alle aufgezählt werden, es ist z.B. "lineares politikgeschichtliches Lernen" darunter, mit welchem "gelernt wird, Herrschaft dadurch zu legitimieren, dass sie als entwicklungslogisch erscheint" (46), bzw. das "geschichtspolitische Lernen", das die Kompetenz vermittle, "politische Herrschaftsformen zu legitimieren, durch die kollektiv bindende Geschichtsdeutungen erzeugt werden sollen" (47). So sei ein Lernen als autokratisches geschichtspolitisches Lernen zu klassifizieren, wenn gelernt werde, dass man auf Geschichtsdeutungen anderer, Mächtigerer angewiesen sei, demokratisches geschichtspolitisches Lernen hingegen zeige, dass der Einzelne an der Herstellung von Verbindlichkeit von Sinnbildungen gleichberechtigt beteiligt sei könne.
Nicht alles hieran erscheint konsistent. Das gilt zum einen für die Benennung der Zeitvorstellungen und ihre Verbindung zu den historischen Sinnbildungstypen. Auch zeigt Tab. 4 ganz deutlich, dass hier historisches und politisches Bewusstsein nicht wirklich miteinander verschränkt werden, sondern auf das jeweils andere Feld angewandt. Im Grunde wird hier gefordert, Politikgeschichte mit den Mitteln der modernen Historik zu betrachten und Geschichtspolitik bzw. öffentliche Kommunikation über Geschichte als Politikfeld ernst zu nehmen.
Es fehlt noch eine Art der Verschränkung, nämlich jene, die den Blick darauf lenken würde, dass in einzelnen historischen und politischen Aussagen, Stellungnahmen, Kategoriendefinitionen etc. immer auch Bezugnahmen und Sinnbildungen hinsichtlich der anderen Kontingenzverarbeitung enthalten sind. Hier liegt eine Zukunftsaufgabe für die historisch-politische Didaktik. Es geht nicht nur (aber auch) darum, geschichtliche Argumentationen als Legitimationsformen endlich geschichtsdidaktisch zu analysieren bzw. politisch zu hinterfragen, wie historische Vorstellungen zwischen Mitgliedern einer Gesellschaft verhandelt werden. Es muss auch darum gehen, die jeweils mitgedachten politischen Konzepte zu ergründen und Lernende zu befähigen, hier einerseits konsistent selbst Sinn zu bilden und andererseits ihnen in der öffentlichen Kommunikation angebotene Sinnbildungen hinsichtlich der Sinnbildungen in beiden "Dimensionen" zu analysieren. Ich habe eine solche Analyse ansatzweise in meinem Buch über die öffentliche Erinnerung an Gustav Stresemann versucht (48).
4.4. Verschränkung über die Meta-Ebene der Reflexion des eigenen Tuns
Damit bin ich bei meiner eigenen Position: Ich halte die korrelative Verschränkung von historischem und politischem Bewusstsein, von historischem und politischem Denkens als zweier Formen kultureller Wirklichkeitser- und Verarbeitung für geboten und richtig. Angesichts der Pluralität der heutigen Gesellschaft und vor dem Hintergrund einer normativen Vorstellung demokratischer Beteiligung halte ich es aber nicht nur für geboten, Schüler darin zu befähigen, derartige Sinnbildungen überhaupt, bewusst und gut erstellen zu können, sondern ihnen diese Prozesse als Sinnbildungsprozesse selbst bewusst zu machen. Ich plädiere also dafür, die Meta-Ebene der Reflexion über das eigene denkende Tun und das von ihm orientierte Handeln in die Geschichtsdidaktik, die Politikdidaktik und die historisch-politische Didaktik einzubeziehen. Dazu gehört auch, die Logik dieser Sinnbildungsmechanismen selbst bewusst zu machen, um Lernende zu befähigen, Abweichungen in den Vorstellungen nicht notwendig als Ausdruck sachlicher Fehler (vornehmlich beim Gegenüber) zu verstehen, sondern solche Differenzen auch anerkennen zu können. Erst dann kann eine auf wahre Verständigung gerichtete Kommunikation über Geschichte und Politik bzw. über die politische Funktion historischer Aussagen und die historischen Entwürfe in politischen Konzepten in Gange kommen.
Ein reflexives Geschichtsbewusstsein ist dann auch politisch reflexiv, wenn es nicht nur um seine Tätigkeit weiß, "sich in der Zeit zurechtzufinden" (49), sondern auch um die politischen Implikationen ebendieser Tätigkeit - wenn es politisch darüber reflektieren kann, dass und warum seine eigene Ausprägung, die von ihm für plausibel gehaltenen Deutungsmuster, usw., sich von denjenigen anderer Mitglieder der Gesellschaft, von Menschen aus anderen Kulturen usw. unterscheiden, wenn es die Lage versetzt ist, sich mit anderen Menschen über Geschichte zu unterhalten (50), und zwar nicht nur im Hinblick auf eine vordergründige inhaltliche "Wahrheit" und (monodimensional-reflexiv) über z. B. plausible Deutungsmuster, Vorlieben etc., sondern wenn es auch in der Lage ist, sich mit ihnen über das Politische darin zu verständigen, also z. B. über die Gründe, warum bestimmte Vorlieben interessengebunden so sind, wie sie sind - in der Lage, eine Form von Verständigung über die Implikationen von Deutungsmustern und Theorieformen zu erzielen. So bedeutet es zum Beispiel, historisch politisch bewusst zu sein, wenn man in der Lage ist, die unterschiedlichen politischen Kriterien zu diskutieren, die der Historismus und die historische Sozialwissenschaften entwickelt haben, um mit vergangenen Ereignissen und Strukturen umzugehen.
Andersherum ist ein politisches Bewusstsein auch historisch reflexiv, das Kategorien und Konzepte besitzt, mit denen es die unterschiedlichen Deutungen von Geschichte, die es in verschiedenen politischen Konzepten thematisieren kann, in ihrer historischen Sinnbildungslogik einschätzen kann.
Schließlich eröffnet sich für die Didaktik auch ein weiteres Forschungsfeld: Ähnlich wie die Geschichtsdidaktik sich seit vielen Jahren um die Entstehung, Formen, Ausprägungen von Geschichtsbewusstsein von Individuen und Gruppen in der Gesellschaft auch empirisch kümmert, muss dies auch die Politikdidaktik tun (Ansätze dazu finden sich bei Grammes) und es muss auch für die Verschränkung gelten.
"Alltag" im Sinne einer eigenen Art des Denkens darf dabei nur heuristisch definiert werden, nicht z.B. als eine Sinnprovinz völlig eigenständiger Sinnbildungsprozesse. Es muss das Interesse der historischen, der politischen wie auch der verschränkenden Didaktik sein, zu ergründen, ob und wie das historische und das politische Denken von Menschen in ihren verschiedensten Lebenszusammenhängen ähnlich oder unterschiedlich funktionieren, welche Denklogiken diesen Prozessen zu Grunde liegen und zu ergründen, ob und wie sie zusammenhängen bzw. aufeinander bezogen werden können. Das gilt zum einen für jedes Fach für sich, aber es gilt auch für das historisch-politische Denken. Hier nämlich wird thematisiert (empirisch, normativ, pragmatisch), ob und wie Menschen Ergebnisse historischer Vergewisserung auf ihre politischen Vorstellungen übertragen und in welcher Form politische Konzepte und Vorstellungen auf das historische Denken zurückwirken. Es geht also um "relationales" Denken nicht nur zwischen "Wissenschaft" und "Alltag", sondern auch zwischen historischem und politischem Bewusstsein - auf der "Ebene" der Wissenschaft wie des "Alltags". Spezifisch unterrichtsfachdidaktisch bedeutet das auch, Lernprozesse zu analysieren, in denen Schülerinnen und Schüler alltägliche Argumentationen mit Geschichte (z.B. in der Familie) mit solchen in fachwissenschaftlicher Literatur oder der Presse vergleichen: Werden gleiche oder kompatible Deutungsmuster verwendet?
Abschließend möchte ich noch einmal definieren:
"Historisch-politische" Kompetenz besteht darin, historische Aussagen mit Hilfe politischer bzw. politikdidaktischer Kategorien und politische Aussagen mit Hilfe geschichtsdidaktischer Kategorien sachadäquat analysieren und sinnhaft verarbeiten zu können.
Historisch-politisches Lernen nimmt also die politische Funktion "der Geschichte", besser: der Geschichtsauffassungen wie der abstrakteren Geschichtskonzeptionen, in den Blick, und nimmt es sich zum Ziel, junge Menschen dazu zu befähigen, an der gesellschaftlichen Kommunikation (die oft genug eine Auseinandersetzung ist) über historische Themen teilzunehmen, indem der Blick nicht vornehmlich auf die Fragen der empirischen Triftigkeit gerichtet wird, sondern die normative und narrative Triftigkeit sowie eine Triftigkeit der jeweiligen Selektion der verwendeten Informationen ins Zentrum gerückt werden; für die akademische Disziplin der historisch-politischen Didaktik ist es daher zentral, diesen (selbst natürlich nicht absolut zu setzenden, sondern selbst der skizzierten Diskussion zu unterwerfenden) Begriff von Geschichte und historischem Denken zu vermitteln bzw. zu diskutieren, seine politische Bedeutung zu reflektieren und Begriffe, Konzepte und Methoden bereit zu stellen bzw. zu entwickeln, mit denen der politische Aspekt von Geschichtsaussagen und -diskussionen, von Kontroversen aber auch (vermeintlichen) Konsensen herausgearbeitet und diskutiert werden kann. Historisch-politische Didaktik ist nach diesem Konzept politisches Lernen über Geschichte als gesellschaftliche und individuelle Konstruktion. Geschichte wird als politisch begriffen, weil "Geschichte" gegenwärtige Konstruktionen sind.
Das bedeutet nicht, dass historisch-politische Didaktik ein reines Theorieunterfangen wäre. Vielmehr ist die politische Komponente an allen möglichen historischen (wie auch politischen) Themen aufzuzeigen. So ist z.B. ein historischer Gegenstand "Reichsgründung" dazu geeignet, an ihm zu verdeutlichen, dass und wie sich in unterschiedlichen Begriffen, Darstellungen und Aussagen, nicht nur Wertungen, über diesen historischen Vorgang, politische Konzeptionen erkennen lassen, ja wie diese unterschiedlichen historischen Aussagen mit politischen Konzepten in Wechselwirkung stehen. Historisch-politisches Lernen ist somit notwendig auf den Gesamtzusammenhang des historischen Denkens gerichtet, wie er in dem neueren Theoriemodell der Gruppe um Waltraud Schreiber formuliert wird: Noch stärker als in der "reinen" Geschichtsdidaktik müssen nicht nur Aussagen über Vergangenheit und über diachrone Zusammenhänge in den Blick genommen werden, sondern immer auch die Aussagen über die Bedeutung dieser Geschichten für die jeweilige Gegenwart der Autoren und Rezipienten bzw. Adressaten, noch stärker als in der Geschichtsdidaktik ist eine Darstellungsorientierung von Nöten, die die Quellenarbeit nicht ersetzt, ihr aber doch deutlich zur Seite gestellt wird, noch stärker muss auf die historiographische Denklogik von historischen Aussagen in ihrer politischen Relevanz geachtet werden. Die Forderungen von v.Borries, Multiperspektivität nicht nur in den Quellen, sondern ebenso auf der Ebene der Darstellungen und der gegenwärtigen Schlussfolgerungen einzulösen, also Kontroversität und Pluralität einzulösen, ist in der historisch-politischen Didaktik zu reflektieren. Historisch-politisches Lernen soll dazu befähigen, den politischen Charakter von Geschichtsaussagen zu erfassen und mit ihm umzugehen lernen.
Historisch-politische Didaktik ist so meines Erachtens nach vornehmlich die Didaktik der "Vergangenheitspolitik" bzw. "Geschichtspolitik", nicht die Didaktik der politischen Geschichte und auch nicht die Didaktik der Geschichte des politischen Denkens.
4.5. Einige Konsequenzen
Welche Konsequenzen lassen sich aus diesen Forderungen ableiten?
Zunächst ist für historischen und politischen Unterricht zu fordern, dass die organisatorische Trennung der Fächer nicht einfach aufgehoben wird zu Gunsten eines Integrationsfaches, in dem dann die verschiedenen Fragestellungen und Erkenntnisinteressen, Prinzipien und Methoden, irgendwie miteinander verschmelzen würden. Die Aufrechterhaltung der Fächer darf jedoch nicht mit überkommenen Besitzständen an Themen oder überkommener Illusionen, das jeweils "eigene" Fach könnte die Aufgaben des Anderen quasi mit übernehmen, legitimiert werden, sondern allein durch die fachtheoretischen Erkenntnis, dass die beiden Fächer jeweils eigene Logiken von Kontingenzbewältigung, von Orientierung und Sinnbildung vermitteln können.
Abzulehnen ist aber ebenso jegliche grundsätzliche Trennung der Sachgebiete und Themen. "Beide" Fächer bearbeiten mit ihren Mitteln und in gegenseitiger Verschränkung die gleichen Gegenwartsprobleme der Gesellschaft.
Zu fordern ist in beiden Fächern und in ihrer Zusammenarbeit eine grundsätzliche Orientierung auf die Reflexion des eigenen Tuns, d.h. der Einbezug der Meta-Ebene der Erkenntnistheorie und -kritik. Auf dieser Ebene können dann auch die unterschiedlichen Orientierungs- und Lernmöglichkeiten durch politisches und historisches Denken aufeinander bezogen werden.
In pragmatischer Hinsicht wird es wohl nur punktuelle, nicht aber eine durchgängige thematische Kooperation an ausgewählten Beispielen der Geschichtspolitik geben können. Themen müssten aktuelle politische Kontroversen und Themen mit Geschichtsbezug werden, die in Geschichts- und Politikunterricht jeweils mit deren eigenem Erkenntnisinteresse und deren eigener Methodik bearbeitet werden müssten:
Im Geschichtsunterricht müsste ein Vergleich der in aktuellen Diskussionsbeiträgen erkennbaren verschiedenen Geschichtsauffassungen erfolgen. Das bedeutet unter anderem, politische Debattenbeiträge auf ihren Umgang mit Vergangenheit zu untersuchen, den von ihnen hergestellten Zusammenhang zwischen Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft, also der behaupteten Kontinuitätsvorstellungen und der Triftigkeit(en) der Argumentation. Politische Beiträge müssen als Aussagen über Geschichte (de-)konstruiert werden (51).
Im politischen Unterricht muss es unter anderem um die politikwissenschaftliche Erörterung der in den Beiträgen enthaltenen politischen Verortungen und Normannahmen innerhalb des gegenwärtigen politischen Spektrums gehen, um die Aufklärung hinsichtlich der in ihnen enthaltenen enthaltenen gegenwärtigen Optionen etc. Es geht um eine typisierende und klassifizierende Analyse von in historischen Aussagen enthaltenen politischen Implikationen ebenso wie um die Untersuchung der Struktur von (geschichts-) politischen Debatten. Historische Aussagen müssen somit aus ihrem vermeintlichen alleinigen Bezug auf Vergangenheit herausgelöst und als Instrumente in gegenwärtigen politischen Auseinandersetzungen bzw. in Versuchen von Integration und Abgrenzung etc. sichtbar gemacht werden.
Methodisch empfehlen sich wohl thematisch und zeitlich gemeinsame Projekte, in denen historische und politische Aspekte arbeitsteilig bearbeitet werden (Fächer quasi als arbeitsteilige Gruppen, jeweils mit Doppelmitgliedschaft) und gemeinsamen Abschlusssitzungen, in welchen die Ergebnisse historiographischer und politikwissenschaftlicher Analysen gemeinsam vorgestellt und miteinander verglichen werden können (Aufhebung der Fachtrennung, Gruppeneinteilung ist wegen Doppelmitgliedschaft ja schon aufgehoben).
Für die fachdidaktische Lehre bedeutet dieses unter anderem, dass die "klassischen Themen" von Geschichts- und Politikunterricht, wie sie z.B. in den Lehr- und Rahmenplänen enthalten sind, jeweils historisch und politisch reflektiert und analysiert werden.
Die didaktische Forschung müsste sich unter anderem der Frage widmen, inwieweit in der Gesellschaft bzw. in verschiedenen Gruppen ein Bewusstsein für die Verschränkungen historischer und politischer Argumentationen gegeben ist. Zu klären ist dabei u.a. die Frage, inwieweit "Geschichte" als ein soziales Konstrukt wahrgenommen wird, in das immer soziale und kulturelle Perspektiven eingehen. Zu klären wäre zudem, inwieweit spezifische politische Grundhaltungen mit Formen der historischen Sinnbildungen und Argumentationen korrelieren. Möglichkeiten der Förderung derart "interrelationalen" Denkens (Grammes) sowohl im Unterricht als auch in anderweitigen Lehr- und Lernsituationen gehören ebenso in das Forschungsprogramm historisch-politischer Didaktik.
Anhang
Tabellarische Übersicht über Koordinations- und Kooperationsmodelle historischen Lernens
| Kooperations- und Koordinationsmodelle historischen und politischen Lernens | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Typ | Geschichtswissenschaft/ Geschichtsdidaktik/ Geschichtsunterricht | Politikwissenschaft/ Politikdidaktik/ Politikunterricht | Beispiele | Bemerkungen | |
| ältere Modelle, welche die Themen und Erkenntnisweisen des jeweils anderen Fachs in das eigene zu integrieren versuchten | ||||||
| I n t e g r a t i o n s m o d e l l ea |
"historisches Integrations -modell"a |
|
Geschichts -unterricht bis in die 70er Jahre hinein |
keine Wahrnehmung der unterschiedlichen Fachinteressen, -methoden, Fragestellungen auch hier eigentlich eine mangelnde Reflexion der historischen Sinnbildungen: Vergangenheit als in exemplarischer Sinnbildung mit der Gegenwart verbundenes Probehandlungsfeld; |
||
| "politisches Integrations -modell"a |
historisch-politisches Lernen durch die Erarbeitung der historischen Dimension des
aktuell Politischen; historische Genese von Problemlagen, Reflexion von Analogien |
unreflektiert hinsichtlich der in dem jeweiligen Denken enthaltenen historischen Sinnbildungstypen sowie ihrer Viabilität; z.T. bei Analogien unreflektiert exemplarisch | ||||
| Modelle, die von eigenständigen Themen und Aufgaben der beiden Fächer ausgehen, diese aber unterrichtlich aufeinander beziehen. | ||||||
| K o o p e r a t i o n s m o d e l l e |
"Zahnrad" -Modell bzw."Puzzle"- Theorie | historische Themen | politische Themen | Aus der Nebeneinanderstellung der in sich unveränderten Themen ergäbe sich eine hinreichende Integration | ||
| "Prisma" -Theorieb | historische Aspekte eines Themas | politikwissen -schaftliche Aspekte eines Themas |
"Verkehr" "Wasser" "Lärm" als Thema |
gleicher Gegenstand, jeweils unter fachspezifischen Aspekten zu betrachten, ohne dass diese Aspekte systematisch aufeinander bezogen würden | ||
| Modelle, die auf bestimmten Setzungen im Bereich des jeweils anderen Faches beruhen | ||||||
| T h e m e n f o k u s s s i e r e n d e |
historisch orientierter Politik- unterricht |
|
HILLIGEN: Demokratie -entwicklung; | Didaktische Entscheidungen im zentralen Fach sind durch Optionen im jeweils anderen Fach geprägt, thematisieren und reflektieren diese jedoch nicht hauptsächlich | politischer Unterricht geprägt durch Vorent -scheidungen hinsichtlich historischer Sinnbildung (z.B. Fortschritts -kategorie); keine Reflexion der eingehenden Sinnbildungs -muster und ihrer Kontingenz | |
| politischer Geschichts- unterricht | Geschichtsunterricht, der eine bestimmte politikwissenschaftliche Option der historiographischen Analyse zu Grunde legt, ohne diese selbst zu reflektieren und kontrovers zu stellen |
KUHN: Emanzipation; SCHULZ-HAGELEIT (1978): Emanzipation; JUNG/V.STAEHR |
Geschichts -unterricht unter der Prämisse gegenwärtiger politischer Setzungen | |||
| Modelle, welche von eigenständigen Erkenntnisweisen der beiden Disziplinen ausgehen, diese aber als grundsätzlich als sich überschneidend und zu verschränken verstehen | ||||||
| K o o r d i n a t i v e M o d e l l e |
"historisch- politische Didaktik"a | "Politikgeschichte": Gedeutete Vergangenheit als Instrument der politischen Auseinandersetzung: historiographische Aufarbeitung der einzelnen Politikfelder; Argumentationen mit "Geschichte" stehen im Vordergrund | Analyse wirtschafts -geschichtlicher Argumentationen | |||
| "Geschichtspolitik": "Vergangenheits- deutung selbst wird zum Gegenstand der Auseinandersetzung: Wie wird Gemeinsamkeit (oder besser: "Kompatibilität") in der Gesellschaft hergestellt; wie werden aus individuellen Sinnbildungen allgemeinverbindliche gemacht | Reflexion über die Herstellung von historischer Identität Denkmäler, Museum, Medien, Schule etc. Didaktik als Politikfeld | |||||
| Reflexions- orientierung |
|
|||||
| a Bezeichnung nach LANGE 2002; b Bezeichnung nach PANDEL 2001 | ||||||
Anmerkungen
- RÜSEN, JÖRN (1996), S. 504. Eine auch in diesem Aspekt erweiterte Fassung findet sich in: RÜSEN, JÖRN (2000), S. 43ff, hier bes. S. 60ff.
- Vgl. auch den Versuch einer tabellarischen Übersicht am Ende dieses Beitrages (Tab. 5, S. ). Der gleichen Fragestellung wie dieser Beitrag widmet sich mit etwas anderem Zugriff und skeptischem Ergebnis ob der Möglichkeit einer Theorie historisch-politischen Lernens zuletzt HEDTKE, REINHOLD (2003)
- LANGE, DIRK (2002): Die Alltagsgeschichte in der historisch-politischen Didaktik. Zur politischen Relevanz alltagsorientierten Lernens. (online unter: http://www.diss.fu-berlin.de/2002/116/; gelesen am 16.1.2003). Die Buchfassung: LANGE, DIRK (2004): Die historisch-politische Didaktik: Zur Begründung historisch-politischen Lernens. ist mir erst heute zugänglich geworden.
- CAMERER, JOHANN FRIEDRICH (1758)
- 1832/33-1836 erschienen in Berlin bei Duncker & Humblot.
- Historisch-politische Blätter für das katholische Deutschland. München: Riedel, 1838-1923.
- KÖRBER, ANDREAS (1999): Gustav Stresemann als Europäer, Patriot, Wegbereiter und potentieller Verhinderer Hitlers: historisch-politische Sinnbildungen in der öffentlichen Erinnerung.
- KUTZ, MARTIN (1997)
- OEHLER, KATHERINA (1997)
- MICKEL, WOLFGANG W. (1999; Hg.)
- Vgl. SCHÖRKEN, ROLF (1978)
- Als ein Beispiel zitiert SCHULZ-HAGELEIT, PETER (1978), S. 307, Manfred Messerschmidt.
- Vgl. PANDEL, HANS-JÜRGEN (2001). In: sowi-onlinejournal 1/2001 (http://www.sowi-onlinejournal.de/2001-1/pandel.htm; zuletzt gelesen 3.2.2002).
- Die Bezeichnung "Zahnrad"-Methode stammt von ROLF SCHÖRKEN (1978, wie Anm.), S. 12; der Begriff "Sehschlitz"-Methode stammt von ERICH KOSTHORST und KARL-ERNST JEISMANN und wird ebda, S. 13 berichtet; die Bezeichnung "Puzzle"-Theorie bei PANDEL (2001), Abschn. 1 (1).
- JEISMANN, KARL-ERNST (1978)
- Vgl. JUNG, HORST W.; STAEHR, GERDA VON (1983): Historisches Lernen. Didaktik der Geschichte; JUNG, HORST WILHELM; STAEHR, GERDA V. (1999; Hg.): Historisch-politisches Lehren und Lernen. Geschichte - Standpunkte - Erfahrungen
- Vgl. dazu auch PANDEL (2001), Abschn. 1 (1).
- Vgl. JEISMANN (1978), S. 22f. Vgl. auch Tab 1.
- JEISMANN (1978), S. 22f, hier S. 37 ff.
- JEISMANN (1978), S. 31. Unter der Hand scheint JEISMANN hingegen die Funktion des historischen Denkens noch stärker in der Gegenwart anzusiedeln, als er ausdrücklich zugibt. Er nennt das Verhältnis von Sozialwissenschaften bzw. Politikunterricht und Geschichtsunterricht "komplementär", nachdem er ihnen unterschiedliche Erkenntnisrichtungen zugeschrieben hat. Bei ersteren sei der Blick auf vergangene Zustände instrumentell für die bessere Erkenntnis der Gegenwart. Demnach müsste die Beschreibung des Zwecks des historischen Denkens derart vermutet werden, dass hier die Erkenntnis der Gegenwart (z.B. das Wissen um politische Kategorien der Gegenwart) ein Instrument für eine bessere Erfassung der Vergangenheit sei. Demgegenüber Jeismann wörtlich: "So wichtig es ist, in der Geschichte Erklärungen für unmittelbare Erfahrungen in der Gegenwart zu suchen, so unerläßlich ist es für historische Bildung, durch Rekonstruktion von Vergangenheit auch die Möglichkeiten für die Wahrnehmung der eigenen Gegenwart zu verbreitern und zu vertiefen." ... "für die Wahrnehmung der eigenen Gegenwart" - dies ist wieder die gleiche Erkenntnisrichtung.
- Ähnlich auch PANDEL, HANS-JÜRGEN (1997). Vgl. dazu nun auch HEDTKE (2003), S. 120.
- Zu den Sinnbildungstypen vgl. RÜSEN, JÖRN (1983); sodann RÜSEN, JÖRN (1990). Eine Modifikation und Ergänzung der Sinnbildungstypenlehre hat jüngst HANS-JÜRGEN PANDEL vorgeschlagen: PANDEL, HANS-JÜRGEN (2002).
- RÜSEN, JÖRN (1989)
- RÜSEN (1989), S. 121.
- RÜSEN (1989), S. 122.
- RÜSEN (1989), S. 122.
- Vgl. hierzu auch LANGE (2002), S. 153ff.
- Vgl. JAEGER, FRIEDRICH: "Geschichte als Orientierungswissen. Lebenspraktische Herausforderungen und Funktionen des historischen Denkens." Vortrag auf dem Historikertag 2000 in Aachen. Nachdem die Publikation des Bandes über die betreffende Sektion im Frühjahr 2004 gescheitert ist, ist mir ein Druckort dieses Vortrages nicht bekannt.
- LANGE (2002), S. 243. Ob es immer "Deprivation" sein muss, die das Politische in Gange setzt, sei in diesem Zusammenhang dahin gestellt. Wenn dem so wäre, würden privilegierte Menschen nicht politisch denken und lernen können. Es muss also entweder auch andere lernauslösende Erfahrungen mit der Kategorie "Macht" geben (Machtlust, Deprivationsangst), oder aber es ist anzuerkennen, dass nicht nur letztlich den eigenen Status im Vergleich zu anderen reflektierende Erfahrungen, sondern auch ehrliche altruistische Sorge um das "Gemeinwohl" politisches Lernen und Denken anstoßen kann.
- Für die Kritik am "Fachprinzip" vgl. HUBER, LUDWIG (2001)
- Diese Bezeichnung verwendet PANDEL nicht.
- PANDEL (2001).
- HEDTKE (2003), S. 120.
- HEDTKE (2003), S. 118ff.
- Vgl. dazu zuletzt KUSS, HORST (2004)
- LANGE (2002), S. 153ff. Er referiert drei andere Unterteilungen, die abzulehnen seien, nämlich die schon besprochene Differenzierung in eine vergangenheitsorientierte Geschichts- und eine gegenwartszentrierte Politikwissenschaft, eine an der Wissenschaft orientierte Geschichtsdidaktik versus einer schülerorientierten Politikdidaktik sowie die Unterscheidung von historischem Denken und politischem Handeln.
- LANGE (2002), S. 159.
- LANGE (2002), S. 159.
- LANGE (2002), S. 160.
- LANGE (2002), S. 166ff.
- LANGE (2002), S. 189.
- LANGE (2002), S. 194ff.
- LANGE (2002), S. 198-207.
- LANGE (2002), S. 208ff.
- LANGE (2002), S. 231.
- LANGE (2002), S. 257.
- LANGE (2002), S. 259.
- KÖRBER, ANDREAS (1999).
- Vgl. den Untertitel: RÜSEN, JÖRN (1994), Historische Orientierung. Über die Arbeit des Geschichtsbewußtseins, sich in der Zeit zurechtzufinden.
- Zum Kulturvergleich im historischen Denken vgl. u.a. RÜSEN, JÖRN (1998); zum interkulturellen historischen Lernen ALAVI, BETTINA(1998); KÖRBER, ANDREAS (2001; Hg.).
- Vgl. zur Unterscheidung von Re- und De-Konstruktion als Grundoperationen des historischen Denkens die Arbeiten aus dem Projekt "FUER Geschichtsbewusstsein", bes. HASBERG, WOLFGANG; KÖRBER, ANDREAS (2003).
Literatur
Alavi, Bettina (1998): Geschichtsunterricht in der multiethnischen Gesellschaft. Eine fachdidaktische Studie zur Modifikation des Geschichtsunterrichts aufgrund migrationsbedingter Veränderungen. Frankfurt am Main: IKO - Verlag für interkulturelle Kommunikation (Interdisziplinäre Studien zum Verhältnis von Migrationen, Ethnizität und gesellschaftlicher Multikulturalität; 9)
Camerer, Johann Friedrich (1758): Vermischte historisch-politische Nachrichten in Briefen von einigen merkwürdigen Gegenden der Herzogthümer Schleßwig und Hollstein, ihrer natürlichen Geschichte und andern seltenen Alterthümern. Flensburg und Leipzig sowie Leipzig.
Hasberg, Wolfgang; Körber, Andreas (2003): Geschichtsbewusstsein dynamisch. In: Körber, Andreas (Hg.): Geschichte - Leben - Lernen. Bodo von Borries zum 60. Geburtstag. Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag (Forum Historisches Lernen), S. 179-203.
Hedtke, Reinhold (2003): Historisch-politische Bildung - ein Exempel für das überholte Selbstverständnis der Fachdidaktiken. In: Politisches Lernen 21, 1-2; S. 112-122.
Huber, Ludwig (2001): Stichwort: Fachliches Lernen. Das Fachprinzip in der Kritik. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 2001, 3; S. 307-331.
Jeismann, Karl-Ernst (1978): Historischer und politischer Unterricht. Bedingungen und Möglichkeiten curricularer und praktischer Koordination. In: Schörken, Rolf (Hg.): Zur Zusammenarbeit von Geschichts- und Politikunterricht. Stuttgart: Klett (Anmerkungen und Argumente zur historischen und politischen Bildung; Bd. 20), S. 14-71.
Jung, Horst W.; Staehr, Gerda von (1983): Historisches Lernen. Didaktik der Geschichte. Köln: Pahl-Rugenstein (Erziehung und Bildung).
Jung, Horst W.; Staehr, Gerda von (1999; Hg.): Historisch-politisches Lehren und Lernen. Geschichte - Standpunkte - Erfahrungen. Hamburg: Lit (Didaktik;6).
Körber, Andreas (1999): Gustav Stresemann als Europäer, Patriot, Wegbereiter und potentieller Verhinderer Hitlers. Historisch-politische Sinnbildungen in der öffentlichen Erinnerung. Hamburg: Krämer (Beiträge zur deutschen und europäischen Geschichte; 25).
Körber, Andreas (2001; Hg.): Interkulturelles Geschichtslernen. Geschichtsunterricht unter den Bedingungen von Einwanderung und Globalisierung. Konzeptionelle Überlegungen und praktische Ansätze. 1. Aufl.; Münster: Waxmann (Novemberakademie;2).
Kuss, Horst (2004): Wie und wozu wird Geschichte gelernt? Fragestellungen geschichtsdidaktischer Forschung. Ein Bericht. In: Geschichte, Politik und ihre Didaktik 32, 1/2; S. 17-30.
Kutz, Martin (1997): Historisch-politische Bildung in der Bundeswehr. In: Bergmann, Klaus; Fröhlich, Klaus; Kuhn, Annette; Rüsen, Jörn (Hg.): Handbuch der Geschichtsdidaktik. 5., überarb. Aufl.; Seelze-Velber: Kallmeyer, S. 567-571.
Lange, Dirk (2002): Die Alltagsgeschichte in der historisch-politischen Didaktik. Zur politischen Relevanz alltagsorientierten Lernens. Berlin: F.U. Berlin; FB Sozialwissenschaften, Otto-Suhr-Institut: (Diss.). 425 S.
Lange, Dirk (2004): Die historisch-politische Didaktik: Zur Begründung historisch-politischen Lernens. 1. Aufl.; Schwalbach am Taunus: Wochenschau-Verlag (Studien zu Politik und Wissenschaft).
Mickel, Wolfgang W. (1999; Hg.): Handbuch zur politischen Bildung. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung (Schriftenreihe; Bd. 358) sowie Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag.
Oehler, Katherina (1997): Geschichte und politische Praxis. In: Bergmann, Klaus; Fröhlich, Klaus; Kuhn, Annette; Rüsen, Jörn (Hg.): Handbuch der Geschichtsdidaktik. Seelze-Velber: Kallmeyer, S. 767-771.
Pandel, Hans-Jürgen (1997): Geschichte und politische Bildung. In: Bergmann, Klaus; Fröhlich, Klaus; Kuhn, Annette; Rüsen, Jörn (Hg.): Handbuch der Geschichtsdidaktik. 5. Aufl. Seelze-Velber: Kallmeyer; S. 319-323.
Pandel, Hans-Jürgen (2001): Fachübergreifendes Lernen. Artefakt oder Notwendigkeit? In: sowi-onlinejournal 1/2001 (http://www.sowi-onlinejournal.de/2001-1/pandel.htm).
Pandel, Hans-Jürgen (2002): Erzählen und Erzählakte. Neuere Entwicklungen in der didaktischen Erzähltheorie. In: Demantowsky, Marco; Schönemann, Bernd (Hg.): Neuere geschichtsdidaktische Positionen. Bochum: Projekt-Verlag (Dortmunder Arbeiten zur Schulgeschichte zur und historischen Didaktik;32); S. 39-56.
Rüsen, Jörn (1983): Historische Vernunft. Grundzüge einer Historik I: Die Grundlagen der Geschichtswissenschaft. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (Kleine Vandenhoeck-Reihe; 1489).
Rüsen, Jörn (1989): Historisch-politisches Bewußtsein - was ist das?. In: Cremer, Will; Commichau, Imke (1989; Hg.): Bundesrepublik Deutschland. Geschichte, Bewußtsein. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung; S. 119-141.
Rüsen, Jörn (1990): Die vier Typen des historischen Erzählens. In: Rüsen, Jörn (Hg.): Zeit und Sinn. Strategien historischen Denkens. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag; S. 153-230.
Rüsen, Jörn (1994): Historische Orientierung. Über die Arbeit des Geschichtsbewußtseins, sich in der Zeit zurechtzufinden, Köln, Wien, Weimar: Böhlau.
Rüsen, Jörn (1996): Historische Sinnbildung durch Erzählen. In: Internationale Schulbuchforschung 18, 4, S. 501-543.
Rüsen, Jörn (1998): "Einleitung: Für eine interkulturelle Kommunikation in der Geschichte. Die Herausforderung des Ethnozentrismus in der Moderne und die Antwort der Kulturwissenschaften." In: Rüsen, Jörn; Gottlob, Michael; Mittag, Achim (Hg.): Die Vielfalt der Kulturen. Erinnerung, Geschichte, Identität 4. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag (suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 1405; S. 12-36.
Rüsen, Jörn (2000): Zerbrechende Zeit. Über den Sinn der Geschichte. Köln, Weimar, Wien: Böhlau.
Sander, Wolfgang (1997; Hg.): Handbuch politische Bildung. Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag (Reihe Politik und Bildung; 11).
Schörken, Rolf (1978): Zur Einführung: Von der Notwendigkeit,, erneut über die Zusammenarbeit von Geschichts- und Politikunterricht nachzudenken. In: Schörken, Rolf (Hg.): Zur Zusammenarbeit von Geschichts- und Politikunterricht. Stuttgart: Klett (Anmerkungen und Argumente zur historischen und politischen Bildung; 20); S. 9-13.
Schulz-Hageleit, Peter (1978): Zehn Thesen zum Verhältnis von historischer und politischer 'Bildung'. In: Schörken, Rolf (Hg.): Zur Zusammenarbeit von Geschichts- und Politikunterricht. Stuttgart: Klett (Anmerkungen und Argumente zur historischen und politischen Bildung; 20); S. 295-315.
Lange, Dirk (2004): Zwischen Politikgeschichte und Geschichtspolitik. Grundformen historisch-politischen Lernens
Politics without history has no roots, history without politics bears no fruits. Wer nach der Beziehungshaltigkeit von Politik und Geschichte fragt, entdeckt bald, dass zwischen beiden eine geradezu symbiotische Abhängigkeit besteht. Denn wer sich historisch schult wird auch die politische Dimension in der Geschichte berücksichtigen und wer sich politisch bildet kann historisch-genetische Faktoren aktueller Problemstellungen nicht vernachlässigen (2). Der Umstand, dass Politik ein Teil von Geschichte und Geschichte ein Teil von Politik ist, hat seit jeher Konsequenzen für die Reflexion sowohl des historischen und als auch des politischen Lernens (3).
Heute werden die Bezüge zwischen Geschichts- und Politikdidaktik maßgeblich von historischer Seite reflektiert (4) und nur selten aus politischer Perspektive (5). Jedoch liegt derzeit keine explizite Konzeption der historisch-politischen Didaktik vor, die sowohl den geschichts- als auch den politikdidaktischen Diskurs integriert. Im Folgenden soll ein solcher Ansatz begründet werden, indem das historisch-politische Lernen im Spannungsfeld von Politikgeschichte und Geschichtspolitik konzipiert wird.
Zunächst wird erörtert, wie sich die Kooperation von Geschichts- und Politikdidaktik entwickelt hat. Für die weitere Konzeption wird davon ausgegangen, dass sich Gegenstand der historisch-politischen Didaktik als ein Korrelationsbereich beschreiben lässt, in dem zwei eigenständige Erkenntnisweisen zusammen wirken. Mit dem Geschichts- und dem Politikbewusstsein werden die jeweiligen disziplinären Grundkategorien eingeführt. Sie können als Teilsysteme eine übergeordneten Gesellschaftsbewusstsein begriffen werden (6). Die historische und die politische Sinnbildungstätigkeit verschränken sich im historisch-politischen Bewusstsein. Als die beiden Grundformen historisch-politischen Lernens lassen sich das politikgeschichtliche und das geschichtspolitische Lernen identifizieren.
1. Die Kooperation von Geschichts- und Politikdidaktik im Wandel
Sowohl in der Geschichts- als auch der Politikdidaktik gab es Bestrebungen die jeweils andere Erkenntnisweise (und damit auch das Unterrichtsfach) in die eigenen Perspektive zu integrieren. Lange Zeit beanspruchte der Geschichtsunterricht den Alleinvertretungsanspruch für die politischen Erziehung. Entwicklungspsychologische Überlegungen ließen fraglich erscheinen, ob Schülerinnen und Schülern überhaupt primäre Erfahrungen im politischen Handlungsfeld machen können. Dieser Umstand rechtfertigte die zentrale Bedeutung des Geschichtsunterrichts für das politische Lernen. Denn die Beispiele aus der Politikgeschichte wurden als ein 'sekundäres Erfahrungsfeld' verstanden, an dem politisches Denken und Handeln nachvollzogen werden konnte (7). Das historische Integrationsmodell dominierte die historisch-politische Didaktik bis in die siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts (8).
Mit dem Aufschwung der Sozialwissenschaften gewann das politische Integrationsmodell an Bedeutung. Es ging davon aus, dass Geschichte hinreichend an den historischen Aspekten des aktuell Politischen erlernt werden könne. Durch die Untersuchung der historischen Entwicklung von und durch die Reflexion historischer Analogien zu gegenwärtigen politischen Problemlagen impliziere der Politikunterricht das historische Denken, so dass ein eigenes Lernfach Geschichte letztlich unnötig sei (9).
Die Möglichkeit, "den Geschichtsunterricht in den Sozialkundeunterricht zu integrieren" (10) beziehungsweise die "Gemeinschaftskunde und den Geschichtsunterricht [...] zusammenzubinden" (11) dominiert nun die Diskussion um die historisch-politische Didaktik. Öffentliches Aufsehen erregte diese Entwicklung mit den "Hessischen Rahmenrichtlinien für Gesellschaftslehre" im Jahr 1972. Geschichte sollte sich nunmehr durch den "Nachweis ihrer Beziehung zu den jeweils relevanten politisch-gesellschaftlichen Problemen" (12) legitimieren.
Das Integrationsmodell (in seiner historischen wie in seiner politischen Variante) reduzierte das jeweils anderen Faches auf einen Aspekt der eigenen Disziplin. Das Historisch-Politische unterlag dabei der Hegemonie entweder der Geschichts- oder der Politikdidaktik. Von diesem Modell sind Bemühungen zu unterscheiden, die historisch-politische Didaktik additiv als Summe des historischen und des politischen Lernfeldes zu konzeptualisieren. Demnach basiere die historisch-politische Didaktik auf der Eigenständigkeit von zwei Frageweisen, die ihren je eigenen Beitrag zur Erkenntnis der sozialen Wirklichkeit leisten können (13). Das kooperative Modell der historisch-politischen Didaktik gewann in Nordrhein-Westfalen Einfluss auf das Unterrichtsfach Politik (1973) und die "Richtlinien Politik". Im Zuge dieser Entwicklung wurde der klassische Inhaltskanon beider Fächer zurück gedrängt. Geschichte und Politik kooperierten nunmehr zu Gunsten eines fächerübergreifenden Curricularkonzepts (14).
Sowohl die Unterordnung unter eine politologisch-sozialwissenschaftliche Perspektive als auch die Aufhebung in ein fachübergreifendes Curriculum stellte die Zukunft des Geschichtsunterrichts in Frage (15). Erst im Laufe der 70er Jahren entwickelte die Geschichtsdidaktik ein neues Selbstbewusstsein, das sich auch in der Diskussion der historisch-politischen Zusammenarbeit spiegelt (16). Grundlegend dafür war die Kategorie des 'Geschichtsbewusstseins' (17). Seither begreift sich die Geschichtsdidaktik als wissenschaftliche Disziplin, "die über Bildungs- und Selbstbildungsprozesse, Lehr- und Lernprozesse an und durch Geschichte nachdenkt und damit die Entstehung, Beschaffenheit, Funktion und Beeinflussung von Geschichtsbewusstsein im gesellschaftlichen und historischen Zusammenhang thematisiert" (18).
Ausgehend von dieser disziplinären Grundlegung wurde auch die Zusammenarbeit mir der Politikdidaktik neu gedacht. Dabei gewann das korrelative Modell der historisch-politischen Didaktik an Bedeutung. Dieses stellt die historische und die politische Perspektive nicht nur nebeneinander, sondern verweist sie zugleich aufeinander. Das Historische wird als ein Bestandteil des Politischen und das Politische als ein Aspekt des Historischen betrachtet (19). Trotzdem gehen die Perspektiven nicht ineinander auf. Für die historisch-politische Didaktik tritt somit die Koordination der beiden Lernbereiche in den Vordergrund. Im Schnittbereich bereichern sich die Inhalte und Erkenntnisinteressen einer sozialwissenschaftlich orientierte Geschichtsdidaktik und eine historisch orientierte Politikdidaktik gegenseitig.
Wenn sich der Reflexionsgegenstand der historisch-politischen Didaktik im Überschneidungsfeld der beiden Fachperspektiven befindet, dann ist es sinnvoll mit dem Geschichts- und dem Politikbewusstsein zunächst deren disziplinären Gegenstände zu erörtern. In der Geschichtsdidaktik nimmt die Bewusstseinskategorie eine zentrale Position ein. Das Geschichtsbewusstsein ist zu einem disziplinären Schlüsselbegriff geworden, über den es gelungen ist, die Krisenerscheinungen der sechziger und siebziger Jahre zu überwinden und unterschiedliche fachliche Perspektiven zu integrieren. In der Politikdidaktik konnte die Diskussion des Politikbewusstseins noch keine vergleichbare Dynamik entwickeln.
2. Geschichtsbewusstsein
Das Geschichtsbewusstsein bezeichnet die geistige Fähigkeit, gegenwärtige soziale Formationen als zeitgebunden betrachten zu können. Außerdem ist die "Sorge um die Zukunft" als ein "wesentlicher Antrieb zur Bildung eines 'geschichtlichen Bewusstseins'" (20) zu begreifen. Die Kategorie des Geschichtsbewusstseins verweist die Geschichtsdidaktik auf den "Zusammenhang von Vergangenheitsdeutung, Gegenwartsverständnis und Zukunftserwartung" (21) . Dadurch wird die Geschichte aus ihrer Fixierung auf die Vergangenheit gelöst und als Denktätigkeit der Gegenwart vorstellbar. Die Eigenart des "Geschichtsbewusstseins" ist nicht mehr in dem Bemühen um "Erkennen der Vergangenheit, sondern in der Verzeitlichung der Vergangenheit" zu sehen, die einem "Interesse an Zukunft folgt" (22) . Die Grundfigur historischen Denkens weist somit über das Vergangene hinaus und ist gegenwarts- und zukunftsbezogen.
In dieser allgemeinen Form lässt sich das Geschichtsbewusstsein als ein Ensemble von "Vorstellungen über Vergangenheit" (23) begreifen. Damit erfasst die Kategorie den Umstand, dass Geschichte nicht in der Rekonstruktion vergangener Wirklichkeit aufgeht, sondern immer "auch das Bild [ist], das sich Menschen von ihr machen" (24) . Ganz allgemein bezeichnet Geschichtsbewusstsein also die Kompetenz, "die der Orientierung in den zeitlichen Veränderungen unseres Lebens und unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit dienlich ist" (25) . Erinnerungen an die Vergangenheit werden gedeutet, um die Lebenspraxis zu perspektivieren.
Davon ausgehend, dass die allgemeine Funktion des Bewusstseins die Produktion von Sinn ist, lässt sich konkretisieren, dass "historisches Denken [...] aus Zeit Sinn [macht]" (26) . Die historische Sinnbildung stellt diejenige Tätigkeit des Bewusstseins dar, die Erinnerungen an die Vergangenheit verzeitlicht. Im Prozess der Verzeitlichung werden Zeitzusammenhänge in Sinnzusammenhänge transformiert. Das Geschichtsbewusstsein strukturiert die Denkprozesse, die aus Zeit Sinn machen.
Jörn Rüsen begreift diese Bewusstseinstätigkeit als 'historisches Erzählen'. Historisches Erzählen drückt sich in der Tätigkeit aus, die Erfahrungen der Vergangenheit in der Gegenwart so zu deuten, dass Zukunft als Handlungsperspektive erschlossen wird (27). In diesem Sinn ist das historische Erzählen die das Geschichtsbewusstsein konstituierende Grundoperation. Es ist eine Form des Denkens, die es überhaupt erst rechtfertigt, historisches Bewusstsein als einen Teilbereich des allgemeinen Bewusstseins zu spezifizieren (28).
Historisches Lernen lässt sich demnach nicht als eine analoge Übernahme von historischem Wissen begreifen. Vielmehr werden durch die Auseinandersetzung mit vergangenheitsbezogenen Inhalten, spezifische historische Sinnbildungskompetenzen entwickelt (29). Historisches Lernen entwickelt eine mentale Bewusstseinsstruktur, die Vergangenheitserinnerung mit Sinnbezügen zur gegenwärtigen Problembewältigung auflädt.
3. Das Politikbewusstsein
Während sich die Geschichtsdidaktik mit Hilfe der Bewusstseinskategorie bereits zu einer Wissenschaft vom historischen Lernen erweitert hat, befindet sich die Politikdidaktik noch auf dem Weg zu einer eigenständigen Wissenschaftsdisziplin (30). Noch viel zu oft wird sie als eine Didaktik ausschließlich intendierter politischer Bildungsprozesse begriffen. Etwa wenn festgestellt wird, dass "politische Bildung [...] nicht Wissenschaft, sondern pädagogische bzw. andragogische Praxis" (31) sei. Demnach bediene sich die Politikdidaktik zwar wissenschaftlicher Erkenntnisse, verfüge als "Zwischenhandel" (32) aber selbst über keinen eigenständigen Forschungsgegenstand.
Eine entfaltete Konzeption des Politikbewusstseins kann dazu beitragen, dass sich die Politikdidaktik zu einer Wissenschaft des politischen Lernens weiter entwickelt. Die Kategorie 'Politikbewusstsein' hat das Potenzial, die unterschiedlichen politikdidaktischen Zugänge zu bündeln und dadurch zu einem Zentralbegriff der Politikdidaktik zu avancieren (33) .
Politik transformiert Individualinteressen in allgemeine Verbindlichkeit. Politische Herrschaft stellt eine Institutionalisierung dieses Vorgangs dar. Demzufolge lässt sich das Politikbewusstsein als derjenige Teilbereich des allgemeinen Bewusstseins verstehen, in dem der Mensch subjektive Vorstellungen über diesen Transformationsprozess aufbaut. Das Politikbewusstsein produziert Vorstellungen über politische Herrschaft. Politisches Denken bildet also nicht tatsächliche politische Herrschaftsstrukturen ab, sondern entwickelt konzeptuelles Deutungswissen (34) , welches den Prozess der Herstellung von kollektiver Verbindlichkeit subjektiv erklärbar und kritisierbar macht.
Als Politikbewusstsein kann derjenige Bereich des menschlichen Bewusstseins angesehen werden, in dem Vorstellungen über Politik aufgebaut werden. Im Politikbewusstsein reduziert der Mensch die komplexe politische Wirklichkeit in Sinnzusammenhänge. Als Politikvorstellungen entstehen subjektive Muster, durch die politische Denk- und Handlungsformen strukturiert werden (35). Das Politikbewusstsein verschafft dem Menschen Orientierungs- und Handlungssicherheit, indem es Vorstellungen über die Legitimität des Herstellungsprozesses von allgemeinen Verbindlichkeiten entwickelt.
Das Legitimieren ist die innere Logik, welche das politische Denken als einen Spezialfall des allgemeinen Denkens charakterisiert. Politisches Denken erzeugt eine "Vorstellung vom Bestehen einer legitimen Ordnung" (36) . Das Legitimieren ist ein Erklärungs- und Rechtfertigungsvorgang zugleich. Im Politikbewusstsein entwickelt der Mensch sowohl seine Vorstellungen über das Zustandekommen von allgemein verbindlichen Regelungen als auch über die Anerkennungswürdigkeit von politischer Herrschaft. Der Glaube "an tatsächlich geltende oder gelten sollende Normen und Herrschaftsverhältnisse von Menschen über Menschen" (37) ist der Kern des Politikbewusstseins.
4. Historisch-politisches Bewusstsein
Geschichte und Politik lassen sich jeweils als Prozesse der Sinnbildung begreifen. Historische Sinnbildung entwickelt Zeitverlaufsvorstellungen, um Fragen an die Gegenwart durch Vergangenheitserinnerungen zukunftsfähig zu beantworten. Politische Sinnbildung entwickelt Herrschaftsvorstellungen, um den Transformationsprozess von individuellen Interessen in allgemeine Verbindlichkeit zu erklären. Das Geschichts- beziehungsweise das Politikbewusstsein bezeichnet mentale Teilstrukturen, die sich durch diese Denkprozesse aufbauen. Als Bereiche des allgemeinen Bewusstseins strukturieren sie die subjektive Konstruktion historischer und politischer Wirklichkeit. Geschichtsbewusstsein gibt kontingenter Zeiterfahrung Sinn. Das Politikbewusstsein macht Herrschaftsansprüche legitim.
In der Schnittmenge der beiden Fachperspektiven konstituiert sich mit dem historisch-politischen Bewusstsein das Reflexionsfeld der historisch-politischen Didaktik. Diese interessiert sich für die subjektiven Vorstellungen von der historisch-politischen Wirklichkeit als Ausgangspunkte und Ergebnisse von Lernprozessen.
Das historisch-politische Bewusstsein ist nicht statisch. Die durch Denkbewegungen aufgebauten Vorstellungen von der Wirklichkeit sind prozessual und werden beständig verändert oder bestätigt. Diese Bewusstseinsmobilität lässt sich als ein historisch-politischer Lernprozess verstehen, durch den sich die mentalen Strukturen permanent erweitern und umstrukturieren. Solange die Bewusstseinskapazitäten es erlauben, werden neue Erkenntnisse in die vorhandenen Schemata integriert. Sobald die historisch-politischen Erfahrungen nicht mehr assimiliert werden können werden die Denkfiguren grundlegend erneuert. Diese Konstruktivität macht das historisch-politische Bewusstsein lerntheoretisch relevant. Da der Wandel der mentalen Strukturen als eine Wirkung von Lernprozessen begriffen werden kann, stellt das historisch-politische Bewusstsein den zentralen Reflexionsgegenstand der historisch-politischen Didaktik dar.
Ausgehend vom Geschichts- und Politikbewusstsein lässt sich das historisch-politische Bewusstsein durch zwei differente Bezugnahmen entwickeln. Aus der Sicht des Geschichtsbewusstsein konstituiert sich historisch-politisches Bewusstsein als ein Überschneidungsfeld, in dem historisches Denken auf einen politischen Gegenstand bezogen wird. Als Teilstruktur des Geschichtsbewusstseins entsteht ein politikgeschichtliches Bewusstsein. In der Perspektive des Politikbewusstseins bildet sich das historisch-politische Bewusstsein, indem politisches Denken auf einen historischen Gegenstand gerichtet wird. So entsteht als Teilstruktur des Politikbewusstseins geschichtspolitisches Bewusstsein. Das historisch-politische Bewusstsein setzt sich aus den politikgeschichtlichen und den geschichtspolitischen Denkstrukturen zusammen.
5. Politikgeschichtliches Lernen
Im Geschichtsbewusstsein perspektivieren sinnhafte Zeitzusammenhänge die menschliche Lebenspraxis. Mit dem politikgeschichtlichen Bewusstsein prägt das Geschichtsbewusstsein jenen Teilbereich aus, in dem sich das historische Denken mit Fragen der Herrschaftslegitimation befasst. Politikgeschichtliches Denken verleiht den Vorstellungen von der Transformation individuellen Interesses in kollektive Verbindlichkeit eine zeitliche Kontinuität.
Jede politische Herrschaft muss den Nachweis erbringen, dass sie in der Lage ist, für eine ungewisse Zukunft kollektive Verbindlichkeit herzustellen. Die Argumentation mit Geschichte verschafft der Politik eine scheinbare Sicherheit. Der Verweis auf die historische Wirklichkeit soll politische Herrschaft auch für die Gestaltung zukünftiger Wirklichkeit legitimieren. Politikgeschichtliche Sinnbildung legitimiert Herrschaft, indem sie diese als ein Kontinuum darstellt. Die Erinnerung an die Vergangenheit wird so verzeitlicht, dass sie als Garant für die sinnhafte Erwartung der Zukunft dient.
Politikgeschichtliches Lernen findet statt, wenn sich Bewusstseinsstrukturen bilden, die Zeitzusammenhänge so sinnhaft machen, dass politische Herrschaft anerkennungswürdig beziehungsweise kritisierbar wird. Politikgeschichtliches Lernen lässt sich danach unterscheiden, wie der Zeitzusammenhang zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft modelliert wird. Karl-Ernst Jeismann hat hierfür eine Unterscheidung der Denkoperationen vorgeschlagen (38). Er begreift historisches Lernen als eine Stufenfolge, die bei der "Wahrnehmung, Unterscheidung, Einordnung von Phänomenen" ansetzt und über die "Bedeutungszumessung und Beurteilung" bis hin zu "Wertungen und Einstellungen [reicht; D.L.] [...], die als Konsequenz bestimmte Verhaltensweisen nach sich ziehen" (39). Jörn Rüsen hat das Modell erzähltheoretisch erweitert. Ausgehend von der Erkenntnis, dass 'Erzählen aus Zeit Sinn macht' hat er mit dem traditionalen, exemplarischen, kritischen und genetischen Erzählen vier Sinnbildungsformen entwickelt (40).
In den folgenden Überlegungen wird das historische Lernen zeittypologisch unterschieden. Die Focusverlagerung auf die Zeit bleibt dem erzähltheoretischen Ausgangspunkt, dass historisches Denken Zeitzusammenhänge sinnhaft macht, verhaftet. Sie begreift als maßgebliches Sinnbildungskriterium jedoch nicht mehr die Form des Erzählens, sondern die Struktur von Zeitverlaufsvorstellungen, durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einen Zusammenhang gebracht werden (41). Als Grundformen politikgeschichtlichen Lernens können dann ein zirkulärer, ein linearer und ein punktueller Typus unterschieden werden.
Durch zirkuläres politikgeschichtliches Lernen wird die Kompetenz erworben, politische Herrschaft durch ihr Überdauern im Wandel der Zeit zu legitimieren. Es wird die Denkfähigkeit erworben, politische Vorstellungen zustimmungswürdig zu machen, indem sie als 'Schon-Immer-So' dargestellt werden. Hierzu wird die Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft so in Übereinstimmung gebracht, dass politische Herrschaft als zeitübergreifend vorgestellt werden kann. In dieser Form politikgeschichtlichen Lernens wird der Wandel politischer Systeme als eine Oberflächenerscheinung interpretiert, unter der das Wesen althergebrachter Herrschaft überdauert. "Zeit wird als Sinn verewigt" (42) .
Durch zirkuläres politikgeschichtliches Lernen können Denkprozesse erlernt werden, die politische Herrschaft als ein überzeitliches Phänomen begreifen, das als solches schon immer anerkennungswürdig war. Der Zeitzusammenhang zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft wird dabei so versinnlicht, dass Herrschaft letztlich als wesenhaft und unhistorisch erscheint. In dieser Denkfigur wird eine politische Ordnung durch den Bezug auf Traditionen anerkennungswürdig gemacht. Die Denkstrukturen im politikgeschichtlichen Bewusstseinsbereich werden so eingerichtet, dass Herrschaft durch zirkuläre historische Sinnbildungen legitimiert werden kann. Der historisch-politische Lernende entwickelt die Kompetenz, Politikvorstellungen zeitlich zu überliefern.
Zudem können durch zirkuläres politikgeschichtliches Lernen grundlegende und zeitübergreifende Einsichten gewonnen werden. Bei der Erinnerung an Vergangenes stehen dann nicht mehr die konkreten historischen Ereignisse und Bedingungen im Vordergrund. Vielmehr dient die Rekonstruktion von vergangenen Erfahrungen der Begründung und Entwicklung allgemeiner Prinzipien. Die Geschichte wird vergegenwärtigt, da sie Ereignisse repräsentiert, aus denen der Sinn und die Bedeutung grundsätzlicher Werte abgeleitet werden können (43).
Durch lineares politikgeschichtliches Lernen wird die Kompetenz erworben, politische Herrschaft durch ihre Entwicklung im Wandel der Zeit zu legitimieren. Es wird gelernt Herrschaft entwicklungslogisch darstellen. Dafür werden Zeitzusammenhänge so strukturiert, dass gegenwärtige und zukünftige Herrschaft als legitime Folge vergangener Herrschaft erscheint. Lineare politikgeschichtliche Kompetenz ermöglicht es, den Zeitverlauf als politisches Fortschreiten zu interpretieren. Politikvorstellungen werden legitimiert, indem sie als Fortschritt gegenüber früheren Herrschaftsformen gedeutet werden.
Durch den linearen Lerntypus wird die Denkfähigkeit erschlossen, die historische Prozesshaftigkeit als politische Legitimationsquelle zu nutzen. Politikgeschichtlich wird gelernt, wie politische Herrschaft in einen ursächlichen Zusammenhang zur Geschichte gestellt werden kann.
Durch punktuelles politikgeschichtliches Lernen wird die Kompetenz erworben, politische Herrschaft durch Momente aus dem Wandel der Zeit zu legitimieren. Dabei wird die Geschichte als Reservoir singulärer Erfahrungen genutzt, die als Analogien für gegenwärtige politische Probleme betrachtet werden. Der punktuelle Lerntypus entwickelt die Fähigkeit, Herrschaft durch den Vergleich mit historischen Beispielen zustimmungsfähig zu machen.
Punktuelles politikgeschichtliches Lernen entwickelt die Fähigkeit, politische Problemgehalte der Gegenwart mit Konstellationen früherer Epochen zu vergleichen. Die historischen Analogien zur politischen Gegenwart sind dabei nicht gleich, sondern vergleichbar. Punktuelle politikgeschichtliche Denkfähigkeit bezieht sich sowohl auf Ähnliches als auch auf Differentes. Durch politikgeschichtliches Lernen entsteht also auch die Fähigkeit, historische Erfahrungen als Alternativen zu gegenwärtigen Politikvorstellungen zu interpretieren (44). Die 'Geschichte historischer Verlierer' (Benjamin) sowie verebbte historische Prozesse und Institutionalisierungen können durch punktuelle Sinnbildungen für gegenwärtige politische Legitimationen genutzt werden.
Punktuelles politikgeschichtliches Lernen erschließt die denkstrukturelle Fähigkeit, durch zeitliches Vergleichen politische Herrschaft zu legitimieren beziehungsweise zu delegitimieren. Es wird gelernt, wie gegenwärtige Politikvorstellungen durch historische Analogien unterstützt beziehungsweise in Frage gestellt werden können.
6. Geschichtspolitisches Lernen
Im Politikbewusstsein werden Vorstellungen über die Genese von kollektiver Verbindlichkeit aufgebaut. Inhaltlich lässt es sich nach Feldern unterteilen, für die jeweils kollektive Verbindlichkeiten hergestellt wird. Neben Bereichen wie der Wirtschaftspolitik, Gesundheitspolitik, Umweltpolitik ist auch die Geschichtspolitik ein Politikfeld, in dem Individualinteressen in verbindliche Regelungen transformiert werden.
In einer differenzierten und pluralen Gesellschaft lässt sich auch aus der Geschichte keine homogene Identität mehr gewinnen. Verschiedene interessengeleitete Fraktionen konkurrieren darum, ihre Geschichtsdeutung allgemein verbindlich durchzusetzen. Geschichtspolitisch relevant sind "die Auseinandersetzungen um die Interpretation der Vergangenheit unter dem Aspekt von [...] Auseinandersetzungen um Geschichtsbilder und um Versuche, ein gleichsam 'kollektives' Geschichtsbewusstsein zu prägen" (45) .
Als geschichtspolitisches Bewusstsein kann damit der Teilbereich des Politikbewusstseins begriffen werden, der Vorstellungen darüber aufbaut, wie innerhalb einer sozialen Gruppe kollektiv verbindliche Geschichtsdeutungen hergestellt werden. Im geschichtspolitischen Bewusstsein befasst sich das politische Denken mit Geschichte. Es werden Vorstellungen davon entwickelt, wie partielle Geschichtsinterpretationen in allgemein verbindliche Geschichtsdeutungen transformiert werden. Dieser geschichtspolitische Prozess kann sowohl als autoritäre Durchsetzung eines Geschichtsbildes als auch als demokratisches Produkt pluraler Geschichtsdeutungen vorgestellt werden.
Durch geschichtspolitisches Lernen wird gelernt, wie der Prozess der Transformation von interessegebundenen Geschichtsbildern in kollektives Geschichtsbewusstsein anerkennungswürdig gemacht werden kann. Geschichtspolitisches Lernen entwickelt die Kompetenz, am politischen Streit um verbindliche Geschichtsdeutungen zu partizipieren. Die grundlegende Sinnbildungsform des geschichtspolitischen Lernens ist das Legitimieren. Die Besonderheit der geschichtspolitischen Legitimation liegt darin, dass sie innerhalb des Politikfeldes 'Geschichte' tätig ist. Es wird erlernt, Geschichtsdeutungen allgemein verbindlich zu machen.
Geschichtspolitisches Lernen lässt sich in einen autokratischen und einen demokratischen Lerntypus unterscheiden. Durch autokratisches geschichtspolitisches Lernen erlernt der Mensch, dass er unfähig ist, Geschichtsdeutungen zu produzieren, die allgemein bindend sein könnten. Es werden Legitimationsmuster erlernt, die es sinnvoll erscheinen lassen, dass kollektiv bindende Geschichtsvorstellungen von einer Minderheit entwickelt und von der Mehrheit übernommen werden. Autokratisches Lernen erschließt die Vorstellung, dass Geschichtsdeutungen historische Wahrheiten wiedergeben. Kollektive historische Identität erhält den Anschein der Natürlichkeit.
Durch demokratisches geschichtspolitisches Lernen erlernt der Mensch, dass er seine interessengebundenen Deutungen in den kollektiven Identitätsbildungsprozess einer sozialen Gruppe einbringen kann. Er entwickelt Denkstrukturen, durch welche die Beteiligung an der Verbindlichmachung von Geschichtsdeutungen legitimiert wird. Es wird gelernt, wie subjektive historische Sinnbildungen in den politischen Streit um die Deutung der Vergangenheit eingebracht werden können.
Durch demokratisches geschichtspolitisches Lernen entwickelt sich die Fähigkeit, Vergangenheitsdeutungen prüfend zu begegnen. Geschichtsvorstellungen, die als 'historische Wahrheit' präsentiert werden, können so als interessensgebundene Interpretationen verstanden werden (46). Die demokratische Sinnbildung erkennt die grundsätzliche Kontroversität möglicher Geschichtsdeutungen als Ausdruck pluraler gesellschaftlicher Interessen an. Demokratisches geschichtspolitisches Lernen immunisiert gegen Homogenitätsansprüche historischer Legitimation und Identifikation.
7. Historisch-politische Bildung
Historisch-politisches Lernen transformiert Erfahrungen mit Geschichte und Politik in historisch-politisches Bewusstsein. Es lässt sich als ein Vorgang begreifen,
- an dem Lernende lebensweltlich beteiligt sind, indem sie Erfahrungen machen,
- in dem sich Lernende Lerngegenstände aneignen, indem sie Erfahrungen verarbeiten,
- der Lernenden historisch-politische Kenntnisse vermittelt und
- der Lernenden historisch-politischen Denkstrukturen erschließt.
Dabei interessiert nicht nur die Vermittlung von historisch-politischen Lerngegenständen in das Bewusstsein, sondern auch die dadurch bewirkte Umstrukturierung der historisch-politischen Sinnbildungsformen. Die didaktische Reflexion in der Erschließungsdimension interessiert sich nicht mehr für den Gegenstand selbst, sondern für die Struktur, in der historisch-politische Probleme gedeutet werden. Didaktisch muss deshalb danach gefragt werden, welche politikgeschichtlichen und geschichtspolitischen Sinnbildungskompetenzen durch den Lernprozess erschlossen werden.
Mit den politikgeschichtlichen und geschichtspolitischen Lerntypen Kategorien zur Verfügung durch die der Wandel historisch-politischer Bewusstseinsstrukturen didaktisch reflektiert werden kann. Die Lerntypen stellen der historisch-politischen Bewusstseinsanalyse Kriterien zur Verfügung, durch die im Lernprozess Denktätigkeiten identifiziert werden können. Bei der Untersuchung historisch-politischen Lernens lässt sich so bestimmen, welche historisch-politischen Sinnbildungsmodi sich durchsetzten beziehungsweise welche Mischungsverhältnisse sich ausprägen. Keinesfalls sollte die analytische Begrifflichkeit mit der realen Lebendigkeit historisch-politischen Lernens verwechselt werden.
Zur Orientierung und Partizipation in der Gesellschaft benötigt der "mündige Bürger" sowohl politikgeschichtliche als auch geschichtspolitische Kompetenzen. Es steht außer Frage, dass politische Probleme durch historisch fundiertes Handeln besser bewältigt werden können als durch gegenwartszentrierte und kurzsichtige Reaktionen. Die historisch-politische Bildung hat deshalb die Aufgabe, Wege aufzuzeigen, wie die Vergangenheit auf politische Gegenwartsfragen bezogen werden kann; entweder indem allgemeine Prinzipien begründet werden oder indem genetische Faktoren beleuchtet werden oder indem historische Analogien aufgezeigt werden.
Historisch-politische Bildung, die versucht, Deutungen aus der Geschichte zu zementieren, steht im Verdacht, Lernende zu überwältigen. Eine demokratische geschichtspolitische Bildung lehrt, dass die politische Geschichtsdeutung keine endgültigen Fakten vermittelt, sondern einen offenen und nur vorläufig abgeschlossenen Prozess darstellt, der durch neue Erkenntnisinteressen jederzeit wieder neu aufgenommen werden kann. Lernende sollten deshalb zur selbstständigen Reflexion von und zur aktiven Beteiligung an geschichtspolitischen Deutungskontroversen befähigt werden.
Anmerkungen
(1) Der Beitrag basiert auf der kürzlich erschienenen Studie: Dirk Lange, Historisch-politische Didaktik. Zur Begründung historisch-politischen Lernens, Schwalbach/Ts. 2004.
(2) Vgl. Steinbach 2001, 5; Schörken 1981, 232f; Lange 2003c.
(3) Vgl. Jeismann 1978; Schörken 1999.
(4) Vgl. Bergmann 1999; Rüsen 1989; Pandel 1997.
(5) Vgl. Sutor 1997; Steinbach 1998.
(6) Vgl. Hedtke 2003, 120.
(7) Vgl. Weniger 1965.
(8) Vgl. Bergmann/Schneider 1997, 255ff..
(9) Vgl. Bundeszentrale 1973.
(10) Mommsen 1973, 96; vgl. a. Conze 1973.
(11) Koselleck 1972, 25.
(12) Jeismann/Kosthorst 1973.
(13) Vgl. Messerschmid 1963.
(14) Vgl. Behrmann 1974; Hug/Quandt 1975.
(15) Vgl. Süssmuth 1972.
(16) Vgl. ebd.; ders. 1973; Behrmann/Jeismann/Süssmuth 1978; Schörken 1978; Jeismann 1980.
(17) Zur Diskussion vgl. Jeismann 1988.
(18) Bergmann/Schneider 1997, 256.
(19) Vgl. Lucas 1972, 149; Jeismann 1975; Pandel 1978.
(20) Bergstraesser 1963, 9.
(21) Jeismann 1978, 32.
(22) Luhmann 1972, 92.
(23) Jeismann 1980, 183.
(24) Steinbach 2001, 6; vgl. a. Schörken 1972, 97; Weymar 1967.
(25) Bergmann 1996, 328.
(26) Rüsen 1990, 11.
(27) Vgl. Rüsen 1985, 68.
(28) Vgl. Quandt/Süssmuth 1982; Rüsen 1985, 65.
(29) Schörken 1972, 96f.; Rüsen 1997a, 261.
(30) Vgl. GPJE 2002 (darin bes. d. Beiträge v. Wolfgang Sander, Georg Weißeno und Peter Massing).
(31) Weihnacht 1999, 73.
(32) Giesecke 1993, 35.
(33) Vgl. Massing 1998, 149; Grammes 1998, 269ff.; Lange 2004; 35ff.
(34) Vgl. GPJE 2004, 14.
(35) Vgl. Adorno 1973, 1.
(36) Weber 1984, 54.
(37) Ders. 1985, 200.
(38) Vgl. Jeismann 2000, 63f.
(39) Jeismann 1988, 10.
(40 Vgl. Rüsen 1990 und zu den historisch-politischen Lernformen Rüsen 1989, 126ff.
(41) Vgl. bspw. Rüsen 1997b, 29.
(42) Rüsen 1989, 127.
(43) Vgl. bspw. Lange 2003a, 5f.
(44) Vgl. Sutor 1997, 326.
(45) Steinbach 2001, 6; vgl. a. Reichel 1995 u. Jeismann (1981, 6), der von einem "Kampf um das Geschichtsbewußtsein als Ausdruck unterschiedlicher Gegenwartsorientierungen" spricht
(46) Vgl. Jeismann 2000, 52.; Vgl. Lange 2003b.
ALiteratur
Adorno, Theodor W. (1973): Studien zum autoritären Charakter. Frankfurt a.M.
Becher, Ursula A. J.; Bergmann, Klaus, (Hg.) (1986): Geschichte - Nutzen oder Nachteil für das Leben?. Sammelband zum 10jährigen Bestehen der Zeitschrift "Geschichtsdidaktik". Düsseldorf.
Behre, Göran; Norborg, Lars-Arne, (Hg.) (1985): Geschichtsdidaktik - Geschichtswissenschaft - Gesellschaft. Stockholm.
Behrmann, Günter C. (1974): Der Begriff des "Politischen" in den Richtlinien für den politischen Unterricht NRW. In: Geschichte/Politik und ihre Didaktik, Jg. 2 (5-6). Seite 7ff.
Behrmann, Günter C.; Jeismann, Karl-Ernst; Süssmuth, Hans, (Hg.) (1978): Geschichte und Politik. Didaktische Grundlegung eines kooperativen Unterrichts. Paderborn.
Bergmann, Klaus. (1996): Historisches Lernen in der Grundschule. In: George, Siegfried; Prote, Ingrid. (Hg.): Handbuch zur politischen Bildung in der Grundschule. Schwalbach/Ts., Seite 319-342.
Bergmann, Klaus. (1999): Zeitgeschichte. In: Mickel. Seite 624-629.
Bergmann, Klaus u.a., (Hg.) (1997): Handbuch der Geschichtsdidaktik. 5. überarb. Aufl.. Seelze-Velber.
Bergmann, Klaus; Schneider, Gerhard (1997): Geschichte der Geschichtsdidaktik und des Geschichtsunterrichts. In: Bergmann u.a.. Seite 255-260.
Bergstraesser, Arnold (1963): Geschichtliches Bewußtsein und politische Entscheidung. Eine Problemskizze. In: Besson, Waldemar; Hiller v. Gaertringen, Friedrich Freiherr (Hg.): Geschichte und Gegenwartsbewußtsein. Historische Betrachtungen und Untersuchungen. Göttingen, Seite 9-38.
Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.) (1973): Historischer Unterricht im Lernfeld Politik (=Schriftenreihe H. 96). Bonn.
Conze, Werner (1973): Die Bedeutung der Sozialgeschichte für die politische Bildung. In: Bundeszentrale 1973. Seite 21-25.
Giesecke, Hermann (1993): Politische Bildung. Didaktik und Methodik für Schule und Jugendarbeit. Weinheim/München.
GPJE (Hg.) (2002): Politische Bildung als Wissenschaft. Bilanz und Perspektiven. Schwalbach/Ts.
GPJE (2004): Nationale Bildungsstandards für den Fachunterricht in der Politischen Bildung an Schulen. Ein Entwurf. Schwalbach/Ts.
Grammes, Tilmann (1998): Kommunikative Fachdidaktik. Politik - Geschichte - Recht - Wirtschaft. Opladen.
Hedtke, Reinhold (2003): Historisch-politische Bildung - ein Exempel für das überholte Selbstverständnis der Fachdidaktiken. In: Politisches Lernen, Jg. 21 (1-2). Seite 112-122.
Hug, Wolfgang; Quandt, Siegfried (1975): Fachspezifische und fächerübergreifende Curricula und Curriculumsprojekte: Geschichte. In: Frey, Karl (Hg.): Curriculum-Handbuch, Bd. 3. München/Zürich, Seite 420-430.
Jeismann, Karl-Ernst (1975): Politischer Unterricht und Geschichte. In: GPD, Jg. 3, (7-8). Seite 19-27.
Jeismann, Karl-Ernst (1978): Historischer und politischer Unterricht. Bedingungen und Möglichkeiten curricularer und praktischer Koordination. In: Schörken. Seite 14-71.
Jeismann, Karl-Ernst (1980): "Geschichtsbewusstsein". Überlegungen zu einer zentralen Kategorie eines neuen Ansatzes der Geschichtsdidaktik. In: Süssmuth. Seite 179-222.
Jeismann, Karl-Ernst (1981): Geschichte als Element politischen Denkens. Heft 24 der Schriftenreihe "Zwischen Gestern und Morgen". Braunschweig, Seite 3-18.
Jeismann, Karl-Ernst (1988): Geschichtsbewußtsein als zentrale Kategorie der Geschichtsdidaktik. In: Schneider. Seite 1-24.
Jeismann, Karl-Ernst (2000): "Geschichtsbewußtsein" als zentrale Kategorie der Didaktik des Geschichtsunterrichts. In: Ders.: Geschichte und Bildung. Beiträge zur Geschichtsdidaktik und zur Historischen Bildungsforschung. hg. v. Wolfgang Jacobmeyer und Bernd Schönemann. Paderborn u.a., Seite 46-72.
Jeismann, Karl-Ernst; Kosthorst, Erich (1973): Geschichte und Gesellschaftslehre. In: GWU, Jg. 24. Seite 262-288.
Koselleck, Reinhart (1972): Über die Theoriebedürftigkeit der Geschichtswissenschaft. In: Conze, Werner (Hg.): Theorie der Geschichtswissenschaft und Praxis des Geschichtsunterrichts. Stuttgart.
Lange, Dirk (2003a): Migrationsgeschichte lernen. Zur Einführung in ein Problemfeld der historisch-politischen Didaktik. In: Praxis Geschichte Jg. 16, (4). Seite 4-10.
Lange, Dirk (2003b): Der "17. Juni 1953" als Gegenstand der historisch-politischen Bildung. Lernchancen einer demokratischen Geschichtskultur. In: Finke, Klaus (Hg.): Erinnerung an einen Aufstand. Der 17. Juni 1953 in der DDR. Oldenburg, Seite 165-176.
Lange, Dirk (2003c): Politische Alltagsgeschichte. Ein interdisziplinäres Forschungskonzept im Spannungsfeld von Politik- und Geschichtswissenschaft. Leipzig.
Lange, Dirk (2004): Historisch-politische Didaktik. Zur Begründung historisch-politischen Lernens. Schwalbach/Ts.
Lucas, Friedrich J. (1972): Der Beitrag des Geschichtsunterrichts zur politischen Bildung (1. Auflage 1966). In: Süssmuth 1972 (Bd. 2). Seite 147-170.
Luhmann, Niklas (1972): Weltzeit und Sozialgeschichte. Über Beziehungen zwischen Zeithorizonten und sozialen Strukturen gesellschaftlicher Systeme. In: Ludz, Peter Christian (Hg.): Soziologie und Sozialgeschichte. Aspekte und Probleme. KZfSS Sonderheft 16. Opladen, Seite 80-115.
Massing, Peter (1998): Lassen sich durch handlungsorientierten Politikunterricht Einsichten in das Politische gewinnen? In: Breit, Gotthard; Schiele, Siegfried (Hg.): Handlungsorientierung im Politikunterricht. Bonn, Seite 144-160.
Messerschmid, Felix (1963): Historische und politische Bildung. In: APuZ B6.
Mickel, Wolfgang W. (Hg.) (1999): Handbuch zur politischen Bildung, (Schriftenreihe Bd. 358). Bonn.
Mommsen, Hans (1973): Die hessischen Rahmenrichtlinien für das Fach "Gesellschaftslehre" in der Sicht des Fachhistorikers. In: Köhler, Gerd; Reuter, Ernst (Hg.): Was sollen Schüler lernen? Die Kontroverse um die hessischen Rahmenrichtlinien für die Unterrichtsfächer Deutsch und Gesellschaftslehre. Frankfurt a.M.
Pandel, Hans-Jürgen (1978): Integration durch Eigenständigkeit? Zum didaktischen Zusammenhang von Gegenwartsproblemen und fachspezifischen Erkenntnisweisen. In: Schörken 1978. Seite 346-379.
Pandel, Hans-Jürgen (1997): Geschichte und politische Bildung. In: Bergmann u.a. 1997. Seite 319-323.
Quandt, Siegfried; Süssmuth, Hans (Hg.) (1982): Historisches Erzählen. Formen und Funktionen. Göttingen.
Reichel, Peter (1995): Politik mit der Erinnerung. Gedächtnisorte im Streit um die nationalsozialistische Vergangenheit. München/Wien.
Rüsen, Jörn (1985): Historisches Erzählen als geschichtsdidaktisches Prinzip. In: Behre; Norborg 1985. Seite 63-82.
Rüsen, Jörn (1989): Historisch-politisches Bewusstsein - was ist das? In: Bundesrepublik Deutschland. Geschichte - Bewusstsein, hg. v. d. BpB (Schriftenreihe Bd. 273). Bonn, Seite 119-141.
Rüsen, Jörn (1990): Zeit und Sinn. Strategien historischen Denkens. Frankfurt a. M.
Rüsen, Jörn (1997a): Historisches Lernen. In: Bergmann u.a. 1997. Seite 261-265.
Rüsen, Jörn (1997b): Was heißt: Sinn der Geschichte? (Mit einem Ausblick auf Vernunft und Widersinn). In: Müller, Klaus E.; Rüsen, Jörn (Hg.): Historische Sinnbildung. Problemstellungen, Zeitkonzepte, Wahrnehmungshorizonte, Darstellungsstrategien. Reinbek b. Hamburg, Seite 17-47.
Schneider, Gerhard (Hg.) (1988): Geschichtsbewußtsein und historisch-politisches Lernen. Pfaffenweiler.
Schörken, Rolf (1972): Geschichtsdidaktik und Geschichtsbewusstsein. In: Süssmuth 1972 (Bd. 1). Seite 87-101.
Schörken, Rolf (Hg.) (1978): Zur Zusammenarbeit von Geschichts- und Politikunterricht. Stuttgart.
Schörken, Rolf (1981): Geschichte in der Alltagswelt. Wie uns Geschichte begegnet und was wir mit ihr machen. Stuttgart.
Schörken, Rolf (1999): Kooperation von Geschichts- und Politikunterricht. In: Mickel 1999. Seite 629-634.
Steinbach, Peter (1998): Geschichte: Vom Rückgrat politischer Bildung. In: PolBil, Jg. 31. Seite 112-126.
Steinbach, Peter (2001): Geschichte und Politik - nicht nur ein wissenschaftliches Verhältnis. In: APuZ B28. Seite 3-7.
Süssmuth, Hans (Hg.) (1972): Geschichtsunterricht ohne Zukunft? Zum Diskussionsstand der Geschichtsdidaktik in der Bundesrepublik Deutschland. 2 Bde.. Stuttgart.
Süssmuth, Hans (Hg.) (1973): Historisch-politischer Unterricht. 2 Bde., Bd. 1: Planung und Organisation. Bd. 2: Medien, Stuttgart.
Süssmuth, Hans (Hg.) (1980): Geschichtsdidaktische Positionen. Bestandsaufnahme und Neuorientierung. Paderborn u.a.
Sutor, Bernhard (1997): Historisches Lernen als Dimension politischer Bildung. In: Sander, Wolfgang (Hg.): Handbuch politische Bildung. Schwalbach, Seite 323-337.
Weber, Max (1984): Soziologische Grundbegriffe. 6. ern. durchges. Aufl., hg. v. Johannes Winckelmann. Tübingen.
Weber, Max (1985): Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. 6. ern. durchges. Aufl., hg. v. Johannes Winckelman. Tübingen.
Weinacht, Paul-Ludwig (1999): Wissenschaftstheoretische Basiskonzepte und Wissenschaftsbezug. In: Mickel 1999. Seite 73-79.
Weniger, Erich (1965): Neue Wege im Geschichtsunterricht. 3. Aufl., Frankfurt a.M.
Weymar, Ernst (1967): Geschichte und Politische Bildung. hg. v. d. Niedersächsischen Landeszentrale für Politische Bildung. Hannover.
Pandel, Hans-Jürgen (1997): Geschichte und politische Bildung
Die Verhältnisse von Geschichte zur politischen Bildung und von politischer Bildung zur Geschichte stellten sich in den letzten 40 Jahren stets als widersprüchlich dar. Der Grund liegt darin, dass eine Gemeinsamkeit postuliert wurde, obwohl Diskrepanzen deutlicher zutage traten. Erst auf der Grundlage der Unterschiedlichkeiten lassen sich Gemeinsamkeiten erkennen. Das Verhältnis von Geschichte und politischer Bildung stellt sich auf der Ebene der Disziplinen, der Unterrichtsfächer, der Methoden und der Gegenstände dar.
1. Geschichtswissenschaft und Politikwissenschaft
a) Bereits auf der Ebene der Bezugsdisziplinen sind Asymmetrien unverkennbar. Während Geschichtsunterricht in der Geschichtswissenschaft eine eindeutige Bezugsdisziplin besitzt, greift das Fach Sozialkunde/Politik auf Politologie, Soziologie und Volkswirtschaftslehre zurück. Politologie hat sich aber in den letzten Jahren in dieser Trias zur Leitdisziplin entwickelt. Während historisches Lernen sich stärker auf die Bezugsdisziplin Geschichtswissenschaft bezieht, geht politisches Lernen mehr von der erfahrenen politischen Lebenswelt aus. Das eine Fach ist mehr disziplinär, das andere mehr erfahrungsorientiert.
b) Hemmend für eine Zusammenarbeit wirkte sich auch die Ansicht aus, Geschichte und Politologie unterschieden sich durch unterschiedliche Ausschnitte von Wirklichkeit. Die geschichtstheoretische wie die methodologische Diskussion der Politologie haben diese Ansicht aber als unzutreffend erwiesen. Weder kann man der einen Disziplin die Vergangenheit, noch der anderen die Gegenwart zuordnen. Auch die angenommene Zuständigkeit der Geschichtswissenschaft für "die Geschichte" und die der Politikwissenschaft für die "gegenwärtige Lebenswelt" ist unzutreffend. Gegenwart ist ebenso eine Kategorie der Geschichte, wie sich Politik auch der Vergangenheit zuwenden kann.
c) Ebenfalls unzutreffend ist die Annahme von disziplinunabhängigen Gegenständen, auf die sich dann die einzelnen Disziplinen richten müssten. Es gibt keine vorwissenschaftlichen "Gegenstände an sich", die dann nur durch die unterschiedlichen Disziplinen [/S. 320:] erklärt werden müssten. Es ist wissenschaftstheoretisch nicht haltbar, dass eine pädagogische Vereinbarung, sich mit den gleichen Gegenständen zu beschäftigen, schon Integration und politische Bildung ermögliche. Demgegenüber ist festzustellen, dass Gegenstände sich erst durch die verschiedenen disziplinären Sichtweisen konstituieren. "Krieg" ist kein disziplinunabhängiger Gegenstand, sondern je nach disziplinärer Sicht erhalten wir verschiedene Gegenstände, auch wenn die einzelnen Disziplinen den gleichen umgangsprachlichen Namen dafür verwenden.
d) Als Wissenschaftsdisziplinen bzw. Unterrichtsfächer sind "Fächer" spezifische Sichtweisen auf Wirklichkeit, die sich zum Zweck wissenschaftsförmiger Rationalität an Methoden gebunden haben. Wenn Geschichts- und Politikwissenschaft Beiträge zur Orientierung in der Gegenwart leisten sollen, ist es notwendig, dass sie ihre eigenen Fragestellungen und ihre eigenen methodischen Zugriffe nicht aufgeben. Es kommt darauf an, dass in der politischen Bildung gelernt wird, sich der einzelnen Sichtweisen auf Welt zu bedienen.
2. Politische Bildung
Politische Bildung ist nicht identisch mit den Erkenntnissen von Geschichtswissenschaft, Politikwissenschaft, Soziologie etc. Zum Zwecke von Bildung müssen die Ergebnisse einer didaktischen Reflexion unterzogen werden. Das geschieht auf drei Ebenen.
(1) Für Politische Bildung sind zunächst und im engeren Sinne Geschichts- und Politikunterricht (bzw. Sozialkunde) zuständig. Sie liefern grundlegende Sach- und Zeitorientierung.
(2) Vom Anspruch her ist politische Bildung aber Unterrichtsprinzip und deshalb sind prinzipiell alle Fächer daran beteiligt. Politische Bildung als Unterrichtsprinzip ist die "permanente, in der didaktischen Konzeption jedes Faches wie bei der didaktischen Planung der einzelnen Unterrichtsthemen mit zu reflektierende Aufgabe aller Fächer" (Sander 1989, 163). In dieser Reflexion wird die politische Dimension des jeweiligen Faches herausgearbeitet, d. h. es wird bestimmt, welchen Beitrag das jeweilige Fach einschließlich seiner Fragestellungen, Methoden und Ergebnisse zur Regelung der herrschaftsgeordneten Angelegenheit menschlicher Gemeinschaften leistet. Der Beitrag der politischen Dimension erschließt sich in drei Hinsichten. (a) Die Reflexion der politischen Dimension liefert eine vertiefte Kenntnis des jeweiligen Fachgegenstandes. So liegt beispielsweise die politische Dimension der französischen Menschenrechtserklärung im Problem der Universalisierbarkeit; der Nationsbildungsprozess des 19. Jahrhunderts steht in Verbindung mit der Reaktivierung von Ethnizität bei gleichzeitig zunehmender weltweiter Migration etc. Angesichts der wieder zunehmenden Personalisierung im Geschichtsunterricht ist erneut daran zu erinnern, dass in dem Verfahren der Personalisierung die Gefahr der politischen Apathie steckt. (b) Politische Bildung als Prinzip erschließt Aspekte des Politischen, die nur von den jeweiligen Fachdisziplinen erhoben werden können. Geschichtswissenschaft und Geschichtsunterricht können besser als andere Disziplinen die Wirkung langandauernder Mentalitäten explizit machen. Alltagsgeschichte verdeutlicht Wahrnehmungsmuster alltäglichen Handelns, die politisches Handeln beeinflussen, ohne dass sie erkannt und diskutiert werden. (c) Politische [/S. 321:]Bildung als Prinzip orientiert die fachspezifischen Inhalte auf die Grundprobleme ("Schlüsselprobleme") der gegenwärtigen Situation, so dass diese Probleme von unterschiedlichen Disziplinen bearbeitet werden können.
(3) Politische Bildung ist aber nicht nur schulische Aufgabe. Als politisch gewollter Auftrag ist sie in den Bundes- und Landeszentralen für politische Bildung institutionalisiert. "Die Bundeszentrale hat die Aufgabe, durch Maßnahmen der politischen Bildung im deutschen Volk das Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern, das demokratische Bewußtsein zu festigen und die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit zu stärken" (§ 2 des Erlasses vom 8. Dezember 1987 über die Bundeszentrale für Politische Bildung).
3. Integration und Kooperation
Eine Aufgabe, die in verschiedene Disziplinen fällt, an verschiedenen Themen bearbeitet wird, von Lehrern mit unterschiedlichem Fachhabitus durchgeführt wird, erzeugt unweigerlich das Bemühen, die Aktivitäten zu bündeln und divergierende Tendenzen zu vermeiden. Die bisher vorgelegten Versuche, die an der politischen Bildung im engeren Sinne beteiligten Fächer (Geschichtsunterricht, politische Bildung, Geographie) zu einem Fach zu verschmelzen (Hessische Rahmenrichtlinien 1972) oder durch Bildung verschiedener Unterrichtstypen zu einer Kooperation zu kommen (Behrmann u. a. 1978), dürften in der Praxis als gescheitert gelten. Weder Gesellschaftslehre als Fach noch ein sogenannter kooperativer Unterricht hat es bisher vermocht, thematische Integration und unterrichtliche Kooperation herzustellen. Aber auch Gesellschaftslehre als Lernbereich steht vor den gleichen Problemen, die die einzelnen Fächer haben, wenn sie keinem schulischen Lernbereich zugeordnet sind. In den letzten Jahren wird wieder der fachübergreifende Unterricht diskutiert, dessen Probleme allerdings über die politische Bildung hinausreichen. Überzeugende Ansätze liegen nicht vor.
4. Historisch-politisches Bewusstsein
Politische Bildung hat den Zweck, Schülern wie Erwachsenen eine Orientierung in der Gegenwart und für die absehbare Zukunft zu geben. Geschichte liefert Orientierung in der Zeit und vermag keine Orientierung für unmittelbares Handeln zu geben. Politik dagegen liefert Orientierung für politisches Handeln, vermag aber keine Orientierung in der Zeit zu liefern. Das Aufzeigen von Handlungsalternativen und Entscheidungen in den je aktuellen Umständen leistet Politik.
Aus der Geschichte lassen sich keine unmittelbaren Handlungsorientierungen für die Gegenwart gewinnen, wie es die konservative Sicht will; es lässt sich aber auch nicht unmittelbar handeln, ohne die geschichtlichen Bedingungen des Handelns zur Kenntnis zu nehmen, wie es voluntaristische und technokratische Positionen wollen.
Das Ziel von politischer Bildung wird meist mit "historisch-politischem Bewusstsein" angegeben. Dieser Bindestrichbegriff verdeckt die unterschiedlichen, aber aufeinander bezogenen Operationen des historischen Bewusstseins und des politischen. Diese beiden grundsätzlich unterscheidbaren Bewusstseinsstrategien richten sich auf unterschiedliche Bereiche. Politisches Bewusstsein ist auf Handeln bezogen und richtet sich vorwiegend auf die Dimension von Macht und Herrschaft, die das Verhältnis von Menschen zuein[/S. 322:]ander strukturiert. Unter dem Gesichtspunkt von Macht und Herrschaft sind die Beziehungen der Menschen untereinander asymmetrisch und bedürfen deshalb der Legitimation. Politisches Bewusstsein zielt auf die Praxis bestimmter Handlungsanweisungen und weiß um Bedingungen und Möglichkeiten politischer Handlungsstrategien in herrschaftsstrukturierten Gesellschaften.
Ein solches direkt auf Handeln orientiertes Bewußtsein ist nicht Gegenstand des historischen Bewußtseins. Historischem Bewußtsein geht es um die Kontingenzerfahrungen der Lebenspraxis und versucht, sie zu bewältigen. Es deutet die kontingenten Ereignisse, indem sie sie zu einem sinnvollen Zeitzusammenhang, zu einer Geschichte verbindet. Erst in einer Geschichte machen verschiedene Ereignisse Sinn. Durch Geschichte können die Menschen ihre Lebensverhältnisse "so ansehen ..., als hätten sie sie gewollt" (Rüsen 1989). Sie geben dem Ereignis denkend einen Sinn. Historisches Bewusstsein gibt deshalb dem politischen Handeln die notwendige Orientierung, die für ein Handeln im Zeitverlauf unerlässlich ist.
Historisches Bewusstsein zielt auf Handlungsorientierung in der Zeit, politisches Bewusstsein auf Bedingungen und Möglichkeiten des Handelns selbst. Auf diese Weise sind beide Bewusstseinsstrategien aufeinander verwiesen. Dass beide Aspekte des historisch-politischen Bewusstseins aufeinander bezogen werden können, dafür sind bestimmte Voraussetzungen unerlässlich. Geschichte muss sich zur Politik so verhalten, dass sie deren Orientierungsprobleme wirklich aufgreift und nicht auf die ästhetischen und exotischen Elemente ausweicht und diese gegen die politische Orientierungsfunktion ausspielt. Politisches Bewusstsein darf dagegen die Reflexion praktischen Handelns auf gegenwartsgebundene Mittel nicht verkürzen, denen Vergangenheitsanalyse und Zukunftsdeutung zur politischen Rhetorik verkommt, ohne Orientierungsfragen "über den Tag hinaus" ernst zunehmen.
5. Schlüsselprobleme und Qualifikationen
Um politische Bildung zu bewirken und nicht nur politisches Wissen zu vermitteln, muss das historisch-politische Wissen durch ein didaktisches Bezugsraster auf Bildung hin strukturiert werden. Es bietet sich ein zweistufiges Verfahren aus historisch-politischen Schlüsselproblemen und politischen Qualifikationen an.
1) Mit den Schlüsselproblemen liegt ein sinnvoller Ansatz vor, gegenwärtige Probleme zum Ausgangspunkt zu machen. Schlüsselprobleme sind gegenwärtige historisch-politische Probleme von struktureller Aktualität. Es sind diejenigen Probleme einer jeden Gegenwart, die für das humane Leben einer Gesellschaft lebens- und überlebenswichtig sind. Diese Probleme sind über die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und Parteiungen hinweg als Probleme konsensfähig, obwohl ihre Lösungsvorschläge und -strategien kontrovers sind: Menschenrechte, Umwelt, Meinungsfreiheit in der Mediengesellschaft etc. Schlüsselprobleme helfen, die einzelnen Unterrichtsfächer auf Gegenwartsprobleme hin zu orientieren. Bei der Sozialkunde ist das sowieso der Fall, wie die Konzepte des Fallprinzips und der Konfliktorientierung deutlich machen. Aber auch die wenig offene Werteerziehung macht es, da sie nicht unbefragte, sondern die in der Gegenwart erodierenden Werte ins Zentrum stellt. Die Geschichtsdidaktik hat seit den siebziger Jahren, veranlasst durch die sozialgeschichtliche Wende der Geschichtswissenschaft, den Schritt zum Gegenwartsbezug als Ausgangspunkt für historische Auswahl [/S. 323:]getan. Diese Probleme werden unter den verschiedenen Sichtweisen der Disziplinen zu unterschiedlichen Gegenstandskonstitutionen führen. Schlüsselprobleme leiten in Gegenwarts- und Problemorientierung der politischen Bildungsprozesse. Konkrete Probleme der Schüler wie aktuelle gesellschaftliche Probleme sind Ausgangspunkt für Curriculumkonstruktionen und Unterrichtsplanung.
2) Als Prozesse politischer Bildung müssen Lernprozesse die Schüler und Schülerinnen einbeziehen und die Schlüsselprobleme unter dem Blickwinkel der Lernenden und deren Lebenswelt sehen. Am konsequentesten leistet dies das Konzept der Qualifikationen, das das Land Nordrhein-Westfalen in seinen Richtlinien verfolgt. Qualifikationen verbinden den Inhalts- und Verhaltensaspekt. Der Inhaltsaspekt "Friedensordnungen" wird mit einem Verhaltensaspekt "Fähigkeit und Bereitschaft ... für eine gerechte Friedensordnung ... einzutreten, auch wenn dadurch Belastungen für die eigene Gesellschaft entstehen" (Qualifikation 10 der "Richtlinien für den Politikunterricht" in NRW). Solche Verhaltensaspekte wie Ideologiekritik, Konfliktfähigkeit, altruistische Parteinahme, aktive Friedensfähigkeit etc. machen erst die Dimensionen politischer Bildung deutlich. Die Verhaltensweisen beanspruchen, keine Verhaltensvorschriften, sondern Verhaltensdispositionen zu sein. Das soll durch den Qualifikationsaspekt "Fähigkeit und Bereitschaft" ausgedrückt werden. Allerdings sind bei der Formulierung "Bereitschaft" Zweifel an deren Offenheit anzumelden. Auch wenn Bereitschaft in vielen Qualifikationen durchaus sinnvoll erscheint, sind doch Bedenken angebracht, ob eine offene demokratische Gesellschaft über "Möglichkeit" hinaus zu "Bereitschaft" gehen darf, um damit ein bestimmtes Verhalten festzulegen.
Literatur
Behrmann, Günter C.; Jeismann, Karl-Ernst; Süssmuth, Hans (Hg.) (1978): Geschichte und Politik. Didaktische Grundlegung eines kooperativen Unterrichts. Paderborn: Schöningh.
Bergmann, Klaus (1988): Wie ist Gesellschaftslehre möglich? Aus der Sicht des Geschichtsunterrichts. In: Deutsche Vereinigung für politische Bildung - Landesverband Hessen (Hg.): Forum politische Bildung. Seite 12-30.
Gagel, Walter; Menne, Dieter (Hg.) (1988): Politikunterricht. Handbuch zu den Richtlinien NRW. Opladen: Leske+Budrich.
Mayer, Ulrich; Schröder, J.: Die hessischen Rahmenrichtlinien Gesellschaftslehre - Didaktische Perspektiven und Ergebnisse der Weiterentwicklung 1972-1980. In: Quandt, Siegfried (Hg.): Geschichtsdidaktik und Lehrerfortbildung. Willich o. J.
Mickel, Wolfgang (Hg.) (1979): Politikunterricht im Zusammenhang mit seinen Unterrichtsfächern. München: Ehrenwirth.
Mickel, Wolfgang; Zitzlaff, Dieter (Hg.) (1988): Handbuch zur politischen Bildung. Opladen: Leske+Budrich.
Rüsen, Jörn (1989): Historisch-politisches Bewußtsein - was ist das? In: Bundesrepublik Deutschland. Geschichte - Bewußtsein. hg. v. d. BpB (Schriftenreihe Bd. 273) Bonn, Seite 119-141.
Sander, Wolfgang (Hg.) (1985): Politische Bildung in den Fächern der Schule. Stuttgart: Klett.
Sander, Wolfgang (1988): Lernen für die Mündigkeit. Perspektiven der politischen Bildung. Marburg: SP-Verl. Schüren.
Sander, Wolfgang (1989): Zur Geschichte und Theorie der politischen Bildung. Allgemeinbildung und fächerübergreifendes Lernen in der Schule. 2. Aufl. Marburg: SP-Verl. Schüren.
Schörken, Rolf (Hg.) (1978): Zur Zusammenarbeit von Geschichts- und Politikunterricht. Stuttgart: Klett.
Stein, Edith (1982): Gesellschaftslehre als fächerübergreifender Unterricht. Frankfurt a/M.: Suhrkamp.
Pandel, Hans-Jürgen (2001): Fachübergreifendes Lernen – Artefakt oder Notwendigkeit?
Die heutige Diskussion über fachübergreifendes Lernen steht in einer längeren Tradition. Sie hat Konzepte von Gesamtunterricht und kooperativem Unterricht (1) zu Vorläufern. Mit Fächern wie "Gemeinschaftskunde" und "Gesellschaftslehre" (2) liegen auch praktische Großversuche vor. Sozialkunde scheint ein bewährter Ansatz fachübergreifenden Lernens zu sein, der selbst zum (Schul-)Fach geworden ist. Das hat Sozialkunde aber nicht davor bewahrt, der Forderung fachübergreifenden Lernens zu entgehen. In den 70er Jahren war die Diskussion um die Begriffe Integration, Kooperation und Eigenständigkeit zentriert (3). Heute tritt "fächerübergreifender (bzw. fachübergreifender oder fächerverbindender) Unterricht" an ihre Stelle. Vor über 20 Jahren (4) habe ich mich an dieser Debatte beteiligt, Grund genug, die eigenen Positionen zu überprüfen und auf neue Tendenzen zu reagieren. Auf Grund dieser jahrzehntelangen Diskussion sind nicht nur die theoretischen Prämissen, sondern auch die ihnen folgende Praxis beurteilbar.
Der Forderung nach fachübergreifendem Lernen liegt die Annahme zu Grunde, dass die Grenzen der wissenschaftlichen Disziplinen und damit auch die mit ihnen korrespondierenden Schulfächer zu Erkenntnisgrenzen geworden seien. Eine Atomisierung der Fächer habe die Einheit der Wissenschaft bzw. der wissenschaftlichen Rationalität zerbrochen. Auf Grund dieser Entwicklung benötigten wir mit "fachübergreifendem Lernen" eine pädagogisch-didaktische Reparaturinstanz.
Unter drei Gesichtspunkten will ich untersuchen, ob die Forderung nach fachübergreifendem Lernen eine didaktische Notwendigkeit oder ein pädagogisches Artefakt - oder vielleicht beides gleichzeitig - ist:
- Wissenschaftstheoretische Ebene
- Wissenschaftshistorische Ebene
- Wissenssoziologische Ebene.
Das Problem der Integration, Kooperation und Eigenständigkeit der Unterrichtsfächer sowie des fächerübergreifenden Unterrichts ist weniger ein bildungspolitisches als ein didaktisches Problem. Es hat viel damit zu tun, wie die Fachdidaktiken sich selbst begreifen und wie sie die Wissenschaftsdisziplinen, auf die sie sich beziehen, auffassen. Ich deute nur an, dass ich Fachdidaktiken - gleich ob naturwissenschaftlicher oder geisteswissenschaftlicher Herkunft - für Kulturwissenschaften halte. Im Moment verstehen sich allerdings ihre Vertreter entweder als Interessenvertreter ihrer "Bezugsdisziplin" oder als Anwälte einer imaginären - wie ich meine - "pädagogischen Wirklichkeit".
Diese Konzeption von Fachdidaktik hat die Befunde von Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsgeschichte und Wissenssoziologie zur Kenntnis zu nehmen. Sie kann nicht so tun, als wenn deren Argumente sie nichts angingen.
1. Wissenschaftstheorie
Ein für die Didaktik noch immer kaum erschlossener Argumentationszusammenhang liegt in der Wissenschaftstheorie vor. Versuche der Integration von Fächern sollten sich deshalb über Voraussetzung, Struktur und Logik von "Fächern" Klarheit verschaffen. Jenseits ihres organisatorischen Status als Institutionen begründen "Fächer" sich in ihrem wissenschaftshistorischen Prozess auf gegenstandstheoretischer, methodologischer und konstitutionstheoretischer Ebene. Von diesen drei sich durchdringenden Ebenen soll geprüft werden, welche hemmenden oder fördernden Bedingungen für einen fachübergreifenden Unterricht vorliegen.
(1) Auf der gegenstandstheoretischen Ebene wird fachübergreifendes Lernen durch die Einsicht erleichtert, dass die einzelnen Fachdisziplinen sich nicht durch eine besondere Dignität ihres dinglich verstandenen oder phänomenologisch wahrgenommenen Gegenstandes unterscheiden. Gegenstände von Wissenschaft sind nicht irgendwelche von vornherein gegebenen Klassen von separaten Phänomenen. Die Verschiedenheit der Wissenschaften resultiert nicht daraus, dass sie einen bestimmten vorgängig gegebenen Gegenstand, eine bestimmte exklusive Klasse von Phänomenen, zu ihrem ausschließlich von ihnen zu untersuchenden Gegenstand machen. Auf alle Dinge, Personen und Ereignisse in der Welt können sich alle Wissenschaften forschend beziehen.
Historiker, Politologen, und Literaturwissenschaftler (5) - um nur einige zu nennen -, die die Praxis ihrer Disziplin reflektieren, machen deutlich, dass ihre Wissenschaften sich nicht durch einen vorab gegebenen Gegenstand definieren. So kann in der Praxis des Historikers alles zum historischen Gegenstand werden, da alle Sachverhalte eine "historische Dimension" haben. Die Geografie richtet ihre Aufmerksamkeit auf die räumliche Anordnung der Phänomene in einem Gebiet und nicht so sehr auf die Phänomene selbst. Werner Hofmann hatte bereits vor Jahren die Definition einer Wissenschaft von einem Gegenstand her verworfen: "Wissenschaft ist durch nichts außer ihr Gegebenes, gleichsam dinglich, gesichert" (6). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Phänomene, denen sich Wissenschaft zuwendet, eine "unterschiedliche materielle Dichte" besitzen. Manche "weisen eine dinglichere Gestalt auf als andere" und manche "existieren letztlich nur", weil Wissenschaftler sie "repräsentieren und reproduzieren". Für die erste Gruppe steht "Wasser", für die andere "Arbeitslosenrate" und "Wohlstandsindikatoren" (7).
Nehmen wir als Beispiel einen konkreten Gegenstand an. Auf einem freien Feld steht ein einsamer Baum. Die einzelnen Disziplinen sehen diesen "Gegenstand" unter unterschiedlichen Blickwinkeln. Für den Biologen ist der Baum Gegenstand botanischer Betrachtung. Die Geografie geht auf die Raumbeziehungen dieses Standortes ein. Die Politik bzw. Sozialkunde kann ihn als Gegenstand einer Bürgerinitiative betrachten: "Kein Baum für den Golfplatz/Parkplatz". Für den Historiker handelt es eine 400 Jahre alte Femelinde, vor der Recht gesprochen wurde. Das Beispiel zeigt, dass sich die Disziplinen nicht anderen Gegenständen zuwenden, sondern die gleichen Gegenstände unter verschiedenen Fragestellungen betrachten.
Ein Blick auf die Disziplin der Friedens- und Konfliktforschung macht deutlich, dass ein Fach nicht lediglich durch einen konkretistisch gefassten "Gegenstand" definiert wird. "Kriege" und "Konflikte" waren und sind "Gegenstände" etablierter Disziplinen. Die Friedens- und Konfliktforschung geht diese Gegenstände unter eigenen, neueren Fragestellungen an, wenn sie nach den gesellschaftlichen Bedingungen des Friedens, der strukturellen Gewalt oder nach der organisierten Friedenslosigkeit fragt.
Da die Vergangenheit kein Monopolobjekt der Geschichtswissenschaft und die Gegenwart keines der Politologie oder Soziologie ist, kann jede vergangene, gegenwärtige und zukünftige Gesellschaft von allen diesen Disziplinen zum Objekt ihrer Forschung gemacht werden. Ähnlich verhält es sich mit den Gegenständen "Geschichte" und "Vergangenheit". Auch sie ergeben allein keine tragfähige Basis zur Definition einer bestimmten Wissenschaft. Mit dem Gegenstand "Zeitgeschichte" befassen sich Politologie, Soziologie und Geschichtswissenschaft gleichermaßen, ohne dass dabei deren Verfahrensweisen oder deren Antworten, die sie auf ihre unterschiedlichen Frageweisen erhalten, identisch werden. Auf dem Gebiet der Zeitgeschichte ist in den letzten Jahren das Nebeneinander unterschiedlicher Disziplinen kaum strittig gewesen. Damit werden alle klassischen Entgegensetzungen, die vom dinglichen oder phänomenologischen Gegenstand her Geschichtswissenschaft und systematisierende Sozialwissenschaften zu unterscheiden suchten, immer unschärfer: Vergangenheit vs. Gegenwart, Geschichte vs. Gesellschaft, Geschichte vs. Politik, "res gestae" vs. "res gerendae" verlieren immer mehr ihre analytische Trennschärfe (vorausgesetzt, dass sie sie jemals besessen haben). Das gilt auch für die Formalgegenstände Individuelles vs. Allgemeines und Raum vs. Zeit. Ohne den hohen Stellenwert von Individuellem oder von Zeit für die Geschichtswissenschaft in Abrede stellen zu wollen, kann der Historiker weder individuelle Ereignisse noch Zeitphänomene für sich reklamieren. Politologische und soziologische Fallstudien befassen sich ebenso mit Individuellem wie Psychologie, Psychiatrie und Soziologie mit der Zeit.
Beide Positionen finden sich in der Didaktik wieder:
a) Die eine geht davon aus, dass die Phänomene disziplinär etikettiert sind. Ich möchte sie die Puzzle-Theorie nennen. Sie besagt, dass man nur die passenden Stücke suchen müsse, die sich dann wie in einem Puzzle zu einem Ganzen und sinnvollen Bild zusammenfügen lassen. Wie bestimmte Gegenstände oder Phänomene noch keine bestimmte Disziplin begründen oder von bestimmten Fächern exklusiv erforscht werden, so kann auch durch Zusammenstellen unterschiedlicher Gegenstände kein sinnvolles Thema für fachübergreifendes Lernen entstehen. Hier wird mit der Trivialität gearbeitet, dass alle Gegenstände in Raum und Zeit existieren. Die Puzzle, die hier zusammengesetzt werden sollen, gehören stets verschiedenen Spielen an.
b) Die zweite Position sucht nach Gegenständen, die unter dem Blickwinkel aller (bzw. möglichst vieler) Disziplinen betrachtet werden können. Sie kann man die Prisma-Theorie nennen. Ein Gegenstand zerlegt sich unter verschiedenen Betrachtungswinkeln - wie bei der Lichtbrechung - in unterschiedliche Aspekte. Die fortgeschrittenen Modelle fachübergreifenden Lernens gehen folgerichtig von einem "Gemeinsamen exemplarischen Gegenstand" aus. Solche Gegenstände sind Planeten, Lärm, Zeit (8). Auch wenn zugestanden wird, dass die einzelnen Fächer sich auf den gleichen Gegenstand richten können, sind die didaktischen Folgerungen wenig zufrieden stellend. Dazu einige Argumente am Schluss.
Daraus möchte ich die These formulieren:
- Jedes Phänomen kann im Prinzip von jeder Disziplin betrachtet werden. Die dabei entdeckten Zusammenhänge sind gedachte Zusammenhänge und keine der Wirklichkeit. Aus dem Zusammenstellen von Gegenständen, bei denen lediglich ein äußerer zeitlicher oder räumlicher Zusammenhang besteht, ergibt sich keine fachübergreifende Perspektive. Fachübergreifendes Lernen hat die Einsicht zur Voraussetzung, dass ein Erkenntnisobjekt von mehreren Disziplinen betrachtet werden kann.
(2) Auf der methodologischen Ebene wird fachübergreifendes Lernen durch die Einsicht in den gegenstandskonstitutiven Charakter der wissenschaftlichen Methoden erschwert. Die Einheitswissenschaft mit der Einheitsmethode ist ein wissenschafts-konservativer, positivistischer Traum geblieben. Im Positivismusstreit wurde offenbar, dass sich die Einheit der Wissenschaft durch das Verfahren nicht herstellen lässt.
Mit "Methoden historischer, politologischer, soziologischer, psychologischer etc. Erkenntnis" sind jene Operationen der geistigen Auseinandersetzung gemeint, die zu fachspezifischen Aussagen führen. Den Methoden, verstanden als folgerichtige Denkoperationen, liegt eine bestimmte Erkenntnisabsicht und damit eine bestimmte Aussageintention zu Grunde. Schülerinnen und Schüler sollten daher nicht in erster Linie Wissensbestände lernen, sondern die Wege des Fragens und Urteilens. Insofern sind die Methoden der Erkenntnis Aneignungsformen oder Verfahrensweisen des Nachdenkens über Gegenstände, die durch das Verfahren des Nachdenkens erst konstituiert werden.
Untersuchungen über diejenigen Erkenntnisweisen, denen sich ein Schüler bedienen muss, wenn er für das "Fach", in dem er diese Erkenntnisweisen anwendet, zu fachspezifischen Aussagen kommen will, fehlen noch. Da diese Erkenntnisweisen für die einzelnen Wissenschaften grundlegend sind, können sie von den Didaktikern nicht (mehr) beliebig entworfen oder verändert werden. Sie sind vielmehr in den Wissenschaften "vorgezeichnet".
In dem Bereich der Didaktiken der Sozialkunde, Geografie, Geschichte sowie der Kunst- und Sprachwissenschaften - einschließlich ihrer Bezugsdisziplinen - haben wir es vorwiegend mit sechs unterscheidbaren Erkenntnisweisen zu tun, die unterschiedliche Erkenntnismöglichkeiten bieten:
- die historisch-hermeneutische Verfahrensweise,
- die kritisch-dialektische Verfahrensweise,
- die empirisch-analytische Verfahrensweise,
- die quantitativ-statistische Verfahrensweise.
- die narrativ-faktualen und
- die empathisch-fiktionalen Verfahrensweise (9).
Wenn durch die Unmöglichkeit einer Universalmethode die Integration nicht gerade erleichtert wird, so bieten die unterschiedlichen Verfahrensweisen doch die Grundlage für weitere Überlegungen. Allerdings sind Methoden nicht einer einzigen Fachwissenschaft zu Eigen, sondern einer Fächergruppe. Die an der politischen Bildung im engeren Sinne beteiligten Fächer sind nicht einer einzigen, sondern mehreren Methoden verpflichtet. Insofern wird fachübergreifendes Lernen durch die Methode wieder erleichtert. Keines dieser einzelnen Fächer ist methodologisch autonom; ihre Methoden sind vielmehr integraler Bestandteil einer allgemeinen Methodologie aller Sozial- und Kulturwissenschaften. Eine Reduzierung auf eine oder wenige Methoden - z. B. durch den Ausschluss der Hermeneutik -, um durch größere Einheitlichkeit Integrationsvoraussetzungen zu schaffen, ist ohne Erkenntnisverlust nicht möglich. Die Reduktion auf eine so genannte Einheitsmethode ist mit gravierenden didaktischen Gefahren verbunden: Den Schülern werden Erkenntnismöglichkeiten vorenthalten. Auf dem Hintergrund dieser gegenstandskonstitutiven Verfahrens- und Erkenntnisweisen lassen sich m. E. weiterführende Aussagen über fachübergreifendes Lernen treffen. Geht man in der Analyse der Kooperations-Integrations-Problematik auf die fach(bereichs)spezifischen Erkenntnisweisen als Arten wissenschaftlichen Arbeitens zurück, so stellt sich die Frage der Zusammenarbeit der Unterrichtsfächer anders dar, als sie bisher diskutiert wurde. Die isolierenden Fächergrenzen sind nämlich in einer gewissen Weise bereits durchbrochen - und zwar durch die Erkenntnisweisen. Diese Erkenntnisweisen finden wir nur schwerpunktmäßig in den einzelnen Disziplinen. Selbst die einzelnen akademischen Schulen und Forschungsrichtungen innerhalb einer Disziplin bedienen sich unterschiedlicher Erkenntnisweisen, sodass die Verwandtschaft zu einem Nachbarfach der Disziplin oft eher erkennbar ist als zu einer anderen akademischen Schule innerhalb der eigenen Disziplin. Die quantitativ arbeitende Wirtschaftsgeschichte hat methodisch mehr Gemeinsamkeiten mit der Ökonomie als mit der weitgehend hermeneutischen Mediävistik.
Dazu meine zweite These:
- Wir kommen in der Diskussion des fachübergreifenden Lernens erheblich weiter, wenn wir Methoden als lehrbare Inhalte begreifen. Sie verbürgen ein gutes Stück fachübergreifender Sichtweise, da diese Methoden fachübergreifend sind. Die gegenwärtige Methodenorientierung ist im Moment dazu noch wenig geeignet, da sie mehr pädagogische Methoden der Unterrichtsorganisation als wissenschaftliche Erkenntnisweisen meint.
(3) Auf der konstitutionstheoretische Ebene wird deutlich, dass im fachübergreifenden Lernen die wissenschaftlichen Frageweisen nicht ohne Erkenntnisverlust eingeschmolzen werden dürfen. Sie sind es, durch die sich die Wissenschaften erst konstituieren. Fächer bilden sich durch eine bestimmte Weise des Fragens und der daraus folgenden Art des Nachdenkens. Sie sind folglich Denkweisen. "Wissenschaft ist nicht identisch mit ihren letzten Produkten, sondern mit ihren elementaren Fragen und Verfahren: ihren principia" (10). Die jeweils spezifischen Frageweisen machen die Eigen-Art der Wissenschaftsdisziplinen aus. Der Objektbereich des Fragens und Forschens wird im Wesentlichen durch die Frageweise konstruktiv hergestellt. Erkenntnisgegenstände der Wissenschaft werden durch kategoriale Formung der Gegenstandsbereiche erst geschaffen und sind somit nicht primär vorgegeben, sondern erst durch Wissenschaft konstituiert. Die konstruktivistische Debatte der letzten Jahre erlaubt es, schärfer zu formulieren: Ohne historisches Denken keine Geschichte, denn es ist das historische Denken, das sich seinen Gegenstand als Objekt möglicher Erkenntnis erst begrifflich erzeugt.
Historisches Lernen ist die Erprobung und Anwendung des Denkstils "historisches Denken" und darf nicht mit dem Akkumulieren von Wissen verwechselt werden. Das historische Denken ist wie Philosophieren und mathematisches Denken eine abendländische Kulturerrungenschaft, die 2500 Jahre alt ist und sich in ehrwürdiger Tradition durch die Jahrhunderte ausdifferenziert, entmythologisiert und rationalisiert hat. Denkstile bringen eine in der abendländischen Tradition bewährte Art und Weise ein, die Welt zu befragen (samt den daraus resultierenden Ergebnissen). Mathematisches, philosophisches und historisches Denken sind dann als kulturkonstituierende Denkweisen anzusehen, die ihrer Eigenlogik folgen.
Denk- bzw. Erkenntnisweisen werden die Arten eines denkenden Umgangs genannt, die dann Sachgebiete wie Geschichte erst konstituieren. Ohne die historische Denkweise gibt es auch keine Geschichte. "Die wissenschaftlichen Methoden sind wie die Organe unserer sinnlichen Wahrnehmung: Sie haben wie diese jede ihre spezifische Energie, ihren bestimmten Kreis, für den sie geeignet sind, und bestimmen sich nach denselben in ihrer Art und Anwendbarkeit." (11) Wenn wir Wahrnehmungen machen (einen Satz in einer Quelle lesen, eine Zechenkolonie im Ruhrgebiet besichtigen, eine mittelalterliche Steuerliste betrachten usw.), wissen wir unmittelbar noch nicht, was wir erfahren haben. Wir müssen die Wahrnehmungen erst denkend verarbeiten. Die Wahrnehmungen, die wir machen, sind nämlich ambivalent, doppeldeutig, widersprüchlich. Oft sind sie auch so unscheinbar, dass wir ihnen anfangs keine Bedeutung beimessen. Wir müssen sie erst ordnen und systematisierend verarbeiten, klassifizieren und untereinander in Beziehung setzen, um zu einer Erkenntnis zu gelangen. "Die physiologischen Unzulänglichkeiten des menschlichen Wahrnehmungsapparates zwingen zu einer nachträglichen Systematisierung der Wahrnehmungen, zu einer zeitlichen Ordnung, zu einer Selektion der als wesentlich erachteten Bestandteile einer Erfahrung - kurz: Systematisches Denken und systematische Beschreibung, Äußerung, Erklärung, Prognose sind Formen einer gattungsspezifischen Kompensation und der Ambivalenz von sensorischen Erfahrungen und Mitteilungen." (12)
- Von den jeweiligen spezifischen konstitutiven Fragestellungen ausgehend, werden im Forschungsprozess in empirischer und logischer Analyse systematische Aussagen über Zusammenhänge von Bereichen der Wirklichkeit oder systematische Aussagen über das System der Aussagen selbst gefunden (Disziplin und Metadisziplin). Als "Fächer" sind also die verschiedenen objektiv möglichen und üblichen Weisen, die Welt zu begreifen, zu verstehen. Wirklichkeit wird auf eine spezifische Art erfasst und denkend geordnet. Diese Definition von Fach macht keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Schul-Fach und Wissenschafts-Fach. Sie geht vielmehr davon aus, dass die Denkweisen in beiden Bereichen prinzipiell richtungsgleich und in ihrer Spezifik identisch sind. Forschungslogik und Unterrichtslogik werden dadurch aber nicht gleichgesetzt. Die Logik der Forschung folgt, wenn sie einmal von gesellschaftlich-praktischen Problemen ausgegangen ist, auch wissenschaftsimmanenter Gesetzlichkeit. Sie erbringt Ergebnisse des Faches, die von der Didaktik daraufhin befragt werden müssen, ob sie als Unterrichtsgegenstände geeignet sind, Wirklichkeit - und das heißt in diesem Falle: die Gegenwart und absehbare Zukunft des Schülers innerhalb einer historisch-gesellschaftlichen Konstellation - durch bestimmte Denkweisen zu begreifen und denkend zu ordnen.
- Fachwissenschaft ist damit ein "zumindest prinzipiell richtungsgleiches Verfolgen der auch im vorwissenschaftlichen Streben ... wirksamen Fragen." (13) Wenn aus praktischem Bedürfnis sich spezifische Fragen herausgebildet haben, die mit rational gesicherten und verfeinerten Methoden in den Fachwissenschaften fortgesetzt werden, kann ein Verzicht auf diese Betrachtungsweisen nur durch einen Verzicht auf bestimmte gesellschaftlich-praktische Erfahrung erkauft werden.
Aus dem erkenntnistheoretischen Primat der Frageweisen folgt, dass sie sich nicht mit beliebigen Methoden verbinden lassen. Erkenntnismethoden (Verfahrensweisen und Forschungstechniken) müssen vielmehr mit den Frageweisen kompatibel sein, denn der Gegenstand wird nicht nur durch die Frageweise konstituiert, sondern er wird auch durch die Erkenntnismethoden mitkonstituiert. Verfahrensweisen und Untersuchungstechniken, derer sich die Erkenntnisweisen bedienen müssen, schlagen auf die Frageweise zurück und können, falls dieser Zusammenhang vernachlässigt wird, eine ganz andere als durch diese Frage angestrebte Aussageintention erzeugen.
Historisches Denken kann definiert werden als narrative Sinnbildung über Zeit auf Grund von Authentizitätserfahrungen. Im Narrativieren erfolgt die Wahrnehmung von Wirklichkeitsaspekten unter dem Gesichtswinkel von Zeit. Im Dienst des Narrativierens stehen die Operationen des Interpretierens, Quantifizierens, Analysierens und des dialektischen Denkens.
Dazu meine dritte These:
- Fachübergreifende Konzepte, die Fächer als Denkweisen aufheben, bedeuten einen radikalen Erkenntnisverlust und sind dem gegenwärtigen Stand der technisch-wissenschaftlichen Zivilisation nicht angemessen. Historisch gesehen befördern sie Unterricht in die 50er Jahre zurück.
2. Wissenschaftshistorie - Disziplinierung und Entdisziplinierung
(1) Unter wissenschaftshistorischem Blickwinkel wird deutlich, dass sowohl Unterrichtsfächer als auch Fachdisziplinen eine (zumindest) zweihundertjährige Geschichte haben. Historisch gesehen legen die Vertreter des fachübergreifenden Lernens in der aktuellen Diskussion einen zweifelhaften Begriff von Fach zu Grunde. "Fach" ist hier eine pädagogisch-didaktische Fiktion. Die Pädagogik tut so, als ob es "Fächer" gäbe, die im Unterricht gelehrt werden sollen. Mit Fiktion meine ich zunächst einmal nichts Negatives. Eine solche Unterstellung mag durchaus fruchtbar sein. Kritik verdient allerdings die Meinung, dass es sich in der 200-jährigen Schulgeschichte um das gleiche Fach "Geschichte" handelt. Grenzen von Fächern sind nicht theoretische, sondern historische Grenzen. Sie haben sich historisch herausgebildet und gelten nicht absolut. Sie sind mit einer Muschel vergleichbar, die sich im historischen Prozess mal zu den Nachbardisziplinen öffnet oder schließt.
- Die Wandlungsprozesse, die ein solches Fach durchgemacht hat, werden in der aktuellen Diskussion unterschlagen - es wird lediglich zugestanden, dass neue Ergebnisse zum alten Fach hinzugekommen seien. Die didaktische Fiktion von "Fach" unterstellt etwas, was es so nicht mehr gibt. Die Korrespondenzwissenschaft, auf der die Fach-Fiktion aufruht, hat sich radikal verändert. Hatte es zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als das Fach Geschichte in die neu organisierte Schule kam, noch eine gewisse Berechtigung gegeben, vom "Fach Geschichte" zu sprechen, so ist es heute nicht mehr so einfach. Es gibt heute nicht mehr "das" Fach Geschichte, das es so zu Beginn des 19. Jahrhunderts gegeben hat. An seine Stelle sind heute Altertumswissenschaft, Mediävistik, Wirtschaftsgeschichte, Zeitgeschichte (etc.) und Migrationsforschung, Residenzforschung (etc.) getreten. Eigentlich müsste ich, allein bezogen auf das Fach Geschichte an meinem historischem Institut, von zehn Fächern sprechen, die sich in unterschiedlichen Anteilen und wechselnden Gewichtungen im Schulfach Geschichte wieder finden. Der Anteil der Altertumswissenschaft tendiert momentan gegen 0, die Neueste Geschichte gegen 80 % etc. Die anderen, Teilgebiete genannt - eigentlich selbst Disziplinen -, teilen sich den Rest. Was kann angesichts dieser Situation "fachübergreifendes Lernen" bedeuten?
- Angesichts dieser Tatsache ist es die Aufgabe des Geschichtsdidaktikers
- in Geografie, Deutsch etc. dürfte es ähnlich sein -, innerhalb
des Faches Geschichte "fachübergreifend" zu wirken. Das ist
im wahren Sinne des Wortes gemeint und bedeutet nicht nur das Zusammenführen
von Forschungsergebnissen der vielen Teilgebiete. Die Methoden, Quellen und
Forschungstechniken, die die Ergebnisse konstituieren, sind äußerst
divergent. Die Forschungsfragen und Forschungstechniken waren im 19. Jahrhundert
um die philologisch-hermeneutische Methode zentriert. Diese Einheit gibt es
nicht mehr. Seitdem die klassische philologisch-hermeneutische Methode zerbrochen
ist, wird in den einzelnen Teilgebieten mit unterschiedlichen Verfahrensweisen
und Quellengattungen gearbeitet. Die Wirtschafts- und Sozialgeschichte arbeitet
mit seriellen Quellen und hoch aggregierten quantitativen Daten. Die Politikgeschichte
mit autororientierten Quellen, die Alltagsgeschichte dagegen betreibt Spurensuche
in Dokumenten, die für keine Nachwelt hergestellt wurden.
Ich weiß nicht, wie das in anderen Fächern ist, aber die Geschichtsdidaktik hat es mit dem Problem der fachübergreifenden Sichtweise im eigenen Fach zu tun. Der Didaktiker wird hier zum modernen Sisyphus, der mit seinem Töpfchen diejenigen Wasserstrahlen auffangen muss, die aus dem Fach Historische Forschung ununterbrochen nach den unterschiedlichsten Richtungen quellen. - Der Eindruck, dass die Teilfachgebiete ständig neue Aufspaltungen
und Zersplitterungen produzieren, die die Geschichtsdidaktik wieder integrierend
zusammenfassen muss, ist nur teilweise richtig. Es handelt sich auch nicht
um einen Vorgang, der sich allein innerhalb der Geschichtswissenschaft abspielt,
und somit eine innerwissenschaftliche Zellteilung darstellt. Die einzelnen
Zweige der Geschichtswissenschaft haben sich selbst in neuester Zeit umorientiert
und eigene fachübergreifende Sichtweisen ausgebildet. Wirtschaftsgeschichte
arbeitet mit ökonomischen, Sozialgeschichte mit soziologischen Theorien.
Manche Teilgebiete deuten bereits durch ihren Namen an, dass sie fachübergreifend
orientiert sind. Dafür stehen die historischen Disziplinen "Begriffsgeschichte" (14),
"Ethnohistorie" (15) und der
"Psychohistorie" (16). Auch
die "Historische Anthropologie" (17)
und die "Umweltgeschichte" ist hier zu nennen. Die moderne Geschichtswissenschaft
arbeitet somit selbst fachübergreifend, indem sie Aspekte von Linguistik,
Psychologie, Anthropologie und Ökologie integriert.
Auf Grund dieser Tatsache ist zu fragen, ob heute die Wissenschaftsdisziplinen nicht viel stärker fachübergreifend arbeiten, als es die pädagogische Diskussion wahrhaben will. Sollte man nicht vielmehr die innerwissenschaftlichen Impulse zum fachübergreifenden Denken aufgreifen, anstatt so zu tun, als müsse man den Disziplinen ihre vermeintliche narzisstische Selbstbespiegelung austreiben?
Meine vierte These ist:
- Die Diskussion um fachübergreifendes Lernen geht von der Fiktion eines Faches aus, das es heute so nicht mehr gibt. In der Disziplinentwicklung der letzten 90 Jahre sind effektivere Konzepte der Entdisziplinierung entwickelt worden, als die von den Vertretern des fachübergreifenden Lernen wahrhaben wollen. Ihre Diskussion nimmt die fachübergreifenden Bemühungen innerhalb der einzelnen Fächer gar nicht zur Kenntnis.
(2) Historisch gesehen lassen sich die einzelnen Fächer nicht isoliert betrachten. Sie sind stets in wandelnde "Großkonzeptionen" eingebunden gewesen und teilten deren Prämissen. Geschichte gehörte einmal zu den Geisteswissenschaften, später zu den Sozialwissenschaften und gegenwärtig ist ein Trend zu den Kulturwissenschaften unübersehbar. Seit 30 Jahren gibt es in der Wissenschaft unterschiedliche Versuche, Fächer bzw. Disziplinen in einen bestimmten Zusammenhang zu stellen und ihre Gemeinsamkeiten zu betonen. In den 70er Jahren war es das Konzept der Sozialwissenschaft, gegenwärtig ist an seine Stelle das Konzept der Kulturwissenschaft getreten.
Sozialwissenschaften sind diejenigen Disziplinen, die ihre durch die eigene Fragestellung erzeugte faktische Wirkung auf die soziale Lebenspraxis reflektiert in ihr Forschungsinteresse aufgenommen haben. Soziologie und Politologie waren in den 70er/80er Jahren führend, dieses Konzept durchzusetzen. Teile der Geschichtswissenschaft schlossen sich an, indem sie sich als "historische Sozialwissenschaft" verstanden (18). Die Hoffnung, der Forderung nach Integration und fachübergreifendes Lernen durch eine sozialwissenschaftliche Umorientierung der Fachdisziplinen nachzukommen, hat sich zwar nicht erfüllt, die sozialwissenschaftlichen Fächer sind sich aber erkennbar näher gekommen. Der Begriff "Sozialwissenschaften" legte eine Addition kompatibler und homogener Disziplinen und zwang die Fachvertreter, nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Gewinner dieser Debatte ist ohne Zweifel die Geschichtswissenschaft gewesen. Sie konnte ihr faktografisches und theoriefeindliches Image ablegen.
In der Diskussion um die sozialwissenschaftliche Umorientierung ist aber auf eine gravierende Differenz zu achten: Es ist von eminenter Bedeutung, ob die Disziplin sich als Ganzes als Sozialwissenschaft begreift, oder ob damit nur eine Spezialdisziplin (Sozialgeschichte, Sozialgeografie) neben anderen Spezialdisziplinen (Mittelalterliche Geschichte, Wirtschaftsgeografie) gemeint ist. Bezieht sich das Verständnis als Sozialwissenschaft nur auf eine dieser Spezialdisziplinen, so hat das für die Integrationsproblematik tief greifende Folgen. Die Umorientierung und Definition als Sozialwissenschaft kann nämlich nicht durch Amputation, durch eine radikale Abtrennung einzelner Wissenschaftsgebiete erfolgen. Teilbereiche (Wirtschafts- und Sozialgeografie, Wirtschafts- und Sozialgeschichte) können nicht als fortschrittlichste Varianten der Gesamtdisziplin angesehen werden, um dann durch Zusammenfassung dieser Teilbereiche das Integrationsproblem zu "lösen". Die Widersprüchlichkeit einer solchen Integrationsstrategie ist offenkundig. Im Bemühen, sich nicht in enge Fächerungen einsperren zu lassen, gründet eine so verfahrende Didaktik sich nicht auf eine (!) "breite" Sozialwissenschaft als Bezugswissenschaft, sondern auf enge Spezialdisziplinen. Anstatt die isolierenden Wände der Zellen zu beseitigen, sind sie nur enger gezogen worden. Diese Gefahr hat sich im Rückblick auf 20 Jahre so nicht eingestellt. Die Beziehungen zwischen den Fächern sind unzweifelhaft enger geworden und haben sich ganz sicher nicht voneinander entfernt.
Kulturwissenschaften (19) sind Disziplinen, die ihre disziplinäre Gemeinsamkeit in einem neuen Kulturparadigma suchen. Sie gehen über den Gesellschaftsbegriff der Sozialwissenschaften hinaus und beziehen auch Symbolbildungsprozesse ein. Das Konzept Kulturwissenschaft wird je nach historischer Entwicklung des Faches anders akzentuiert. So heißen die Bemühungen in der Geschichtswissenschaft "Neue Kulturgeschichte", weil es im 19. Jahrhundert eine Kulturgeschichtsschreibung gegeben hat, die nach heutigem Sprachgebrauch Alltagsgeschichte bedeutet. (20) Die Volkskunde hat sich nach der Belastung ihrer Disziplin in der NS-Zeit in "empirische Kulturwissenschaft" umbenannt.
Die Diskussion um Kulturwissenschaft sieht in einem Kulturbegriff ihren zentralen Bezugspunkt. "Kultur ist nicht das, was übrig bleibt, wenn man Politik und Wirtschaft abzieht, sondern Kultur ist das Ganze, die Gesamtheit der Hervorbringungen des Menschen auf allen Gebieten des Lebens." (21) Statt Gesellschaft tritt jetzt Kultur ins Zentrum und damit auch Erfahrungen und Symbolbildungen. Das Handeln der Menschen wird nicht allein durch ihre ökonomischen und gesellschaftlichen Interessen gelenkt, sondern ebenso von kulturell bedingten Denk- und Verhaltensmustern. Ging es bei der Sozialgeschichte noch um die Kategorie des Interesses, so geht es jetzt um die der Erfahrung.
Das lässt sich an dem Thema erläutern, an dem ich vor kurzem gearbeitet habe: Tiere in der Geschichte (22). Eine Sozialgeschichte würde sich mit der Überlebensfähigkeit des Menschen durch Tierzucht, Herrschaftsausübung durch Einsatz von Pferden und Territorialsicherung durch Hunde beschäftigen, die den privaten Hof, aber auch die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten sicherten. Diese Themen bearbeitet die neue historische Kulturwissenschaft auch, aber sie geht darüber hinaus, indem sie die Diskurse und das imaginäre Universum der Tiere betrachtet, jene Tiere, die ein Produkt menschlichen Denkens sind. Sie sucht die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts wachsenden Emotionalitätstransfers von Mitmenschen auf Tiere und interessiert sich für den qualitativen Umschwung: man dürfe Menschen verletzen, um Tiere zu schützen. Bereits in den 50er Jahren hat Theodor W. Adorno geahnt: Es werde die Zeit kommen, wo man den hündischen Kutscher, der sein Pferd schlägt, vom Bock herunterschießt.
Die Konzepte von Sozialwissenschaft und Kulturwissenschaft schaffen durchaus verschiedene Allianzen. Während Sozialwissenschaft vor allem Politik, Soziologie, Ökonomie und Geschichte zu integrieren suchte, sind es bei der Kulturwissenschaft auch Sprachen und Philosophie, während Ökonomie nicht einbezogen wird. Diese wechselnden Verbindungen sind durchaus vorteilhaft, denn auf diese Weise bleiben die Grenzen offen und Dogmatismus wird verhindert.
Warum haben die Didaktiker die Diskussion um Sozialwissenschaften nicht aufgenommen, warum nehmen sie im Moment nicht den Diskurs um Kulturwissenschaft auf? In beiden Debatten boten und bieten sich genügend Ansätze, um interdisziplinäre und fachübergreifende Themenstellungen zu finden. Ich will auch gleich die Antwort geben. Für diese Nichtwahrnehmung von Angeboten und Chancen sind Fachdidaktiken und Kultusbürokratien gleichermaßen verantwortlich. Die Didaktiker nehmen solche Diskurse überhaupt nicht zur Kenntnis; sie beteiligen sich gar nicht an ihnen und haben sich seit Jahrzehnten aus diesen Debatten herausgehalten und verstehen sie jetzt zum großen Teil auch gar nicht mehr. Die Kultusbeamten setzen für Geschichte, Sozialkunde, Geografie etc. separate Richtlinienkommissionen ein, die jede ihre facheigenen Kataloge der Gegenstände vorlegt. Wenn auf diese Weise Fachrichtlinien ohne Schnittmengen produziert worden sind, verlangen die Kultusgewaltigen im Nachhinein, dass fachübergreifendes Lernen berücksichtigt werden soll.
Meine fünfte These lautet:
- Die Fachdidaktiken können fachübergreifendes Lernen in wissenschaftlich vertretbarer Weise nur organisieren, wenn sie sich an der kulturwissenschaftlichen - gesellschaftswissenschaftlichen bzw. sozialwissenschaftlichen - Diskussion beteiligen. Hier finden sie diejenigen lebenswelterschließenden Themen, die sie für ihre "Gemeinsamen exemplarischen Gegenstände" benötigen.
3. Wissenssoziologie - Gesellschaft als lernendes System
Fragen wir nach den Beteiligten an der Debatte. Ich habe eingangs auf die verbreitete Behauptung hingewiesen, der wissenschaftliche Blick zergliedere die Wirklichkeit und lasse nur aspekthafte Bruchstücke zurück. Die ursprüngliche Ganzheit und Ungeteiltheit gehe verloren. Hinter vielen Konzepten zum fachübergreifenden Lernen steht die Vorstellung, der von der Wissenschaft hinterlassene Scherbenhaufen müsste durch pädagogische Konzepte wieder zu einer Ganzheit zusammengeführt werden. Diese Vorschläge zum fachübergreifenden Lernen tun so, als ob in den Disziplinen - Wissenschafts- und Schulfächer - alles esoterisch zuginge, in der so genannten Wirklichkeit aber alles ungefächert sei. Die Annahme einer ungefächerten, d. h. vorwissenschaftlichen Wahrnehmung und Wirklichkeit, ist aber eine Fiktion. Wer vermisst eigentlich die Ganzheitlichkeit, die Sicht auf eine ungefächerte Wirklichkeit? Ich kenne keine Studien, die aufzeigen, dass Schülerinnen und Schüler die fehlende Ganzheitlichkeit beklagen oder unter ihr leiden (23). Wer darüber lamentiert - und das sei fast ohne Polemik gesagt - sind weniger Lehrerinnen und Lehrer, sondern Hochschulpädagogen und Kultusbeamte, die von der Dynamik moderner Wissenschaft zutiefst beunruhigt sind. Sie sehnen sich in wissenschaftsberuhigte Zonen zurück. Wenn man aus eigener Anschauung weiß, welchen Druck Kultusbeamte auf Richtlinienautoren ausüben, um "Fachübergeifendes" in Richtlinien und Schulpraxis zu bekommen, und dann sieht, welches Schicksal diese Papiere in der Schulpraxis haben, ist gründlich desillusioniert. Dort ist weniger kreativer fachübergreifender Unterricht zu beobachten, als vielmehr das schlechte Gewissen der Lehrerinnen und Lehrer, gelungenen fachübergreifenden Unterricht nicht realisiert zu haben.
(1) In der Debatte wird unterschlagen, dass Gesellschaften lernende Systeme sind und die Sprache ihr Lernmedium. Wenn wir Begriffe gebrauchen wie Rolle, Verantwortung oder auch nur von Freud'scher Fehlleistung, Minderwertigkeitskomplex, Charisma, Biotop sprechen, benutzen wir verkürzte Theorieannahmen aus den Fachdisziplinen Soziologie, Ethik, Psychoanalyse etc. Wir können diese Begriffe nicht mehr naiv verwenden. Hinter ihnen verbergen sich in Alltagswissen abgesunkene Theoriekonzepte von Disziplinen.
Wir können nicht so tun, als wenn 200 Jahre moderne Wissenschaft keine Spuren außerhalb der Gelehrtenstuben und Labors hinterlassen hätte. Gesellschaften sind kollektive Lerngemeinschaften, die auf kumulativen Lernprozessen über die Generationen hinweg beruhen. (24) Bei Maurice Halbwachs heißt dieser Vorgang "kollektives Gedächtnis", bei Norbert Elias "Zivilisationsprozess". Das Medium, in dem sich die Lernprozesse vollziehen und in dem diese Ergebnisse aufbewahrt werden, ist die Sprache. Am Anfang des 19. Jahrhunderts, zu Beginn des Nationsbildungsprozesses und der neuzeitlichen Wissenschaftsentwicklung, gab es z. B. keine gemeinsame Hochsprache. Nordfriesen und Bayern konnten sich kaum verständigen. Wissenschaftssoziologisch begann dann ein Prozess, gemeinsames Wissen über regionale und soziale Gruppen auszuweiten. Diese Distribution des Wissens (25) über soziale, regionale und Klassengrenzen hinaus sicherzustellen, war ein wichtiges Moment im Nationsbildungsprozess. Dabei wurde wissenschaftsförmiges Wissen in Alltagswissen bis zu einem bestimmten Maße transformiert. Überspitzt formuliert könnte man sagen, dass ein erwachsener Mensch am Ende des 18. Jahrhunderts über genauso viel Wissenschaftswissen verfügte, wie heute ein Kind, wenn es eingeschult wird.
Insofern ist die Vorstellung eines "ganzheitlichen Wissens" ein vormodernes Konzept, das in die Zeit des Polyhistorismus des 17. Jahrhunderts gehört.
Eine Bestätigung für diese Thesen sind die vor 20 Jahren modernen "allgemeinen Lernziele". Sie waren keineswegs "allgemein", sondern benutzen mit bestimmten Fachtermini stets fachspezifische Theorien und stellen damit bereits Relationen in der Wirklichkeit her. Die linguistische Analyse legt zudem über die Zeitreferenz der Lernzielformulierungen die Bezogenheit auf Geschichte dar. Alle bisher angebotenen Systeme allgemeiner Lernziele waren logisch, grammatikalisch und semantisch eine Addition fachspezifischer Begriffe und Theorien. Weder in der Wahl der Termini noch in der Sprachstruktur konnten "allgemeine" Lernziele den fachspezifischen Denkweisen entrinnen. Die Begriffe verkündeten auch dann noch ihre Fachlichkeit, wenn die Lernzielverfasser sich nicht der epistemologischen Struktur der Wissenschaften bewusst waren. (26)
Dazu meine These:
- Es gibt in den modernen westlichen Gesellschaften keine theorieunabhängige Alltagssprache mehr. Sie ist theoriegeladen und insofern können wir nicht mehr überfachlich - "ganzheitlich" - an Alltagsphänomene, Erfahrungsgegenstände herangehen.
(2) Als nächstes stellt sich die Frage nach der Instanz. Wer formuliert den "gemeinsamen Gegenstand", wer benennt diejenigen Probleme, die in fachübergreifende Lernprozesse einbezogen werden? Wenn sie "allgemein" sein sollen, können sie nicht von einer einzelnen Fachwissenschaft oder Fachdidaktik formuliert werden. Auch ein Gremium unterschiedlicher Fachvertreter kann nicht angenommen werden, da allgemeine Lernziele ihrem Anspruch nach nicht durch eine Addition von Fachaspekten gewonnen werden dürfen. Die einzelnen Vertreter der Fachwissenschaft und Fachdidaktik können sich zudem nicht gleichsam selbst in ihrer Sichtweise auslöschen und eine Metawissenschaft durch Zusammensitzen begründen. Die Probleme, die als gemeinsame Gegenstände fungieren sollen, müssen aus einer Analyse gesellschaftlicher Wirklichkeit hervorgehen. Wer unternimmt diese Analyse, mit welchen Methoden und welchen Instrumenten, wenn eine fachneutrale Methode nicht existiert? Der Versuch, diese Aufgabe der Erziehungswissenschaft zuzuweisen, greift ebenfalls zu kurz, da die Pädagogik ihrerseits eine disziplinäre Sicht auf gegenwärtige Wirklichkeit hat, obwohl sich ihre Vertreter manchmal als Spezialisten für das Allgemeine verstehen.
Offensichtlich sind sich die Verfechter des fachübergreifenden Lernens nicht über die Konstitution von Problemen im Klaren. Es besteht eine Differenz zwischen gesellschaftlicher Problemdefinitionen und ihrer disziplinären Verarbeitung. Was in einer Gesellschaft ein Problem ist, stellen wir in unserer Eigenschaft als Bürgerinnen und Bürger eines Gemeinwesens fest, auch wenn wir Fachwissenschaftler sind. Die Sensibilität für Problemwahrnehmung ist sozial (und nicht disziplinär) unterschiedlich verteilt. Der Langzeitarbeitslose definiert andere gesellschaftlich-soziale Probleme als der Modernisierungsgewinner. Der Bündelung und Artikulation dieser Probleme nachzugehen, ist eine politologisch-soziologische Aufgabe, und die soll hier nicht näher untersucht werden.
(3) In der schulpädagogischen Diskussion wird die Notwendigkeit fachübergreifenden Lernens auch über angebliche Veränderung gesellschaftlicher Problemlagen begründet. Diese Annahmen enthalten aber historische und politische unhaltbare Implikationen. So wird festgestellt: "Leider definieren sich die Probleme der modernen Gesellschaft nicht mehr als Problemstellungen für disziplinäre Spezialisten." (27) Als Beispiele werden Umweltschutz, Technologiefolgenabschätzung, Gentechnik und Friedenssicherung genannt. Besonders das "nicht mehr" ist nicht belegbar. Es wird eine Entwicklung behauptet, die sich historisch nicht belegen lässt. Wenn man die Verkehrsentwicklung im 19. Jahrhundert am Beispiel des Eisenbahnbaus betrachtet, so zeigt sich, dass das ein technisches, gesellschaftliches kulturelles und ökonomisches Problem gewesen ist und auch damals so gesehen und diskutiert wurde. Es war keineswegs ein Problem für Spezialisten. Die behauptete neue Qualität ist keine.
Solche Probleme werden in der Gegenwart oft mit dem Pathos gesellschaftlicher Verantwortung vorgetragen, - nur, was kommt davon in der Praxis an? Dort werden andere Problem formuliert: Zeit, Lärm, Liebe und Kleidung. (28) Sind das die Probleme, die eine neue Qualität anzeigen? Entweder entweicht man in transzendentale Höhen und plündert die Kant'sche Kategorientafel ("Zeit") oder nimmt Alltagsärgernisse ("Lärm") und kulturelle Universalien ("Kleidung") zum Gegenstand. (29) Eine Bewegung hin zum "kleinsten gemeinsamen Nenner" ist unübersehbar. Offensichtlich geht es gar nicht um gesellschaftliche Probleme, sondern nur um Anlässe für schulisches Handeln. Das ist durchaus legitim, man sollte es aber auch ehrlich zugeben. Manche Autoren machen das dann auch mit erfrischender Offenheit: "Kurbeln sie mal eine Tasse Kaffe warm" (Energiegewinnung mit Muskelkraft) oder "Bau eines Heißluftballons" (mit Teelicht und Seidenpapier). (30) Solange nicht als Probleme Rassismus und Antisemitismus aufgegriffen werden, ist das Pathos des gesellschaftlichen Engagements um moderne Probleme, die "nicht mehr" fachspezifisch bearbeitet werden können, hohl.
(4) Gibt es keine gelungenen Modelle? Es lässt sich nicht bestreiten, dass es gelungene und beeindruckende Projekte gibt, die von ihren Organisatoren mit dem Prädikat "fachübergreifend" belegt werden. Die ernst zu nehmenden Modelle, die auf der Vorstellung beruhen, dass der gleiche Gegenstand von den verschiedenen Disziplinen betrachtet werden kann - also die Prismamodelle -, stehen und fallen mit einem ergiebigen Gegenstand. Auffallend ist aber auch, dass sie umso besser gelungen sind, je weniger "Fächer" sich daran beteiligen. Aus der Existenz solcher Projekte ist allerdings nicht zu schließen, dass es bereits überzeugende theoretische Konzepte für fachübergreifendes Lernen gibt.
Schaut man sich einmal an, welche Themen gewählt werden und was sich an fachübergreifenden Inhalten dahinter verbirgt, ist man enttäuscht. Gegenstände wie "Wasser", Planeten, Liebe, Lärm (31) sind solche Beispiele. Hinter dem Gegenstand Wasser verbergen sich dann folgende Teilthemen, wie aus zwei pädagogisch-didaktischen Zeitschriften (32) zu entnehmen ist: "Schüler experimentieren mit Wasser", "Hochwasser und Muren", "Flüssig, fest und gasförmig. Erscheinungsformen und Eigenschaften des Wassers", "Verantwortlicher Umgang mit Wasser", "Römische Wasserleitungen", "Von der brackigen Brühe zum keimfreien Nass. Der Hygienisierungsprozess im 19. Jahrhundert". Obwohl es bei all diesen Themen nass zugeht, haben "Hochwasser und Muren" und "Römische Wasserleitungen" wenig Gemeinsamkeiten. Ob diese verschiedenen Themen in den Köpfen der Schüler und Schülerinnen wieder ein Ganzes entstehen lassen, bleibt dahingestellt; das will ich an dieser Stelle auch nicht näher untersuchen. Zweifel sind aber angebracht.
Bedenklicher ist aber, dass diese Praxis des fachübergreifenden Lernens hinter den erreichten Stand der Wissenschaften zurückfällt. Dieser "allgemeine" Blick durchstöbert den Wissens- und Ergebnisfundus der Disziplinen bzw. Fächer, um zu diesem Gegenstand etwas Passendes zu finden. Der allgemeinpädagogische Blick bringt dann Elemente aus der disziplinären Mottenkiste hervor. Manchmal müssen sie sich dazu auch richtig abquälen. Im Bergheimer Modell ist zum Gemeinsamen exemplarischen Gegenstand "Lärm" der historische Aspekt "Lärm im antiken Rom" und "Lärm im London des 19. Jahrhunderts" vorgeschlagen worden - als wenn die Geschichte nichts besseres anzubieten hätte. Auf diese Weise wird nicht das eingebracht, worin die Disziplinen besonders stark sind. Die fachwissenschaftlichen Potenziale zur Orientierung in der gegenwärtigen Welt werden gar nicht abgerufen. "Globalisierung als Identitätsverlust?", "Antisemitismus als deutsches Rassemerkmal?", "Nationalismus, Nationsbildung und Phantomstolz" etc. werden von solchen Konzepten nicht als historische Themen nachgefragt. Veraltete Probleme für "disziplinäre Spezialisten" ?
Meine letzte These lautet deshalb:
- Die gegenwärtigen Konzepte von fachübergreifendem Lernen gehen an den Erklärungspotenzialen der modernen Wissenschaften vorbei, lassen sie außen vor. Aus der Sicht der Geschichtswissenschaft bedeutet das: Was von historischen Themen in die Konzepte des fachübergreifenden Lernens eingeht, verzichtet auf die Orientierungsleistungen der gegenwärtigen Geschichtswissenschaft.
Anmerkungen
(1) Ulshöfer, Robert (1971); Behrmann, Günter C.; Jeismann, Karl E.; Süssmuth, Hans (1978).
(2) Vgl. Bergmann, Klaus; Pandel, Hans-Jürgen (1975); Maek-Gérard, Eva; Muhlack, Ulrich; Zitzlaff, Dietrich (1974).
(3) Vgl. Pandel, Hans-Jürgen (1978).
(4) Pandel, Hans-Jürgen (1978).
(5) Vor 23 Jahren habe ich mich auf die "Fächer" Geschichte, Geographie und Sozialkunde bezogen. Das erscheint mir heute viel zu eng.
(6) Hofmann, Werner (1969), S. 50.
(7) Fleck, Christian; Müller, Albert (1997); hier S. 112.
(8) Sämmer, Günter ; Wagner, Andrea (1997).
(9) Vor 22 Jahren war mein Katalog der methodischen Zugänge stärker an den Sozialwissenschaften orientiert. Heute fühle ich mich dagegen mehr den Kulturwissenschaften verpflichtet. Darin steckt weniger Anpassung an den modernen Trend als vielmehr eine stärkere Orientierung an der Geschichtsdidaktik als an der Geschichtswissenschaft zugrunde. Vgl. Pandel, Hans-Jürgen (1978).
(10) Hentig, Hartmut von (1997), S. 52.
(11) Droysen, Johann Gustav (1971), S. 18.
(12) Rust, Holger (1977), S. 550.
(13) Lucas, Friedrich J. (1965), S. 285.
(14) Koselleck, Reinhart (1978).
(15) Wernhart, Karl R. (1986).
(16) deMause, Lloyd (1989); Spillmann, Kurt R.; Spillmann, Kati (1988).
(17) Habermas, Rebecka; Minkmar, Nils (1992); Dressel, Gert (1996).
(18) Wehler, Hans-Ulrich (1973); Groh, Dieter (1973).
(19 )Zur kulturwissenschaftlichen Neuorientierung vgl. Wolfgang Frühwald (1991); Böhme, Hartmut u.a. (2000).
(20) Vgl. Schleier, Hans (2000); vom Bruch, Rüdiger u.a. (1989 / 1996).
(21) Oexle, Otto Gerhard (1996), S. 25; vgl. auch: Geschichte und Gesellschaft 20 (1994), S. 445-468.
(22) Pandel, Hans-Jürgen (1998), S. 7-14. Themenheft der Zeitschrift Geschichte lernen. Das Thema hat der "Schülerwettbewerb um den Preis des Bundespräsidenten" für seine Ausschreibung 2000 aufgegriffen.
(23) Dass Schülerinnen und Schüler an dem grauen Potpourri der 45-Minuten-Schnipsel des Unterrichts leiden, soll allerdings nicht bestritten werden.
(24) Eder, Klaus (1985).
(25) Vgl. Pandel, Hans-Jürgen (1990).
(26) Zur Empirie am Beispiel der hessischen Rahmenrichtlinien von 1972 vgl. Pandel, Hans-Jürgen (1978)
(27) Gudjons, Herbert (1997), S. 41
(28) einzig akzeptabel: Planeten - Weltbilder und Wahrnehmungen; Sämmer, Günter; Wagner, Andrea (1997), S. 46 f.
(29) Sämmer, Günter; Wagner, Andrea (1997); Frommer, Helmut (1997), S. 115-127
(30) Frommer, Helmut (1997), S. 115 ff.
(31) Sämmer, Günter; Wagner, Andrea (1997)
(32) Lernchancen 1 (1998), H. 1 und Geschichte lernen. 8 (1995) H. 47
Literatur
Behrmann, Günter C.; Jeismann, Karl E.; Süssmuth, Hans (1978): Geschichte und Politik. Didaktische Grundlegung eines kooperativen Unterrichts, Paderborn.
Bergmann, Klaus; Pandel, Hans-Jürgen (1975): Geschichte und Zukunft, Frankfurt/M.
Böhme, Hartmut u.a. (2000): Orientierung Kulturwissenschaft, Reinbek.
Bruch, Rüdiger vom u.a., Hg. (1989/1996): Kultur und Kulturwissenschaft um 1900, 2 Bde., Wiesbaden.
deMause, Lloyd (1989): Grundlagen der Psychohistorie, Frankfurt/M.
Dressel, Gert (1996): Historische Anthropologie. Eine Einführung, Wien.
Droysen, Johann Gustav (1971): Historik, München.
Eder, Klaus (1985): Geschichte als Lernprozess, Frankfurt/M.
Fleck, Christian; Müller, Albert (1997): "Daten" und "Quellen". In: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 8, H. 1, 101-126.
Frommer, Helmut (1997): Über das Fach hinaus. In: Keuffer, Josef; Meyer, Meinhart (Hg.): Didaktik und kultureller Wandel, Weinheim, S. 115-127.
Frühwald, Wolfgang u.a (1991): Geisteswissenschaften heute. Eine Denkschrift, Frankfurt/M.
Groh, Dieter (1973): Kritische Geschichtswissenschaft in emanzipatorischer Absicht. Überlegungen zur Geschichtswissenschaft als Sozialwissenschaft, Stuttgart.
Gudjons, Herbert (1997): Verbinden-koordinieren-übergreifen: Qualifizierter Fachunterricht oder fächerübergreifendes Dilettieren? In: Pädagogik 1997.
Habermas, Rebecka; Minkmar, Nils, Hg. (1992): Das Schwein des Häuptlings. Sechs Aufsätze zur historischen Anthropologie, Berlin.
Hentig, Hartmut von (1997): Polyphem oder Argos? Disziplinarität in der nicht disziplinären Wirklichkeit. In: Kocka, Jürgen, (Hg.): Interdisziplinarität, Frankfurt/M.
Hofmann, Werner (1969): Wissenschaft und Ideologie. In: Hofmann, Werner, Universität, Ideologie, Gesellschaft, 4. Aufl., Frankfurt/M.
Koselleck, Reinhart, Hg. (1978): Historische Semantik und Begriffsgeschichte, Stuttgart.
Lucas, Friedrich J. (1965): Zur Geschichts-Darstellung im Unterricht. In: GWU (Geschichte in Wissenschaft und Unterricht) 16, H. 5.
Maek-Gérard, Eva; Muhlack, Ulrich; Zitzlaff, Dietrich (1974): Zur Rolle der Geschichte in der Gesellschaftslehre: Das Beispiel der hessischen Rahmenrichtlinien, Stuttgart.
Oexle, Otto Gerhard (1996): Geschichte als Historische Kulturwissenschaft. In: Wolfgang Hardtwig; Hans-Ulrich Wehler, (Hg.): Kulturgeschichte Heute. Göttingen.
Pandel, Hans-Jürgen (1978): Integration durch Eigenständigkeit? In: Schörken, Rolf, (Hg.): Zur Zusammenarbeit von Geschichts- und Politikunterricht, Stuttgart, 346-379.
Pandel, Hans-Jürgen (1990): Historik und Didaktik. Das Problem der Distribution historiographisch erzeugten Wissens in der deutschen Geschichtswissenschaft von der deutschen Spätaufklärung bis zum Frühhistorismus (1765-1830), Stuttgart.
Pandel, Hans-Jürgen (1998): Tiere in der Geschichte. In: Geschichte lernen 11, H. 64, S. 7-14.
Rust, Holger (1977): Dialektik als Gestaltungsprinzip gesellschaftswissenschaftlicher Argumentation. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 29, H. 3.
Sämmer, Günter ; Wagner, Andrea (1997): Projektorientierter und fächerverbindender Unterricht auf der gymnasialen Oberstufe. Das "Bergheimer Modell". In: Pädagogik. 49, 44-49.
Schleier, Hans (2000): Historisches Denken in der Krise der Kultur. Fachhistorie, Kulturgeschichte und Anfänge der Kulturwissenschaften in Deutschland, Göttingen.
Spillmann, Kurt R.; Spillmann, Kati (1988): Friedrich Wilhelm I. und die preußische Armee. Versuch einer psychohistorischen Deutung. In: HZ (Historische Zeitschrift) 246, S. 549-589.
Ulshöfer, Robert (1971): Theorie und Praxis des kooperativen Unterrichts. Stuttgart.
Wehler, Hans-Ulrich (1973): Geschichte als Historische Sozialwissenschaft, Frankfurt/M.
Wernhart, Karl R., Hg. (1986): Ethnohistorie und Kulturgeschichte, Köln.
Rohlfes, Joachim (2004): Historischer und politischer Unterricht – ein pragmatischer Blick
In der Diskussion um das Verhältnis von politischer und historischer Bildung liegen, so scheint es, alle Aspekte und Argumente auf dem Tisch. Man hat den Eindruck eines weitgehenden Konsenses, und es sind allenfalls Nuancen, in denen sich die Protagonisten unterscheiden. Historischer und politischer Unterricht, so kann man resümieren, stimmen in ihren Anliegen weithin überein: Sie verfolgen gleiche oder außerordentlich ähnliche Lernziele, beziehen sich auf überwiegend identische Leitkategorien und Schlüsselqualifikationen, bearbeiten vielfach dieselben Gegenstandsfelder und bedienen sich großenteils übereinstimmender Lehr- und Lernverfahren.
Auch ihre Bezugswissenschaften stehen einander sehr nahe und überlappen sich mannigfach. Die Geschichtswissenschaften haben es stets und heute mehr denn je auch mit politologischen, soziologischen, ökonomischen, geografischen und juristischen Fragestellungen und Konzeptionalisierungen zu tun. Historiker müssen sich einigermaßen in diesen Nachbardisziplinen auskennen, wenn sie sich etwa mit der Parteiengeschichte des 19. Jahrhunderts, der Rolle der Intellektuellen im Zeitalter der Aufklärung, der Weltwirtschaftskrise seit 1929, der Urbanisierung in den letzten zwei Jahrhunderten oder der Verfassung des Deutschen Bundes von 1815 beschäftigen. Umgekehrt können die "systematischen" Sozialwissenschaften die historische Dimension nicht ausklammern, wenn sie ihren Gegenständen gerecht werden wollen: Der Politologe muss einiges von der russischen Agrargesellschaft des 19. Jahrhunderts kennen, wenn er Lenins revolutionäre Strategie von 1917 richtig interpretieren will; der Soziologe braucht konkrete Vorstellungen von der vormodernen Ständegesellschaft, um die Struktur der Klassengesellschaft zu durchschauen; der Ökonom hängt mit seiner Kapitalismustheorie in der Luft, wenn er sie nicht auf die Realitäten der Industrialisierung beziehen kann; zur Landeskunde des Geografen gehört unabdingbar die Landesgeschichte; der Verfassungsrechtler bedarf der Folie der Weimarer Republik, sofern er dem Grundgesetz von 1949 gerecht werden will.
Die früher oft vorgenommene Unterscheidung zwischen der Historie, die es mit der Vergangenheit zu tun hat, und der Sozialwissenschaft, die sich an der Gegenwart orientiert, ist zwar nicht völlig obsolet geworden, muss aber erheblich eingeschränkt und relativiert werden. Das Fach Geschichte bezieht seine Fragen an die Vergangenheit in entscheidendem Maße aus den Problemen und Erfahrungen jeweiliger Gegenwarten; die sozialwissenschaftlichen Disziplinen müssen in der Lage sein, heutige Zustände und Aufgaben auch in ihrem Gewordensein, in ihrer Herkunft aus weiter zurückliegenden Entwicklungen zu betrachten.
Viele heutige Forschungs- und Erklärungsparadigmen sind überhaupt nicht mehr oder nur sehr begrenzt einzelnen Fachwissenschaften zuzuordnen. Die Hermeneutik ist keine Domäne allein der Geschichtswissenschaft, auch die Politologen, Soziologen und nicht zuletzt die Juristen bedienen sich ihrer. Die kritisch-dialektische Herangehensweise ist mehr oder minder allen Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften gemeinsam. Das analytische Verfahren finden wir in ungefähr gleicher Form bei Soziologen, Ökonomen, Politologen und Historikern. Quantitativ-statistischen Methoden begegnet man nicht nur bei Wirtschaftswissenschaftlern und Geografen, sondern auch bei Historikern, Politologen, Soziologen und mitunter auch in der Jurisprudenz. Ohne eine typologisierende und generalisierende Begriffsbildung kommt ebenfalls keine der genannten Disziplinen zurecht. Die Fächergrenzen sind, wie Reinhold Hedtke überzeugend herausgearbeitet hat, außerordentlich durchlässig geworden, und die Zahl der Subdisziplinen ist so angewachsen, dass die Fächerprofile insgesamt ihre klaren Konturen verlieren (1).
Dennoch dürfte es weiter Sinn machen, auf gewissen unverwechselbaren Wesensmerkmalen der "Großfächer" zu beharren und sie als fundamentale Erklärungskonzepte zu verstehen, die nicht wechselseitig austauschbar sind und darum in ihrer Eigenständigkeit nicht preisgegeben werden dürfen. Das setzt, auf der Ebene der Forschung wie des Unterrichts, der Fächerintegration feste Grenzen. Man pflegt diese nicht mehr hintergehbaren Verschiedenheiten an bekannten Begriffspaaren festzumachen.
Die Neukantianer Windelband und Rickert unterschieden nomothetische und idiografische Disziplinen: dort die nach Regelhaftigkeit und Gesetzen suchenden, normbildenden Fächer; hier die Tatsachen sammelnden, berichtenden, ordnenden, deutenden. Die Neukantianer hatten dabei die Natur- und Geisteswissenschaften im Blick, wir können dies auf die sozialwissenschaftlichen und die historischen Disziplinen übertragen.
Eine andere Gegenüberstellung bezieht sich auf die jeweiligen Perspektiven und Erkenntnisinteressen: Historiker erkunden die res gestae, das tatsächlich Geschehene; Sozialwissenschaftler die res gerendae, die gegenwärtig und zukünftig anstehenden Aufgaben. Die ersteren begnügen sich damit, eine gewesene, aber noch in die Gegenwart hineinwirkende Realität (genauer: das davon rekonstruierte Bild) zu erschließen; die letzteren wollen zwar auch gegenwärtige Realitäten ergründen, dabei aber nicht stehen bleiben, sondern sie beeinflussen, mitgestalten, verändern.
Ein drittes Begriffspaar lautet: narrativ-individualisierend versus systematisch-generalisierend. Der Historiker gibt den Bezug auf das Konkret-Einmalige nie auf, nimmt die Vielfalt der historisch vorfindbaren Sachverhalte wichtig, will sie zwar in ihren allgemeinen strukturellen und prozessualen Zusammenhängen erhellen und deuten, hält sich aber mit definitiven, alle Besonderheiten einschließenden Generalerklärungen zurück und nimmt nicht in Anspruch, die Dinge auf den "einen", alle anderen Deutungen ausschließenden "Punkt" bringen zu können. Der Sozialwissenschaftler dagegen möchte die Mannigfaltigkeit des Faktischen transzendieren, es auf Befunde verdichten, die die zeit- und raumspezifischen Zufälligkeiten und Besonderheiten hinter sich lassen und damit den "Transfer" auf andere Konstellationen ermöglichen, also Entscheidungs- und Handlungskompetenz vermitteln. Um ein Burckhardt-Wort weiterzuspinnen: Historisches Wissen macht "weise für immer", sozialwissenschaftliches "klug für ein andermal".
Ein letztes Begriffspaar stammt von Hans-Jürgen Pandel, der dabei vornehmlich die didaktische Funktion der Fächer im Blick hat. Danach kommt der politischen Bildung dis "Orientierung in der Gegenwart", "für die absehbare Zukunft" und für "politisches Handeln" zu, der Geschichte die "(Handlungs-)Orientierung in der Zeit"; der Politikunterricht habe es mit der "Dimension von Macht und Herrschaft" zu tun, der Geschichtsunterricht mit den "Kontingenzerfahrungen der Lebenspraxis" (2). Abgesehen davon, dass die hier verwendeten Begriffe auf unterschiedlichen Ebenen liegen und dadurch schiefe Kontrastierungen entstehen: Nicht nur der politische, auch und gerade der historische Unterricht hat es mit Macht und Herrschaft zu tun und eine Divergenz lässt sich hier beim besten Willen nicht erkennen - genauso wenig wie hinsichtlich der Zeitdimension, die für beide Fächer konstitutiv ist. Insofern dürfte allenfalls der Stellenwert der Kontingenz als Unterscheidungsmerkmal taugen.
Über die inhaltlich-thematischen Gemeinsamkeiten der beiden Fächergruppen braucht man nicht viele Worte zu verlieren. Sie liegen in erster Linie im Bereich der Zeit- und Gegenwartsgeschichte. Man sieht es den Standardwerken etwa zum Nationalsozialismus weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick an, ob sie von Politik- oder Geschichtswissenschaftlern stammen. Karl Dietrich Brachers große Studie "Die deutsche Diktatur" von 1969 unterscheidet sich von Hans-Ulrich Wehlers Monumentalwerk "Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1914 - 1949" aus dem Jahre 2003, von der unterschiedlichen Literaturbasis und Detailauswahl einmal abgesehen, in ihren Erkenntnisinteressen, Fragestellungen und Kategorien nur in individuellen Nuancen, nicht generell - was unterschiedliche Schwerpunktbildungen, Thesen und Resultate nicht ausschließt. Wie jede Bibliografie ausweist, haben Politologen und Historiker mit fast gleichen Anteilen zur Erforschung des 20. Jahrhunderts beigetragen, sei es zur Weimarer Republik, zum "Dritten Reich", zur Bundesrepublik und DDR, zur europäischen Integration. Gleichwohl haben sie dabei zumeist unterschiedliche Akzente gesetzt - gemäss den oben beschriebenen wissenschaftstheoretischen Prämissen.
Man kann noch viele andere gemeinsame Themenfelder benennen, in denen es absolut keine Fächermonopole gibt: politische Philosophie und Staatslehre; Verfassungsgeschichte; Menschenrechte; politische Kulturen; Parteien und Verbände; Gesellschaftsordnungen; Generationen und Altersstufen; Traditionen; Wirtschaftssysteme; Konjunkturen und Krisen; Industrialisierung; Nationalismus; Imperialismus und Kolonialismus; Erste und Dritte Welt; Europäisierung; Ost-West- und Nord-Süd-Konflikt; Krieg und Frieden; Rechtsordnungen; Staaten und Völker; Länder und Regionen; Urbanisierung; Schichten und Klassen; Ernährung und Gesundheit; Umwelt; Wissenschaft und Forschung; Erziehung und Bildung; Verkehr und Kommunikation; Technik und Arbeitswelt.
Diese und andere Forschungs- und Unterrichtsgegenstände nötigen die beteiligten Fächer auf einander zuzugehen. Das kann in drei Beziehungsstufen geschehen: Die Fächer versorgen sich wechselseitig mit Kenntnissen, die sie mit den eigenen professionellen Kräften nicht zu produzieren vermögen (Kompensation). Sie vereinbaren arbeitsteilige, aber getrennte Bearbeitungen komplexer Themenfelder (Koordination). Sie nehmen disziplinär eigenständig, aber aufeinander abgestimmt Forschungs- oder Vermittlungsaufgaben mit dem Ziel in Angriff, gemeinsame Ergebnisse vorzu1egen (Kooperation). Die theoretisch mitunter postulierte Verschmelzung (Integration) der Fächer dürfte ein Irrweg sein. Sie ist bislang nicht nur in der Praxis gescheitert, sondern entbehrt auch jeder wissenschaftshistorischen und theoretischen Plausibilität. Unser Wissenschaftsbetrieb hat sich ständig weiter differenziert und spezialisiert und verdankt vor allem dieser Entwicklung seine Erfolge. Jede Entdifferenzierung wäre ein Rückschritt, auch im Bereich der Schule. Das schließt Bemühungen, den Kosmos der Fächer in seinem Zusammenhang zu betrachten, keineswegs aus. Aber eine solche Zusammenschau geschieht auf einer anderen Ebene und darf nicht mit einer innerfachlichen Integration verwechselt werden.
Alle bisher vorgetragenen Überlegungen bewegen sich auf Stufen hoher Allgemeinheit und Abstraktion. Deren Relevanz für den täglichen Schulbetrieb dürfte aber eher gering sein. Hier stehen andere Faktoren im Vordergrund: das Können und die persönliche Ausstrahlung der Lehrenden; das soziale und geistig-kulturelle Klima in den Lerngruppen; die motivierende Kraft der Unterrichtsgegenstände; die Bedeutung eines Faches für die je persönliche Schul- und vielleicht auch die spätere Berufskarriere; die Qualität der Unterrichtsmedien.
Auf diese letzteren soll im Folgenden die Aufmerksamkeit gelenkt werden, und zwar nicht auf die schon häufiger untersuchten Lehrbücher und sonstigen Unterrichtsmaterialien, sondern auf ein recht peripheres Hilfsmittel: die Lexika und Nachschlagewerke für die Fächer Geschichte und Politik. Die leitende Frage dabei ist, ob sich die oben beschriebenen theoretischen Positionen in diesem Schrifttum widerspiegeln oder ob das Eine mit dem Anderen nur wenig zu tun hat.
Nachschlagewerke wenden sich an unterschiedliche Adressaten. Für unsere Untersuchung kommen natürlich keine Bücher für den wissenschaftlichen Gebrauch und auch keine Spezialwörterbücher (etwa für die christliche Antike oder die Politische Psychologie) in Frage. Einschlägig sind für unsere Zwecke nur die allgemeinen, mit vergleichsweise kurzen Artikeln aufwartenden Fachlexika, die für ein interessiertes Laienpublikum, mithin auch für Gymnasiasten der Oberstufe geschrieben wurden.
Die nachfolgend erörterten Befunde basieren auf einer eher grobmaschigen Durchsicht von je drei Werken zur Geschichte und zur Politik (3) sowie einer detaillierteren Erhebung in Form von Stichproben, die unter den willkürlich ausgewählten Buchstaben A, L und T vorgenommen wurden.
In den untersuchten Lexika findet man hauptsächlich Begriffe, Fachausdrücke, Fakten, Namen. Sie werden in der Regel knapp erläutert; tiefergehende Erörterungen fehlen nicht ganz, sind aber eher die Ausnahme. Auch die Theorieebene der facheigenen Konzepte, Paradigmen, Kategorien, Methoden wird nur selten einbezogen. Der Schwerpunkt der Bücher liegt eindeutig bei den Kurzdefinitionen und Sachinformationen. Diese können durchaus anspruchsvoll ausfallen, bleiben aber in der Regel eine gründ1iche Vertiefung schuldig. Das schränkt natürlich den Aussagewert unserer Befunde ein.
Versucht man sich zunächst einmal an einer pauschalen Klassifizierung der in den beiden Lexikongruppen begegnenden Stichwörter, so halten sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede ungefähr die Waage. In den historischen Werken findet man vergleichsweise viele Personen- (einschließlich der Dynastie-)Namen; trotz des Vordringens der Strukturgeschichte in der Geschichtswissenschaft scheint also die biografisch-personengeschichtliche Sichtweise nach wie vor ein erhebliches Gewicht zu haben. Gleichermaßen viel Raum nehmen die Einträge zu Orten, Ereignissen und längerfristigen Entwicklungen ein: Verträge, Aufstände, Schlachten, Kriege, Epochen. Dergleichen Artikel sind in den Politiklexika eher selten. Stattdessen begegnen hier viele termini technici (Änderungsantrag, Listenwahl), dazu auffallend viel Allgemeinbegriffe der heutigen Kultur- und Wissenschaftssprache (Ambivalenz, Loyalität). Das deckt sich mit der gängigen Gegenüberstellung: Faktenorientierung der Historiker, Systembezug der Politologen.
Wie ebenfalls nicht anders zu erwarten, richten sich die Beiträge der Geschichtswörterbücher fast ausschließlich auf die Vergangenheit, die des Nachbarfaches vornehmlich auf die Gegenwart. Allerdings gehen die Politikbücher bei weitem häufiger auf zurückliegende Zeiten ein als die Geschichtsbücher auf die Gegenwart. Hier scheint sich eine Diskrepanz zu sonstigen Unterrichtsmaterialien und insbesondere wohl zur Unterrichtspraxis im Fach Geschichte aufzutun, in denen Gegenwartsbezug und Aktualisierung zu den didaktischen Selbstverständlichkeiten gehören (auch wenn Theorie und Praxis nicht immer übereinstimmen mögen und die Defizite in der Umsetzung nicht zu unterschätzen sind).
Schaut man auf die Sachaspekte, gibt es deutlich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Beide Lexikontypen weisen ein ähnlich breites Angebot bei den Verfassungsordnungen und Regierungssystemen, den Ämtern und Institutionen, dem Rechtswesen und den Rechtskulturen, den Parteien und Verbänden, den Politikbereichen (von der Agrar- bis zur Tarifpolitik), den politisch-gesellschaftlichen Ideen und Bewegungen, dem Militär- und Kriegswesen, der internationalen Politik, den sozialen Gruppen und Schichten, den gesamtgesellschaftlichen Strukturen und Prozessen und selbst bei den großen historischen Epochen auf. Sogar die Lücken sind gemeinsam: vor allem in der Umweltthematik und im Wissenschafts- und Bildungsbereich. Die Unterschiede sind dagegen ziemlich marginal: In den Politikbüchern ist häufiger von wirtschaftlichen und fiskalischen Zusammenhängen die Rede, in den Geschichtsbüchern von kirchlich-religiösen. Hier tauchen auch öfter Hinweise zu den Quellen auf, denen auf politologischer Seite kein Pendant gegenüber steht.
Die interessantesten Befunde ergeben sich beim Einzelvergleich: Wie gehen die beiden Fächergruppen mit ausgewählten identischen Begriffen um? Um den Gesamteindruck vorwegzunehmen: Die Geschichtslexika halten sich mehr an die konkreten, faktografisch festzumachenden Sachverhalte; die Politikwerke versuchen sich gern an Bestimmungen dessen, was man Wesensmerkmale nennen mag. Das ist alles andere als überraschend, sondern bestätigt die gängigen Topoi. Dabei darf man freilich den gegenläufigen Trend nicht übersehen: Den politologischen Darstellungen mangelt es keineswegs an Verweisen auf konkretes Historisch-Faktisches, den historischen nicht an Verallgemeinerungen und auf das Prinzipielle zielenden Definitionen.
Charakteristische Beispiele: Die Politiklexika handeln relativ ausgiebig von der "Toleranz" "als solcher", die historischen davon jedoch nur kurz und im Übrigen von der "Toleranzakte", dem "Toleranzedikt", dem "Toleranzgeld" und dem "Toleranzpatent", thematisieren also quasi die tatsächlichen Auswirkungen der Toleranzidee. "Adel" ist für die Historiker ein ausgesprochen ergiebiges Stichwort, bei dem sich gelebtes Leben eröffnet; die Politologen verlagern es auf "Aristokratie" und behandeln es unter der Rubrik "Herrschaftsformen". Bei dem Kennwort "Außenpolitik" bleiben die historischen Bücher stumm, während die Politikbücher hier aus dem Vollen schöpfen und sich ausführ1ich in Theorie- und Systematisierungsfragen ergehen. Mit aller Vorsicht mag man diese Beobachtungen verallgemeinern: Die viel berufene theoretische Wende der Geschichtswissenschaft in den Siebzigerjahren hat nicht zu einem Gleichziehen mit den Sozialwissenschaften geführt. Deren theoretisch-systematische, "nomothetische" Dimension ist ungleich stärker entwickelt und dichter besetzt, und die Historiker können (und wollen) damit nicht konkurrieren.
Das wiederholt sich auch auf dem Feld der Didaktik. Der Politikunterricht bietet vielfach übersichtliche Schemata und einprägsame Modelle an, an denen sich Denken, Lernen und Behalten gut orientieren können. Er bezahlt diese begriffliche Klarheit tendenziell mit einem gewissen Mangel an Lebensnähe, Anschaulichkeit, Vorstellbarkeit. Dem bunten Vielerlei, das der Geschichtsunterricht offeriert, fehlt es oft an Übersichtlichkeit und Einprägsamkeit, und die Lernenden tun sich mit der gedanklichen Durchdringung und Ordnung seiner Gegenstände schwerer. Dafür gewinnen sie die Vorzüge der Handgreiflichkeit und größeren inneren Nähe. Dem Erleben und damit auch den Emotionen und Identifikationsbedürfnissen wird mehr Raum gegeben.
Es entspricht den Erwartungen, dass die politischen Nachschlagewerke den aktuellen Entwicklungen näher stehen als die historischen. Das Altern der Gesellschaft oder ökologische Probleme werden dort stärker aufgegriffen als hier. Man kann den Unterschied gut am Stichwort "Technokratie" überprüfen. Die Historiker-Beiträge fallen ausgesprochen knapp aus, konzentrieren sich auf eine allgemeine Definition und lassen eine solide historische Füllung vermissen. Im vorteilhaften Gegensatz dazu bieten die Sozialwissenschaftler ausführliche Erörterungen des Für und Wider und sparen nicht mit kritischen Beurteilungen.
Mit dem Komplex "Tradition" wiederum vermögen die Historiker mehr anzufangen. Das leisten sie zum einen, indem sie Wesensmerkmale beschreiben, indem sie den historischen Diskurs zu diesem Thema nachzeichnen und wichtige Autoren vorstellen. Die Politologen belassen es bei ziemlich abstrakten Definitionen (wenn sie nicht das Stichwort ganz aussparen) und stellen einen Zusammenhang zum Konservatismus her. Eher in statistisch-analytischen Untersuchungsverfahren bewandert, werden sie bei diesem Thema nicht recht fündig, wohingegen die hermeneutischen Methoden der Historiker hier wesentlich besser greifen.
Ähnliche Eindrücke ergeben sich beim Stichwort "Aufklärung", das sowohl ein Epochenbegriff als auch eine zeitunabhängige Bezeichnung für einen intellektuellen Habitus ist. Beide Disziplinen entfalten den Begriff - von (sehr unterschiedlich ausfallenden) Allgemeindefinitionen ausgehend ("Freiheit von aller dogmatischen Vormundschaft", "geistige Bewegung des Bürgertums") - vornehmlich an den bekanntesten Autoren von Descartes bis Rousseau und den markantesten Vorgängen der politischen Geschichte zwischen 1688 und 1789. Den Politologen liegt dabei, mehr als den Historikern, die kritische Auseinandersetzung mit den Defiziten der Aufklärung am Herzen (festgemacht an Horkheimers/Adornos Kategorie der bloß "instrumentellen" Vernunft). Die Historiker belassen es lieber beim Selbstverständnis der Zeitgenossen des 18. Jahrhunderts. Dieser Unterschied ist nicht untypisch. Die Sozialwissenschaftler sind durchweg urteils- und wertungsfreudiger, während bei den Historikern offenbar immer noch das Verstehensparadigma dominiert.
Vielleicht etwas überraschender Weise findet sich beim Artikel "Absolutismus" vieles Gemeinsame. Historiker wie Politologen rekonstruieren mit weitgehend übereinstimmenden Schwerpunkten die wesentlichen Merkmale dieser Staatsform in ihren verschiedenen Politikbereichen. Differenzen lassen sich allenfalls insoweit erkennen, als die Historiker stärker auf jeweilige zeitliche und räumliche Ausprägungen abstellen (Früh-, Hoch- und Spätabsolutismus; Frankreich, Preußen, Österreich oder Russland) und die Sozialwissenschaftler gern eine Bilanzierung der Stärken und Schwächen des Systems vornehmen.
Dass der "Terrorismus" bei den Politikwissenschaftlern weit mehr Platz einnimmt als in der historischen Zunft, hängt natürlich damit zusammen, dass er ein eher junges Phänomen (mit dramatischer Steigerung in der Gegenwart) ist, so dass die Historie mit ihren Rückblenden in die Vergangenheit schnell zu Ende kommt. Interessanter Weise beziehen beide Disziplinen auch den "Staatsterrorismus" ein, die Sozialwissenschaftler stärker als die Historiker - vielleicht, weil ihr kritisch-emanzipatorisches Potenzial hier ein willkommenes Objekt findet. Die Historiker begnügen sich im Großen und Ganzen mit der mehr oder minder ausführlichen Erwähnung von Terrororganisationen (von den Jakobinern bis zur RAF), während die Sozialwissenschaftler bemüht sind, nicht nur die verschiedenen Erscheinungsformen des Terrorismus begrifflich sauber zu klassifizieren, sondern auch auf dessen gesellschaftliche Wurzeln und politischen Motive einzugehen. Insoweit könnte man von einem größeren analytischen Ehrgeiz sprechen - auch das eine Beobachtung, die eine behutsame Generalisierung verträgt.
Bei dem Großthema "Liberalismus" verschwimmt die Fachspezifik noch mehr. Das mag damit zu erklären sein, dass der Komplex tief in die Vergangenheit zurückreicht und voll in die Gegenwart hineinragt (wobei Übereinstimmung darin besteht, dass der Liberalismus an sein Ende gekommen sei). In beiden Lexikongruppen begegnet man einer Dreiteilung: Hauptanliegen - Ideengeschichte - Parteiengeschichte. Die bekannten unterschiedlichen Nuancen fehlen natürlich nicht: hier der Hang zum Konkreten, dort die Vorliebe für eine eher abstrakte Systematik.
Das Fazit wurde schon mehrmals präludiert, es kann kurz ausfallen: Die Gemeinsamkeiten zwischen den Disziplinen sind entschieden größer als die Differenzen. Diese treten mehr in leichten Abstufungen als in massiven Gegensätzen zutage. Die historischen Lexika halten sich stärker an das Konkret-Vorstellbare, das Individuelle, das Faktografische, das Kontingente, die Dimension der Vergangenheit, die hermeneutische Herangehensweise. Die politologischen Werke favorisieren das Systematische und Abstrakte, das Generelle und Prinzipielle, das Sach- und Werturteil, die Aktualität und die Prognose, die Problemlösungs- und Handlungsperspektive, die kritisch-analytische Methode. Zwischen beiden Fächern gibt es zahlreiche gleitende Übergänge; jedes bedient sich mannigfacher Anleihen beim Nachbarn.
Im Ganzen scheint der Blick in die Lexika (die die Schätze der Wissenschaft in kleiner Münze zu verteilen suchen) den allgemeinen wissenschaftstheoretischen und fachdidaktischen Diskussionsstand zu bestätigen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Politik- und dem Geschichtsunterricht drängt sich auf, weil sowohl die Inhalte als auch die Methoden der Fächer teilweise bis zur Ununterscheidbarkeit konvergieren. Die Zusammenarbeit stößt jedoch da an ihre Grenzen, wo die facheigenen Spezifika ihr Recht verlangen. So wenig sich Historiker und Politologen gegeneinander abschotten dürfen, so schlecht wären sie beraten, wollten sie nicht an den unverwechsel- und unaustauschbaren Paradigmen ihrer Disziplinen festhalten. Jedes der Fächer verfügt über Kompetenzen und Erkenntnismöglichkeiten, die es nicht mit anderen teilt.
Anmerkungen
(1) Reinhold Hedtke, Historisch-politische Bildung - ein Exempel für das überholte Selbstverständnis der Fachdidaktiken. In: Politisches Lernen Jg. 21 (1-2), S. 112-122.
(2) Hans-Jürgen Pandel, Geschichte und politische Bildung. In: K. Bergmann u.a. (Hg.): Handbuch der Geschichtsdidaktik. 5. Aufl. Seelze 1997, S. 321f.
(3) Meyers Taschenlexikon Geschichte, Mannheim 1982. Erich Bayer/Frank Wende: Wörterbuch zur Geschichte. 5. Aufl.
Literatur
Bayer, Erich; Wende, Frank (1995): Wörterbuch zur Geschichte. 5. Aufl. Stuttgart: Kröner.
Drechsler, Hanno u.a. (1989): Gesellschaft und Staat. 7. Aufl. Baden-Baden: Signal.
Fuchs, Konrad; Raab, Heribert (1998): Wörterbuch Geschichte. 11. Aufl. München: dtv.
Hedtke, Reinhold (2003): Historisch-politische Bildung - ein Exempel für das überholte Selbstverständnis der Fachdidaktiken. In: Politisches Lernen. Jg. 21 (1-2), Seite 112-122.
Meyers Taschenlexikon Geschichte (1982). Mannheim.
Nohlen, Dieter (1991): Wörterbuch Staat und Politik. München: Piper.
Pandel, Hans-Jürgen (1997): Geschichte und politische Bildung. In: Bergmann, Klaus u.a. (Hg.): Handbuch der Geschichtsdidaktik. 5. Aufl. Seelze, Kallmeyer, Seite 321f.
Schmidt, Manfred (1995): Wörterbuch zur Politik. Stuttgart: Kröner.
Schörken, Rolf (1999): Kooperation von Geschichts- und Politikunterricht
1. Zur Genese des Problems
Das Problem der Kooperation von Geschichts und Politikunterricht ist so alt wie die politische Bildung in der Bundesrepublik. Es entstand nicht durch von außen herangetragene Forderungen oder didaktische Moden, sondern aus der Sache selbst. Man kann Politik nicht ohne Geschichte, Geschichte nicht ohne Politik verstehen. Geschichtsunterricht und Politikunterricht haben in ihren Gegenstandsfeldern viele Gemeinsamkeiten; bereits auf den ersten Blick ist sichtbar, dass z. B. die Zeitgeschichte dazu gehört. Auch die Unterrichtsziele sind teilweise gemeinsam, und die Methoden haben sich angenähert.
Man kann noch einen Schritt weiter gehen: Politikunterricht ist Demokratieunterricht. Fragt man nach der Notwendigkeit eines solchen Unterrichts, den es ja in Großbritannien, Frankreich, der Schweiz und anderen alten Demokratien so nicht gibt, kann man die Antwort nur geben, wenn man die deutsche Geschichte des 19. und vor allem des 20. Jhs. kennt.
Nichts läge näher, als auf eine unproblematische Zusammenarbeit zu schließen. Davon kann jedoch keine Rede sein. Die Kooperation hat sich als ein Feld voller Schwierigkeiten erwiesen, die von der Theorie bis in die Praxis, von Gesamtkonzeptionen bis in die einzelne Unterrichtsstunde, von der Stundentafel bis zur Lehrerausbildung reichen. Die Fachlehrerverbände haben lange Zeit eine Haltung deutlichen Misstrauens gegeneinander eingenommen, was nicht zuletzt auf die materielle Interessenlage der Fachlehrer (Zahl der Lehrerstellen) zurückzuführen war. Schwierigkeiten bestanden vom Beginn der Zusammenarbeit an. Der Geschichtsunterricht blickte auf eine jahrhundertealte Tradition zurück und war im Bewusstsein der Öffentlichkeit in seiner Notwendigkeit nie angezweifelt worden, als in den fünfziger Jahren die [/S. 630:]ersten Versuche unternommen wurden, "Sozialkunde" in die Stundenpläne einzuführen. Es lag nahe, dies in engem Verbund mit dem Geschichtsunterricht zu tun, der bisher als der "natürliche" Ort der politische Bildung galt – freilich mit zweifelhafter Vergangenheit, was den Demokratiegedanken anging.
Die sozialkundlichen Unterrichtsanteile wurden von Geschichtslehrern gegeben, solange es noch keine eigenen Studiengänge für Sozialwissenschaften gab. Erst nach und nach wurde im Unterrichtsvollzug selbst und in der sich seit den sechziger Jahren rasch herausbildenden Didaktik der Sozialkunde deutlich, dass die Sozialkunde ihren eigenen Gegenstandsbereich hatte, vereinfacht gesagt: Politik, Gesellschaft und Wirtschaft der Gegenwart, wogegen der Geschichtsunterricht die Gegenwart erst immer gegen Ende des jeweiligen historischen "Durchgangs" erreichte, was zu wenig war, um Schüler in die komplexe Welt einzuführen, in der sie lebten und für die sie politisch handlungsfähig gemacht werden sollten. Als in den sechziger und frühen siebziger Jahren die Sozialkunde bzw. "Politik" ihre Leitprinzipien formulierte, waren darunter viele, die vom Geschichtsunterricht nicht abgedeckt werden konnten wie z. B. der Konfliktgedanke, das Kontroversprinzip, die Handlungsorientierung und die Zukunftsorientierung. Auch in den ersten Sozialkundelehrbüchern wurde deutlich, dass die Unterschiede zum Geschichtsunterricht beträchtlich waren und dass die Zeiten zu Ende gingen, in denen die Geschichtslehrer den sozialkundlichen Anteil gewissermaßen nebenbei mit übernehmen konnten.
2. Typologie von Konzeptionen der Zusammenarbeit
2.1 "Unterrichtsprinzip" politische Bildung
Schon in den frühen fünfziger Jahren schenkte man der politische Bildung in der Schule Aufmerksamkeit, ohne dass ihr Gegenstandsbereich umrissen gewesen wäre und ohne dass ausgebildete Lehrer zur Verfügung gestanden hätten. PB sollte Unterrichtsprinzip für alle (!) Fächer sein, und man mühte sich, für so unterschiedliche Dinge wie den Sprach , den Kunst , den Sportunterricht gemeinsame Bezugspunkte der politischen Bildung zu finden. Meist lief das auf den Begriff der "Gemeinschaftsbildung" hinaus. Der Begriff wurde aus der Reformpädagogik der Weimarer Republik übernommen, ohne dass seine Pervertierung im "Dritten Reich" recht zur Kenntnis genommen worden wäre. Mit zunehmendem sozialwissenschaftlichen Reflexionsniveau verschwand der Gemeinschaftsbegriff, während der pädagogische Begriff des Unterrichtsprinzips an seiner Wolkigkeit krankte. Dass die politische Bildung dennoch nicht zugrunde ging, sondern überhaupt erst am Anfang ihrer Entwicklung stand, ist den vielen enthusiastischen Lehrern zu verdanken, die sich ihr widmeten.
2.2 "Addition"
Die frühen Versuche einer Kooperation waren Additionsmodelle: Dem Geschichtsunterricht wurden politisch sozialkundliche Aspekte in Form von Zusätzen beigefügt. Charakteristisch war die Verwendung von Konjunktionen wie "mit" oder "und": "Geschichte mit Sozialkunde", "Geschichte und Sozialkunde". Demselben Typ zugehörig, aber inhaltlich erweitert, war der Versuch der Saarbrückener Rahmenvereinbarung der Kultusminister von 1960, ein Sammelfach "Gemeinschaftskunde" zu kreieren, das sich aus den Einzelfächern Geschichte, Erdkunde und Sozialkunde nebst Philosophie zusammensetzte. Die Schwäche der Rahmenverein[/S. 631:]barung lag darin, dass sie auf den Gedanken setzte, die Addition von Einzelfächern würde als Summe von allein so etwas wie politische Bildung ergeben. Immerhin bewegte die Rahmenvereinbarung diejenigen Bundesländer, die sich bisher der Sozialkunde gegenüber taub gestellt hatten, dazu, dieser die Tür zu öffnen.
2.3 Das "Aspekt" Modell
Das Aspekt Modell beruht auf der Überlegung dass die meisten Themen des Politikunterrichts einen historischen Aspekt haben und umgekehrt viele Themen des Geschichtsunterrichts einen politischen, der sich u. U. für die Gegenwart aktualisieren lässt. In Unterrichtsmodellen und Lehrbüchern wurde die Abstimmung der Aspekte so gehandhabt, dass bei historischen Themen der sozialwissenschaftlich politische Aspekt an das historische Thema angehängt wurde, während man bei sozialkundlich politischen Themen den historischen Aspekt in der Regel als Einleitung vorschaltete, damit er als Genese des Problems dienen konnte. Für einen problemorientierten Geschichtsunterricht oder Politikunterricht erwies sich dieses Modell als brauchbar, vor allem dann, wenn die schematische Reihenfolge, die in der bloßen Vorschaltung oder Anhängung des jeweils anderen Aspektes lag, aufgegeben wurde zugunsten größerer Flexibilität.
2.4 "Integration"
Aus dem Ungenügen der Additions und Aspektlösung und aus dem Wunsch, weitreichendere Lösungen zu finden, wurde die Integrationsidee geboren. Die Integration wollte eine Verschmelzung der Fächer Geschichte und Sozialkunde. Weiter reichende Versuche schlossen auch das Fach Erdkunde mit ein. Die Arbeit an den Integrationsmodellen fiel in eine Zeit philosophischer Unruhe und didaktischer Neuansätze, angeregt durch neue Ideen in der Pädagogik, Philosophie und den Sozialwissenschaften. In der Pädagogik waren es vor allem amerikanische Erkenntnisse und Theorien über den Erkenntnisgewinn von Kindern und Schülern, die den Gedanken nahelegten, "Gesamt" Fächer anzulegen, aus denen sich im Prozess des Lernfortschrittes die Einzelfächer herauskristallisieren sollten. So gab es Vorschläge, ein Gesamtfach Naturwissenschaften zu bilden und eben auch ein Gesamtfach Gesellschaftslehre.
Was den Jahren, in denen an der Integrationslösung gearbeitet wurde, ihr besonderes Gepräge gab, war ein Modernitätsschub in der Öffentlichkeit und das Auftreten einer neuen Generation: die sogenannten 68er betraten die Bühne. Die öffentliche Erregung, die durch die Studentenunruhen ausgelöst wurde und die Furcht, dass diese Unruhen auch auf die Schulen übergreifen würden, erklärt, dass zum ersten Mal rein didaktische Fragen, wie es z. B. die Fächereinteilung oder Richtlinien waren, mit Aufmerksamkeit und Argwohn von der Öffentlichkeit beobachtet wurden. Die am entschiedensten vorgetragene Integrationslösung, die der Hessischen Rahmenrichtlinien Gesellschaftslehre S I (1973), kam geradezu in den Geruch des Umstürzlerischen, und die öffentliche Diskussion bekam Züge einer parteipolitischen Kontroverse, die der sachlichen Auseinandersetzung nicht dienlich war. Für die Sache wichtiger war die didaktische Kritik der Fachleute. Diese lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Es gelang den Hessischen Rahmenrichtlinien nicht, eine Balance der beteiligten Fächer Geschichte und Sozialkunde herzustellen, die Geschichte geriet in eine untergeordnete Rolle, die Kritiker K. E. Jeismann und E. Kosthorst stellten fest, Geschichte käme nur noch durch Sehschlitze in den Blick, die von sozialwissenschaftlichen Fragestellungen geöffnet würden.
[/S. 632]Damit war die Achillesferse aller Integrationslösungen berührt: Welchen Ansatz man auch wählt, man kommt an dem Problem nicht vorbei, dass bei einer Integration entweder das eine oder das andere Fach geschädigt wird, und zwar nicht nur in einigen Gegenstandsfeldern, sondern in seiner Grundstruktur. Legt man einem integrierten Gesamtfach Gesellschaftslehre eine diachronische Struktur zugrunde, ist es unausweichlich, dass die systematischen oder problemorientiert gegenwartskundlichen Momente der Sozialwissenschaften zu kurz kommen; legt man ihm eine systematische oder eine problemorientiert gegenwartskundliche Struktur zugrunde, erleidet die Diachronie – unaufgebbares Prinzip der Geschichte – schwere Einbußen. Auch wenn man dies nicht anstrebt, ist es unausweichlich, dass die eine oder die andere Seite in eine Hegemonierolle hineingerät.
Eine Variante des Integrationsmodells ist seit 1989 an den Hauptschulen Nordrhein-Westfalens in Kraft interessant, deshalb, weil man hier einen neuen Weg ging, ein Gleichgewicht von Geschichte und Politik herzustellen. Das Fach nennt sich "Geschichte/Politik" und leitet sich nicht vom hessischen Integrationsmodell ab, sondern geht auf die ältere Tradition des Hauptschulfaches "Geschichte mit Politik" zurück. Die Abwertung der Politik, die in dem Wörtchen "mit" begründet lag, wurde aufgehoben, indem die Politik in ein gleichberechtigtes Verhältnis zur Geschichte gesetzt wurde. Dabei ging man diesen Weg: Der gesamte Lehrplan ist in Form von 23 thematisch akzentuierten Unterrichtseinheiten angelegt. Aufs Ganze gesehen bieten diese Unterrichtseinheiten einen lockeren chronologischen Längsschnitt durch die Geschichte von der Urgeschichte bis zur Gegenwart, folgen also der Diachronie des Geschichtsunterrichts und nicht der achronischen Ausrichtung des Politikunterrichts. Dennoch werden die Anliegen des Politikunterrichts von Anfang an berücksichtigt, indem in jeder Unterrichtseinheit politisch soziale Fragen im Zusammenhang mit dem Thema aufgeworfen werden. Der Anteil politischer Qualifikationen an den Unterrichtseinheiten wird dabei von Jahr zu Jahr größer und überwiegt im letzten Schuljahr den historischen. Man könnte sagen, dass dieser Typ der Kooperation als Geschichtsunterricht beginnt und als Politikunterricht endet.
2.5 Zusammenarbeit durch Zuordnungen und Abgrenzungen
Die Verschmelzung von Geschichtsunterricht und Politikunterricht führte nach Ansicht vieler Lehrer dazu, dass die Schüler weder das eine noch das andere richtig lernten, und sowohl den Kultusverwaltungen wie auch den meisten Lehrern war es letzten Endes lieber, sich auf dem sicheren Boden zweier Fächer und ihrer zugehörigen Bezugswissenschaften, Studiengänge und Ausbildungswege zu bewegen als auf dem Glatteis eines Integrationsfaches. So richtete man sich weitgehend auf ein Nebeneinander von Geschichte und Politik mit vielfältigen Querverbindungen ein. Es wurden auf der Ebene der Richtlinien Absprachen getroffen, welche Stoffgebiete vor allem aus der Zeitgeschichte von dem einen oder dem anderen Fach übernommen werden sollten, damit Doppelungen vermieden würden. Die Umsetzung in die Praxis ist jedoch nicht immer leicht. So hat es z. B. wenig Sinn, die Entwicklungsländer im Erdkunde oder Politikunterricht zu behandeln, solange nicht wenigstens die Kolonisierungs und Entkolonisierungsepoche im Geschichtsunterricht besprochen worden ist. Zeitliche Absprachen sind nötig, weil die Richtlinienkommissionen verschiedener Fächer meist nebeneinanderher arbeiten.
[/S. 633:]
3. Methodische Annäherungen
Der Politikunterricht hat im Laufe seines Bestehens eine Anzahl von spezifischen Unterrichtsmethoden hervorgebracht die es im Geschichtsunterricht nicht gab. Von Anfang an spielten in der Sozialkunde solche Methoden eine Rolle, die nicht klassenzimmergebunden, sondern nach außen auf die umgebende Lebenswelt gerichtet waren. Dazu gehören Erkundungen, Befragungen, Interviews und Projekte. Auch innerhalb des Klassenzimmers haben viele Unterrichtsmethoden den Verweisungscharakter nach "draußen", etwa Rollen und Simulationsspiele. Der Geschichtsunterricht hat inzwischen ebenfalls sogenannte "handlungsbezogene" Lernziele übernommen sowie eine Reihe von Methoden entwickelt, die Ähnlichkeit mit sozialwissenschaftlichen Methoden haben. Die Anstöße dafür kamen aus Alltagsgeschichte und oral history. Neue Tendenzen in der Geschichtsdidaktik wie z. B. Erfahrungslernen sowie der bekannte historische Schülerwettbewerb der Körber Stiftung unterstützten solche Annäherungen. Der heutige Geschichtsunterricht kennt Erkundung, Projekt, Befragung, Interview, Exkursion, Museums und Ausstellungsarbeit, Archivarbeit, Rollenspiel und Entscheidungstraining, freilich nicht als Normalkost des Unterrichts, sondern als seltener angewandte Besonderheiten.
Völlig neue methodische Möglichkeiten bieten die Neuen Medien die bei dem starken Interesse und den oftmals hohen Spezialkenntnissen der Schüler rasch in den Unterricht vordringen. So können Schüler eigene Software herstellen zu lokalen Fallstudien aus der Zeitgeschichte, etwa "Das Dritte Reich in der Stadt NN". Bei solcher Arbeit, die weitgehend außerhalb des Klassenzimmers vor sich geht, fließen Methoden der Sozialwissenschaft und der Geschichte zusammen. Schüler übernehmen die Rolle von Produzenten und lernen dabei viel Methodisches, wie z. B. adressatengerechte Faktendarstellung aussehen muss, welchen Stellenwert sie hat, nach welchen Kriterien sie bewertet werden kann; sie stoßen auf Fragen, wie man etwa komplexe soziale Zustände oder Prozesse veranschaulichen kann. Die Möglichkeit, die Ergebnisse der Arbeit ins Internet einzuspeisen, verleiht der schulischen Arbeit eine Art "Ernstfallcharakter", der leistungsfördernd ist.
4. Institutionelle Schwierigkeiten der Zusammenarbeit
Die Schwierigkeiten der Zusammenarbeit beider Fächer liegen nicht allein in unterschiedlichen Unterrichtskonzeptionen begründet. Es gibt auch institutionelle Probleme. Ein erstes ist der Lehrereinsatz. Wenn an einer Schulform zwei Fächer, z. B. Geschichte und Politik, integriert sind und die eingesetzten Lehrer für beide Fächer die Fakultas haben, bedeutet dies zugleich, dass diese Lehrer Ein Fach Lehrer sind und für kein weiteres Fach mehr eingesetzt werden können.
Die Einrichtung von Integrationsfächern an der Schule wirft schwer zu lösende Probleme für die Fächerkombinationen bereits beim Hochschulstudium auf. Die Fächer an den Universitäten, in unserem Fall die Geschichte einerseits und die Sozialwissenschaften andererseits, sind gewachsene Einheiten mit fest umrissenem Selbstverständnis, das sich im wesentlichen aus den eigenen Forschungsaufgaben und Leistungen speist. Was in anderen Fächern oder gar an den Schulen vorgeht, [/S. 634:]wird meist nur am Rande zur Kenntnis genommen. Ferner muss man bedenken, dass die Sozialwissenschaften an den Hochschulen selbst wieder aus mehreren Einzelfächern bestehen und dass z. B. die Wirtschaftslehre meist zu einem anderen Fachbereich oder einer anderen Fakultät gehört. Aus diesem Grunde ist es ungewöhnlich schwierig, verschiedene Hochschulfächer zu einer funktionierenden integrativen Zusammenarbeit zu bringen, deren Notwendigkeit ja aus der Sicht der Hochschule zudem noch "von außen" kommt.
Über die Zusammenarbeit von Geschichtsunterricht und Politikunterricht wird auf drei institutionellen Ebenen entschieden: auf der Ebene des Kultusministers, der die Grundsatzentscheidung trifft, auf der Ebene der schulformspezifischen Richtlinien und schließlich auf der Ebene der Fachkonferenzen der einzelnen Schulen (Anstaltslehrplan). Einige Bundesländer sind dabei, den Schulen einen größeren Raum für autonome Entscheidungen über Schulprogramme, d. h. auch über Lehrplan und Fächerzusammenarbeit, zuzubilligen. Das könnte, wenn die Lehrer entsprechend motiviert sind, zu verbesserten Formen der Zusammenarbeit auch von Geschichte und Politik führen. Vor allem könnte innerhalb der Schule selbst eine bessere Kontrolle über das stattfinden, was im Unterricht wirklich gemacht wird. Freilich bleibt hinzuzufügen, dass die einzige nicht institutionalisierte Größe, die Individualität des Lehrers, entscheidend bleibt, und das kann im ungünstigen Fall eben auch bedeuten, dass er sich Neuerungen gegenüber verschließt.
Die ideale Form der Zusammenarbeit gibt es nicht. Am ehesten bieten sich in der gegenwärtigen Flaute der Didaktik kleine als große Lösungen an, d. h. Zusammenarbeit auf regionaler oder schulformspezifischer Basis mit möglichst genauer Abstimmung darüber, welche Aufgaben und Inhalte die beiden Fächer jeweils übernehmen sollen.
Literatur
Behrmann, Günther C.; Jeismann, Karl Ernst; Süssmuth, Hans (1985): Geschichte und Politik. Didaktische Grundlegung eines kooperativen Unterrichts. Paderborn.
Jeismann, Karl Ernst (1985): Geschichte als Horizont der Gegenwart. Paderborn.
Jeismann, Karl Ernst; Kosthorst, Erich (1973): Geschichte und Gesellschaftslehre. In: GWU 24 (1973), 262-288.
Schörken, Rolf (Hrsg.) (1978): Zur Zusammenarbeit von Geschichts und Politikunterricht. Stuttgart.
Süssmuth, Hans (1988): Kooperation von Geschichte und Politik. In: Mickel, Wolfgang W.; Zitzlaff, Dietrich (Hrsg.) Handbuch zur politischen Bildung. Bonn, Opladen, 542-549.
Sutor, Bernhard (1997): Historisches Lernen als Dimension politischer Bildung. In: Sander, Wolfgang (Hrsg.) Handbuch politische Bildung. Schwalbach/Ts., 323-337.
Redaktionelle Änderungen durch sowi-online: Ersetzen von Abkürzungen (PU, pB und GU), Anpassung des Formats der Literaturangaben, Ergänzung der Vornamen der Verfasser.
Schuster, Peter (1993): Die gescheiterte Integration der Sozialwissenschaften in der französischen Schule
1. Vorbemerkung
Wolfgang Northemann hat seine wissenschaftliche und pädagogische Arbeit bereits zu einer Zeit dem überfachlichen Unterricht gewidmet, da die Diskussion um die Integration der sozialwissenschaftlichen Fächer noch nicht einmal begonnen hatte. Nach einer heftigen und kontroversen Auseinandersetzung um die Integration sind wir nun wieder scheinbar am Ausgangspunkt angekommen. Die Fächerseparation in der Schule feiert fröhliche Urständ. Aber die Diskussion glimmt unter der Asche und wird wieder aufflackern, da die pädagogischen Argumente weiterhin zwingend sind. Die Diskussion wurde nicht nur in Deutschland geführt. Sie fand auch in anderen Ländern mit ähnlichen Argumenten und Frontstellungen statt.
Im folgenden Beitrag will ich die Bemühungen in Frankreich herausarbeiten, die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer in einem gemeinsamen Lernbereich zu integrieren. Auch in Frankreich sind diese Bemühungen ebenso wie in Deutschland zunächst gescheitert. Der erfolgreiche Kampf der Geschichtslehrer-Lobby (1) gegen die Integration ist ein politisches Lehrstück, wie pädagogische Innovationen, die nicht durch öffentliche, fachliche und politische Diskussionen abgesichert sind, am Widerstand einer durch unterschiedliche Interessen getragenen Koalition scheitern können. Der Ablauf des Lehrstücks in so kurzer Zeit und in so konzentrierter Diskussion wird wesentlich durch die zentralistische Struktur Frankreichs ermöglicht.
2. Schulsystem in Frankreich
Das Schulsystem in Frankreich umfaßt die dreijährige (freiwillige) vorschulische Erziehung (école maternelle), die fünfjährige Grundschule (école élémentaire), die vierjährige Mittelstufe (collège) und die dreijährige Oberstufe (lycée). Alle Schulen sind als Ganztagsschulen organisiert. Die Grundschule und die Mittelstufe werden als Gesamtschulen geführt. In den zwei oberen [/S. 84:] Klassen der Mittelstufe (collège) findet eine starke äußere Differenzierung statt. Das allgemeine Abitur (baccalauréat d'enseignement général) kann in unterschiedlichen Profilbildungen nach dem Besuch der Oberstufe (lycée) erworben werden. Daneben existieren in der Oberstufe technologische und berufliche Schulen (lycée technologique und lycée professionnel), in denen das technologische bzw. berufliche Abitur erworben werden kann. Neben der schulischen Berufsausbildung in der Mittel- und Oberstufe gibt es erste Ansätze einer dualen Berufsausbildung nach deutschem Vorbild. Das französische Bildungswesen wird zentralistisch von Paris aus verwaltet. Unterrichtspläne (programmes) gelten einheitlich in ganz Frankreich. Hervorzuheben sind das laizistische Prinzip und das der Methodenfreiheit:
- Das laizistische Prinzip, das 1880 unter dem Erziehungsminister Jules Ferry eingeführt wurde, verpflichtet die staatliche Schule zu weltanschaulicher Neutralität. Nur im Rahmen des nationalen und gesellschaftlichen Konsenses kann in der Schule zu Werten erzogen werden. Dieses Prinzip ist fest im Denken der Lehrer und Bildungspolitiker verankert. Erst in neuerer Zeit beginnt eine Diskussion, die die politische und wissenschaftstheoretische Fragwürdigkeit eines solch neutralen und scheinbar objektiven Anspruchs problematisiert (La Formation 1990, S. 283).
- Die Unterrichtsmethoden können von den Lehrern frei gewählt werden, soweit es ihnen die äußeren Umstände, wie z.B. hohe Klassenfrequenzen, ermöglichen. Vorherrschend sind lehrerzentrierte und stofforientierte Methoden. Reformpädagogische Ansätze (z.B. Freinet) werden trotz einer gewissen staatlichen Unterstützung seit der Haby-Reform im Jahr 1975 nur selten im Unterricht umgesetzt, in der Grundschule mehr als in anderen Schulstufen.
3. Entwicklung der Fächer Geschichte und Staatsbürgerkunde
Die Fächer Geschichte (histoire) und Staatsbürgerkunde (instruction civique) sind seit gut 100 Jahren Teil der Stundentafel der französischen Schule. Nachdem Geschichte bereits 1867 in der damaligen Volksschule (école primaire) eingeführt wurde, folgten 1882 die Einführung der "instruction civique et morale" und der Erlaß von Unterrichtsplänen für beide Fächer. Erst 1945 wurde Staatsbürgerkunde auch in der Mittelstufe als Fach eingerichtet. Beide Fächer haben im Laufe der Jahre Krisen durchlebt, die ihre Existenz in Frage stellten. Der Unterricht in Staatsbürgerkunde fand schon in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen und dann erneut nach 1950 kaum noch statt. Die Gründe sind vorrangig in der Orientierung des Faches an aktuellen politischen Bedürfnissen zu finden. Zu Beginn der III. Repu[/S. 85:]blik in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts war es Aufgabe des Fachs, die Idee der Republik in der Bevölkerung zu verankern. Nach 1945 sollte es einen Beitrag zur Versöhnung der Nation nach Résistance und Collaboration leisten. Nicht zuletzt auch unter dem Einfluß des laizistischen Prinzips war und ist der Unterricht institutionenkundlich orientiert. Er wurde und wird zudem von Lehrern unterrichtet, die für Geschichte und Geographie ausgebildet wurden. Die Krise des Geschichtsunterrichts brach in den 70er Jahren aus. Ihm wurde der Vorwurf gemacht, er sei nationalistisch, chauvinistisch, moralisierend, auf große Personen reduziert, anekdotisch, enzyklopädisch und ohne Gegenwartsbezug (vgl. Giolitto 1986, 5. 49).
Mit der Haby-Reform 1975 sollten nicht nur die Strukturen der französischen Schule, sondern auch ihre Inhalte verändert werden. Unter starkem Einfluß der amerikanischen Curriculumdiskussion wurde lernzielorientierter Unterricht favorisiert, der die tradierten Schulfächer in Frage stellte. Nachdem bereits 1969 die sozialwissenschaftlichen Fächer in der Grundschule integriert wurden, folgte 1975 die Integration auch in der Mittelstufe (collège). Geschichte und Geographie wurden als eigenständige Fächer aufgehoben und in ihrem Stoffkanon zugunsten neuer sozialwissenschaftlicher Inhalte reduziert. Nach nur zehn Jahren entschied 1985 der sozialistische (!) Erziehungsminister Jean-Pierre Chevènement die Aufhebung der von seinen konservativen (!) Vorgängern eingeführten Integration. Geschichte und Geographie wurden wieder selbständige Fächer mit getrennten Unterrichtsplänen. Die alte Staatsbürgerkunde (instruction civique) wurde als Fach "Staatsbürgerliche Erziehung" (éducation civique) wiedergeboren.
4. Integration der Sozialwissenschaften in der Grundschule
Die inhaltliche Reform der Grundschule begann bereits 1969. Die bis dahin existierenden Fächer wurden durch vier Unterrichtsgebiete (Lernbereiche) ersetzt: Französisch mit 10 Stunden, Rechnen mit 5 Stunden, Sport und "disciplines d'éveil" mit je 6 Stunden. Die "disciplines d'éveil" umfaßten Elemente der Geschichte, Geographie, Sozialwissenschaften und der künstlerischen Erziehung. Der Begriff "d'éveil" ist schwer übersetzbar. Ausgehend von den Theorien Piagets soll das Kind sein eigenes Wissen in Interaktion mit seiner Umgebung aufbauen. Es gibt keinen festen Kanon des Wissens. Die Unterrichtsgegenstände ergeben sich aus den "occasions fournies par la vie", den "durch das Leben gebotenen Gelegenheiten". Der Lehrer soll "éveilleur" (Erwecker) sein, der das Lernen der Kinder "erweckt".
Durch die Grundschul-Reform wurden die Lehrer in hohem Maße verunsichert. Auf die veränderten Methoden und Inhalte waren sie nicht vorbereitet. Viel gravierender war jedoch, daß es für den reformierten Unterricht [/S. 86:] in den "activités d'éveil" keine Unterrichtspläne und keine Handreichungen gab. Die Lehrer sollten ihr eigenes Curriculum schulnah erarbeiten. Zugleich mußten sie sich auch für die veränderten Anforderungen in Französisch und Neuer Mathematik fortbilden. Die Folge war, daß der Unterricht in den activités d'éveil weitgehend ausfiel. Das Nationalinstitut für pädagogische Forschung (Institut National de Recherche Pédagogique - INRP) begann unmittelbar 1969 mit einer eigenen Curriculumentwicklung in enger Zusammenarbeit mit Schulen. Ein Beispiel für die dezentrale Curriculumentwicklung des INRP zu den activités d'éveil in Zusammenarbeit mit einer Landschule für den Unterricht in den beiden Abschlußklassen der Grundschule zeigt die nachstehende Tabelle.
Pädagogische Wahlmöglichkeiten im Mittelkurs (CM1, CM2 = 4./5. Klasse)
Wahlmöglichkeit A: ländliche Grundschule (Beispiel der Schule in Manduel bei Nîmes)
| Lerninhalte | Gegenwart | Geographische Synthese nach Bereichen | Verankerung in der historischen Dimension | Historische Synthese nach Bereichen | Synthese früherer Gesellschaften | |||
| Fall | geograph. Erweiterung | 18. Jh. | 19. Jh. | 18. Jh. | 19. Jh. | |||
| Industrielle Produktion | Zellulose-Fabrik in Tarascon | weitere Industriebranchen | Industrie in Frankreich | Handwerker, Manufakturen, Hüttenwerke | Handwerker, Fabriken | Industrie in Frankreich | Industrie in Frankreich | 18. Jh. und 19. Jh. |
| Landwirtschaftliche Produktion | Landwirtschaftl. Betrieb in Manduel | weitere landwirtschaftl. Betriebsformen | Landwirtschaft in Frankreich | Arten landwirtschaftl. Produktionen | Arten landwirtschaftl. Produktionen | Landwirtschaft in Frankreich | Landwirtschaft in Frankreich | |
| Verteilung | ||||||||
| Dienstleistung | Bahnhof von Nîmes | Eisenbahnnetz in Frankreich | Anfänge der Eisenbahn | |||||
| Sozialer Raum | Stadt Nîmes | Nîmes und die Region | Städte in Frankreich | Nîmes | Nîmes | Städte in Frankreich | Städte in Frankreich | |
Quelle: Histoire et Géographie, 1986, S, 61
Die Ergebnisse dieser Arbeit ermöglichten es dem Staat, ab 1977 offizielle Unterrichtspläne und -empfehlungen herauszugeben. Aber die schlecht vorbereitete Reform war nicht mehr zu retten. Bereits 1980 gab es wieder neue Unterrichtspläne, die neben den fortgeltenden Lehrplänen der activités d'éveil obligatorisch die Behandlung von zehn Perioden der französischen Geschichte vorschrieben. 1985 wurden als Folge der großen Auseinander[/S. 87:]setzung um den Geschichtsunterricht (vgl. folgende Kapitel) wieder die alten Schulfächer eingerichtet und entsprechende Lehrpläne erlassen.
5. Integration der Sozialwissenschaften in der Mittelstufe
Der integrierte Bereich "Sciences humaines" (Humanwissenschaften) wurde in der Mittelstufe im Rahmen der Haby-Reform 1975 eingeführt und nach zehn Jahren 1985 wieder aufgelöst. Er umfaßte mit drei Wochenstunden die Teilbereiche Geschichte, Geographie, Wirtschaft und staatsbürgerliche Erziehung. Die Begründung für die Integration ist in den offiziellen Unterrichtsplänen von 1977/78 wie folgt dargelegt: "Schließlich sind Geschichte, Geographie, Politologie, Ökonomie und die Sozialwissenschaften nur Mittel im Dienst einer umfassenden Erziehung zu einem besseren Verständnis des kulturellen Erbes der Menschheit und der Welt, in der die Schüler leben werden. Der neue Unterricht dieser Disziplinen soll, ohne die spezifischen Beiträge ihrer verschiedenen Bestandteile zu entstellen, ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Dies ist dazu bestimmt, den Schülern Erkenntnismittel und Methoden zu vermitteln, ebenso gesicherte, bewußt begrenzte Kenntnisse, die ihnen helfen, die Welt, in der sie leben werden, besser zu verstehen und eine verantwortliche Rolle in der Gesellschaft zu übernehmen" (Histoire, géographie 1979, S. 13). In den Unterrichtsplänen war dieser umfassende Anspruch nicht zu verwirklichen. Widerstand entwickelte sich bereits vor Erlaß der Pläne. So konnte die Bezeichnung des neuen Unterrichtsbereichs nicht, wie ursprünglich beabsichtigt, "Sciences sociales" (Sozialwissenschaften) lauten, sondern eben "Sciences humaines" (Humanwissenschaften). Schwerwiegender war, daß die Pläne schließlich ein Kompromiß zwischen traditionellen und integrativen Konzepten zu Lasten letzterer wurden. In den Teilbereichen Geschichte, Geographie und staatsbürgerliche Erziehung blieben erhebliche Anteile der traditionellen Unterrichtspläne erhalten. Integrative Inhalte wie diachronische Themen, Projektthemen und Gegenwartsfragen standen unverbunden daneben. Neue sozialwissenschaftliche und ökonomische Inhalte waren nicht annähernd gleichgewichtig neben den traditionellen Inhalten vertreten.
Als Beispiel für die Unterrichtspläne in den "Sciences humaines" von 1977/78 sei der Plan für die classe de cinquième, die der 7. Klasse in Deutschland entspricht, zitiert:
Unter dem umfassenden Lernziel, "den Horizont der Schüler auf die ganze Welt hin zu erweitern", sollten behandelt werden:
- "die Erde (Land, Wasser, Kontinente, Bevölkerung, Staaten),
- Begriffe der allgemeinen Geographie und der Demographie, [/S. 88:]
- Ausweitung des lokalen Milieus auf das Département (Verwaltung, öffentliche Dienste),
- Entstehung und Entwicklung des Islam; mohammedanische Kultur,
- westliche Kultur vom XI. bis zum XIII. Jahrhundert am Beispiel Frankreichs,
- außereuropäische Kulturen: Indien, China, präkolumbisches Amerika,
- Entdeckungsreisen, europäische Expansion und ihre Folgen,
- Verkehr und Handel im Längsschnitt von den Ursprüngen bis zur Gegenwart,
- für die heutige Welt charakteristische Fragen:
- ein humangeographisches oder ökonomisches Problem ("große Ballungsräume" oder "Hunger in der Welt" oder "Erdöl"),
- ein regionales Thema, das sich auf Asien bezieht ("Reis in den Monsungebieten" oder "Japans Industrie" oder "Wirtschaft Chinas"),
- ein regionales Thema, das sich auf Amerika bezieht ("Industrie in Nordamerika" oder "Landwirtschaft in Südamerika" oder "Wirtschaft Brasiliens"),
- ein regionales Thema, das sich auf Afrika bezieht ("Landwirtschaft in Schwarzafrika" oder "Entstehung industrieller Aktivitäten" oder "Entstehung, Entwicklung, Probleme eines afrikanischen Staates"),
- Informationen zu aktuellen Themen und Themen, die Schülerinteressen entsprechen"
(Histoire, géographie 1979, S. 19-20).
6. Kampf gegen die Integration der Sozialwissenschaften
Gegen die Versuche, Geschichte in die neuen Lernbereiche activités d'éveil in der Grundschule und Sciences humaines in der Mittelstufe zu integrieren, organisierte sich sehr bald Widerstand. Der Geschichts- und Geographielehrerverband "Association des professeurs d'histoire et géographie" (APHG), eine Vereinigung von ca. zehntausend Mitgliedern aus der Mittel- und Oberstufe, artikulierte den Protest in seiner Zeitschrift "Historiens et Géographes". Die verbandsinterne Diskussion wurde schlagartig öffentlich, als sie im Herbst 1979 der Politiker Michel Debré aufgriff. Parolen wie "Unsere Kinder lernen keine Geschichte mehr" oder "Sie wissen nicht mehr, wer Jeanne d'Arc war" mobilisierten Presse und Politiker aller politischen Richtungen sowie die Universitätshistoriker aller historischen Schulen. Schließlich griff auch Staatspräsident François Mitterand 1983 in die Diskussion ein und stellte zuspitzend fest: "Un peuple qui perd sa mémoire, perd son identité" (Ein Volk, das sein Gedächtnis verliert, verliert seine Identität). Diesem Druck konnten sich die Bildungspolitiker nicht mehr ent[/S. 89:]ziehen. 1982 beauftragte der linkssozialistische Erziehungsminister Alain Savary eine Kommission unter Leitung von René Girault, eine Bestandsaufnahme des Geschichtsunterrichts und Änderungsvorschläge zu erarbeiten. In seinem Auftragsschreiben wies der Minister auf die Kritik an der ungenügenden Berücksichtigung der Chronologie hin und erklärte, daß offensichtlich "die Chronologie die Grundstruktur jedes historischen Wissens ist und daß jede thematische oder vergleichende Arbeit nur geleistet werden kann, wenn zuvor diese Grundlage gesichert ist". Die Kommission kam zu dem Ergebnis, daß die Fächer Geschichte und Geographie wiederhergestellt und zu Hauptfächern aufgewertet werden müßten (Girault 1983). Zur Umsetzung der Kommissionsempfehlung und ihrer Argumente organisierte die Regierung 1984 in Montpellier ein "Nationales Colloquium über die Geschichte und ihren Unterricht". Der Premierminister Pierre Mauroy gab in seiner Eröffnungsrede das politische Ziel vor und machte damit zugleich deutlich, wie wenig es den Verfechtern der Integration gelungen war, ihre pädagogischen Argumente in die Öffentlichkeit zu tragen: "Die Geschichte muß einen hervorragenden Platz in der Erziehung wiederfinden. Sie muß vor allen anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen behandelt werden. (...) Dieser Beitrag der Chronologie ist nicht ersetzbar. Sie muß ab der Grundschule betrieben werden. Deshalb dürfen, ohne die neuesten Ergebnisse der pädagogischen Forschung zu vernachlässigen, die traditionellen Methoden des Auswendiglernens und des Faktenerwerbs nicht vernachlässigt werden. Schließlich (...) dürfen Geschichte und Geographie nicht nur einfache 'disciplines d'éveil' sein. Sie müssen Basisdisziplinen, grundlegende Disziplinen in allen Unterrichtsordnungen sein" (Colloque 1984, 5. 12). Die Ergebnisse des Colloquiums faßte einer der führenden Vertreter der sozialwissenschaftlich orientierten Nouvelle Histoire, Jacques Le Goff, in einem leidenschaftlichen Schlußplädoyer zusammen und empfahl die Umsetzung der Empfehlungen der Girault-Kommission. Schließlich verkündete der Erziehungsminister in seinem Schlußwort die Wiederherstellung der Fächer Geschichte und Geographie sofort in der Grundschule und mittelfristig in den anderen Schulen (Colloque 1984, S. 216).
7. Die Fächer in Grundschule und Mittelstufe nach Auflösung der Integration
Die Versuche, einen integrierten sozialwissenschaftlichen Unterricht zu schaffen, sind in Frankreich zunächst gescheitert. Allerdings ist die Diskussion an den betroffenen Fächern nicht spurlos vorbeigegangen. Geschichte und Geographie orientieren sich an sozialwissenschaftlichen Konzeptionen, wie sie beispielsweise die Nouvelle Histoire sowie die Sozial- und Wirt[/S. 90:]schaftsgeographie bieten. Im Gegensatz zu Deutschland ist die Geologie nicht Teil des schulischen Geographieunterrichts, sondern Teil des naturwissenschaftlichen Unterrichts. In der "Staatsbürgerlichen Erziehung" gibt es den Kernansatz der "Menschenrechtserziehung" als Antwort auf ein gesellschaftliches Problem. Daneben steht aber unvermittelt die alte Institutionenkunde. Eine spezielle Lehrerausbildung für das Fach "Staatsbürgerliche Erziehung" wurde auch bei der Reform der Ausbildung nicht eingeführt. Das Fach wird weiterhin von Geschichts- und Geographielehren unterrichtet. Für die Grundschule und die Mittelstufe setzen die neuen Unterrichtspläne stärkere pädagogische und didaktische Akzente. Der Erwerb von Methoden- und Handlungskompetenz wird als Lernziel ausdrücklich hervorgehoben. Zur Durchführung fächerübergreifender Studien und Projekte wird ein Stundenkontingent zur Verfügung gestellt. Der folgende Überblick zeigt den Entwicklungsstand zu Beginn der 90er Jahre auf.
Grundschule
Die "activités d'éveil" (vgl. Kapitel 4) wurden in vier Lernbereiche aufgelöst: Naturwissenschaften und Technologie (sciences et technologie) mit zwei bzw. drei Wochenstunden, Geschichte und Erdkunde (histoire et géographie) mit einer bzw. zwei Wochenstunden, staatsbürgerliche Erziehung (éducation civique) mit durchgängig einer Wochenstunde sowie künstlerische Erziehung (éducation artistique) mit ebenfalls einer Wochenstunde.
Der Geschichtsunterricht geht in der 1. Klasse (cours préparatoire) von der Umgebung des Kindes aus. Ein erster Geschichtsfries erfaßt persönliche und kollektive Daten der Schüler. In der 2. und 3. Klasse (cours élémentaire 1 und 2) werden, ausgehend von der heutigen französischen Gesellschaft, kennzeichnende Epochen der französischen Geschichte mit Staaten, Ereignissen, Personen und sozialen Gruppen erarbeitet. In der 4. und 5. Klasse (cours moyen 1 und 2) folgt in chronologischer Systematik die Nationalgeschichte Frankreichs von der Vorgeschichte bis ins 20. Jahrhundert.
Der Geographieunterricht beginnt in der 1. Klasse mit der räumlichen und landschaftlichen Umgebung des Kindes. In der 2. und 3. Klasse wird die nähere Umgebung in Beziehung und Vergleich zu anderen Lebensräumen gesetzt. Frankreich in seinem Zusammenhang mit Europa und der Welt ist mit vorrangig sozialen und ökonomischen Inhalten Gegenstand des Unterrichts in der 4. und 5. Klasse. Historische und geographische Themen sind in drei bis vier Studieneinheiten (sujets d'études) pro Schuljahr miteinander verknüpft zu behandeln. Hierfür stehen maximal 24 Wochenstunden (ein Drittel der gesamten Unterrichtsstunden) zur Verfügung (Ecole élémentaire 1990, S. 25 ff.).
Die staatsbürgerliche Erziehung soll sich auf wenige wichtige Bereiche beschränken: verantwortliches Sozialverhalten, politische und administrati[/S. 91:]ve Institutionen sowie die Rolle Frankreichs in der Welt. Als affektive Lernziele werden Ehrlichkeit, Mut, Ablehnung des Rassismus und die Liebe zur Republik genannt. In der 1. Klasse lernen die Schüler grundlegende Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens und die staatlichen Symbole der Republik. Im Unterricht der 2. und 3. Klasse sollen die Regeln des Gemeinschaftslebens klarer erfaßt und begründet werden. Themen sind die Begriffe Person, Eigentum, Vaterland, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Wahlen, Staatsgebiet, Staatspräsident, Minister, Abgeordnete, Gemeinde, Bürgermeister sowie die Schule. Parallel zum Geschichts- und Geographieunterricht steht in der 4. und 5. Klasse Frankreich mit seinen Institutionen und die sie begründenden Ideen im Mittelpunkt: Erklärung der Menschenrechte von 1789 und 1948, bürgerliche Freiheiten und Rechte, Verfassung, Gesetzgebung, Verwaltung, öffentliche Dienste, Armee, Frieden, Europa, Nation und internationale Beziehungen (Ecole élémentaire 1990, 5. 29 ff.).
Mittelstufe (college)
In der Mittelstufe gibt es im sozialwissenschaftlichen Bereich drei Fächer:
1. Geschichte, 2. Geographie und Einführung in die Wirtschaft (initiation économique), 3. staatsbürgerliche Erziehung und Menschenrechtserziehung (éducation aux droits de l'homme). Für Geschichte, Geographie und Wirtschaft stehen zusammen zweieinhalb Wochenstunden, für staatsbürgerliche Erziehung eine Wochenstunde zur Verfügung.
Der Geschichtsunterricht folgt der chronologischen Systematik. In der 6. und 7. Klasse (sixième und cinquième) soll der Begriff "civilisation" den Unterricht und seine Beziehungen zu den Nachbarfächern strukturieren. Die Themen reichen von der Vorgeschichte bis zur Reformation. In der 8. Klasse (quatrième) sind das 17., 18. und 19. Jahrhundert (bis 1914) zu behandeln. Die Abschlußklasse der Mittelstufe, die 9. Klasse (troisième), ist dem 20. Jahrhundert, von 1914 bis zur Gegenwart, gewidmet. Die Unterrichtspläne warnen für die 9. Klasse vor einer Überbetonung der Fakten. Es sollten nur wenige Schlüsseldaten gelernt werden (Histoire, Géographie 1992, 5. 15 ff.).
Im Geographieunterricht der 6. Klasse (sixième) stehen Klimazone und Verteilung der Menschen auf der Erdoberfläche im Mittelpunkt. In der 7. Klasse (cinquième) sind die Begriffe Unterentwicklung und Entwicklung mit Beispielen aus Afrika, Asien und Lateinamerika zu vermitteln. Europa in seiner "Einheit und Verschiedenheit" sowie seinem Einfluß in der Welt ist das Leitthema der 8. Klasse (quatrième). Neben einzelnen Staaten ist hier auch die Europäische Gemeinschaft zu behandeln. Der Geographieunterricht am collège schließt in der 9. Klasse (troisième) mit Frankreich, den USA und der UdSSR ab. Es sind die Begriffe Mittelmächte und Großmächte zu erarbeiten. [/S. 92:]
Der Unterrichtsbereich "Einführung in die Wirtschaft" (Initiation économique) ist dem Geographieunterricht zugeordnet. Er beginnt in der 6. Klasse mit den Wirtschaftssubjekten und dem Wirtschaftskreislauf in der Gemeinde, setzt sich in der 7. Klasse mit den Themen Geld und Welthandel fort, widmet sich in der 8. Klasse inneren Problemen eines Unternehmens sowie der Arbeitswelt und schließt in der 9. Klasse mit den Aspekten und Problemen der regionalen Wirtschaft ab (Histoire, Géographie 1992, S. 63 ff.).
Für die Staatsbürgerliche Erziehung (éducation civique) in der Mittelstufe (collège) werden als Lernziele angegeben, daß sie "bei dem Schüler den Sinn für das Allgemeininteresse, die Achtung des Gesetzes, die Liebe zur Republik entwickeln" soll. In diesem Zusammenhang soll der Schüler über Rechte und Pflichten des Staatsbürgers aufgeklärt werden. In der 6. Klasse (sixième) sind die Themen Schule, Erziehung, Schulverwaltung, Leben in der Schule, soziale Beziehungen und das demokratische Leben in der Gemeinde zu behandeln. Die beiden umfassenden Themenkreise in der 7. Klasse (cinquième) sind das "Département und die Region" sowie die "Unterschiede und Achtung der Menschen". Der Unterricht in der 8. Klasse (quatrième) setzt die am Ende der 7. Klasse begonnene Menschenrechtserziehung mit den Bereichen "Eroberung der bürgerlichen Freiheiten" und "Ausübung der bürgerlichen Freiheiten im heutigen Frankreich" fort. Parallel zum Geographieunterricht endet der Unterricht der 8. Klasse mit den Institutionen und dem Werden der Europäischen Gemeinschaft. In der 9. Klasse (troisième) sind das politische Leben Frankreichs und seiner Institutionen, die Institutionen der USA und der UdSSR sowie die internationalen Beziehungen, die Verletzung der Menschenrechte, der Terrorismus, die Unterschiedlichkeit der Kulturen und die internationale Solidarität zu erarbeiten. Der Unterricht soll zusammenfassend mit den "Werten der Demokratie" enden. Ein auch für Deutschland angesichts seiner jüngsten Entwicklung interessanter Ansatz zu einem integrierten Unterricht ist die in die staatsbürgerliche Erziehung eingebundene "Menschenrechtserziehung, auf die im folgenden Kapitel besonders eingegangen wird (Éducation civique 1990).
Der Zustand der "staatsbürgerlichen Erziehung" in der Mittelstufe wird in einem Rundschreiben des Erziehungs-Ministeriums vom 14.11.1991 an die Schulaufsicht und die Schulen erkennbar, in dem das Ministerium anmahnt, daß die Prüfungsthemen am Ende der Schulzeit "nicht so ausschließlich über institutionelle Aspekte handeln sollten, wie dies im Prüfungszeitraum 1990 der Fall war" (Histoire, Géographie 1992, 5. 120).
Auf eine nähere Darstellung des Unterrichts in den drei Klassen der Oberstufe (lycée) sei hier verzichtet. Geschichte und Geographie werden entsprechend der klassischen Fachsystematik unterrichtet. Die Staatsbürger[/S. 93:]kunde (instruction civique) wird zwar in der Überschrift der Unterrichtspläne aufgeführt, sie findet aber nur implizit in der Behandlung historischer und geographischer Themen statt (Histoire, Géographie 1991, S. 13).
8. Menschenrechtserziehung
Als Reaktion auf zunehmenden Rassismus in der französischen Gesellschaft wurde im zeitlichen Zusammenhang mit den 200-Jahrfeiern der Französischen Revolution der Unterrichtsbereich "Menschenrechtserziehung" (Éducation aux droits de l'homme) für die Mittelstufe entwickelt. Dieser Bereich bildet den Kern des Fachs "Staatsbürgerliche Erziehung" in den vier Jahrgangsstufen des collège. In den neueren Veröffentlichungen der Unterrichtspläne tauchen beide Bezeichnungen für das Fach gleichberechtigt auf. Damit hat die staatsbürgerliche Erziehung einen zentralen Auftrag erhalten, der in der französischen Tradition dieses Fachs steht, einen pädagogischen Beitrag zur Lösung dominierender gesellschaftlicher Probleme zu leisten. In der III. Republik hatte das Fach seit seiner Einführung 1882 die Aufgabe, zur Idee der Republik zu erziehen. Nach 1945 stellte sich die Aufgabe, die Nation nach der Auseinandersetzung zwischen Kollaboration mit dem deutschen Feind und der Résistancebewegung, zwischen Pétain und de Gaulle, zu versöhnen.
Das Konzept der Menschenrechtserziehung wird in den Unterrichtsplänen wie folgt beschrieben:
"Zu den bürgerlichen und politischen Rechten, den sogenannten Rechten der ersten Generation in der Tradition liberalen Denkens, sind die durch das sozialistische Denken beeinflußten ökonomischen und sozialen Rechte dazugekommen, die man als die zweite Generation bezeichnet. In jüngster Zeit sind die Ideen der Rechte einer sogenannten dritten Generation entwickelt worden: Recht auf Frieden, Recht auf gesunde Umwelt ...
Die drei folgenden Prinzipien müssen im Denken gegenwärtig sein:
Die Menschenrechte gelten weltweit, auch wenn sie in einer bestimmten Kultur und Zivilisation entstanden sind;
die universellen Menschenrechte fordern dazu auf, Unterschiede zu respektieren;
die Menschenrechte sind konstituierend für das soziale und politische Leben einer demokratischen Gesellschaft" (Éducation civique 1990, S. 49).
Die Zuordnung der Lernziele und Lerngegenstände ist in den Unterrichtsplänen festgelegt, wie die folgende Tabelle zeigt. [/S. 94:]
Staatsbürgerliche Erziehung und Menschenrechtserziehung
| Ziele/Klasse | 6e (D: 6. Kl.) | 5e (D: 7. KI.) | 4e (D: 8. Kl.) | 3e (D: 9. Kl.) |
| Wecken von Toleranz, die auf der Anerkennung universaler Rechte beruht | Respekt vor sich selbst und den anderen | Unterschiede der Herkunft, des Glaubens, der Meinungen, Lebensweisen; Toleranz, Respekt gegenüber anderen Kulturen | Rechte und Pflichten von Ausländern | Angriffe auf die Person eine Welt: unterschiedliche Kulturen |
| Würde des Individuums respektieren und solidarisch handeln lernen | Recht auf Bildung und Erziehung | Ungleichheit der Entwicklung Nord-Süd-Dialog | ökonomische und soziale Rechte (Arbeit, Gesundheit, Soziales) | Internationale Solidarität |
| Prinzipien der Demokratie kennen Grundfreiheiten kennen Politische Institutionen kennen auf das demokratische Leben vorbereiten |
Staatsbürger werden Gemeinde (Wahlen) | Institutionen der Region und des Départements | Freiheiten: Erringung und
Ausübung gegen Willkür Rechte und Pflichten des Bürgers EG Europa-Rat | Verfassung von 1958 Freiheiten Gesetz, Justiz V. Republik Gesetz, Justiz Internationale Organisationen |
| Zur Verantwortung ermutigen | Schulleben, Umwelt | Kulturerbe der Region |
Quelle: Éducation civique, 1990, S. 50 (gekürzte Übersetzung)
Besonders hervorgehoben sind des weiteren Beiträge der Fächer Geschichte, Geographie, Biologie und Französisch. Im Geschichtsunterricht sind an unterschiedlichen Themen vom Altertum bis zur Neuzeit folgende Begriffe zu erarbeiten: Sklaventum, Rassismus, Widerstand, religiöse Freiheit, Intoleranz, Staatsbürger, Staat, Gleichheit, Recht, juristische Formulierungen der Rechte, Erweiterung und Anreicherung der Menschenrechte, Menschenrechte und Kolonialisierung, Verletzlichkeit der Menschenrechte. Im Fach Geographie sind die Begriffe Solidarität, Entwicklungspolitik, Dialog zwischen den Völkern, ökonomische Rechte, soziale Rechte, Verschiedenheit der Völker und Kulturen sowie die weltweite Dimension des Problems der Menschenrechte zu behandeln. Das Fach Biologie leistet seinen Beitrag durch folgende Ziele und Themen: Achtung der menschlichen Person, individuelle und kollektive Verantwortung (Toleranz und Ablehnung [/S. 95:] des Rassismus), Kritik pseudowissenschaftlicher Anwendungen, zum Beispiel des Begriffs Rasse. Für den Französischunterricht werden Literaturhinweise zu den Themen Mensch und Natur (Dritte Welt, Konflikt, Harmonie), Menschen und Gruppen, Aufstand, Revolte sowie dem heutigen Kampf für die Freiheit gegeben. Als wesentliche Texte sind in den beteiligten Fächern die Erklärungen der Menschenrechte von 1789 und 1948 sowie die europäische Menschenrechts-Konvention von 1950 zu behandeln.
Die Unterrichtspläne zur Menschenrechtserziehung bleiben bei der Zuordnung von Zielen und Themen zu den einzelnen Fächern stehen. Ein integrierter Unterricht wird nicht vorgeschrieben. In jedem Fach können die Themen separat behandelt werden. Eine Verbindung ergibt sich bestenfalls durch die den einzelnen Jahrgängen vorgegebene parallele Behandlung. Immerhin gibt es die Empfehlung, die Menschenrechtserziehung mit den "Querthemen" (thèmes transversaux) Sicherheit, Umweltschutz, Information, Entwicklung, Verbrauch, Gesundheit und Leben in einem PAE-Projekt (projet d'action éducative) zu verbinden (Éducation civique 1990, S. 45 ff.).
9. Konklusion
Die Versuche, einen integrierten sozialwissenschaftlichen Unterrichtsbereich zu schaffen und die traditionellen Fächer Geschichte, Erdkunde und Sozialkunde aufzulösen, sind nicht auf Deutschland beschränkt. Sie fanden auch in anderen Staaten statt.
Der Prozeß in Frankreich verlief ähnlich wie in Deutschland. Aus der Curriculumdiskussion kamen die Anstöße, die die fachimmanente Systematik der Fächer durch eine an Lernzielen orientierte Struktur ersetzen wollten.
Der erfolgreiche Widerstand gegen die Integration der Sozialwissenschaften wurde aktiv von universitären und gymnasialen Vertretern der Fächer Geschichte und Erdkunde getragen. Unterstützung fand dieser Widerstand durch Politiker, die einerseits ihre eigene Erziehung als Maßstab der Beurteilung nahmen, andererseits keinen Zugang zu den pädagogischen Begründungen eines integrierten Unterrichts fanden.
Die Diskussion scheint mit der Wiederherstellung der tradierten Fächer nicht am Ende zu sein. In Frankreich wird insbesondere die Curriculumentwicklung in der Grundschule fortwirken. Ebenso werden die Einführung der Menschenrechtserziehung in der Mittelstufe und erste Ansätze in den Unterrichtsplänen zu einem Projektunterricht die Entwicklung offenhalten.
In diese Richtung weist auch die Stellungnahme, die das renommierte Collège de France unter Federführung des Soziologen Pierre Bourdieu 1984 zum Zeitpunkt des Abbruchs der Integration der Sozialwissenschaften zur [/S. 96:] Entwicklung des Unterrichts unterbreitet hatte. In These 6 heißt es: "Um die Auswirkungen einer wachsenden Spezialisierung auszugleichen, die die Mehrzahl der Individuen parzelliertem Wissen aussetzt, (...) muß gegen die Inselbildung des Wissens (...) gekämpft werden" (Propositions 1985, S. 33).
(1) Die männliche Sprachform im Text schließt selbstverständlich die weibliche Form ein.
Literatur
Bensoussan, Georges/Laugère, Antoine (1983): L'Instruction Civique: ses buts, ses agents, ses discours. In: Raison Présente, Heft 74/1983, S. 7-23
Chevènement, Jean Pierre (1985): Etre citoyen. In: Ders.: Apprendre pour entreprendre. Paris 1985, S. 226-234
Collèges (1985): Programmes et instructions. Herausgegeben vom Ministère de l'Éducation nationale. Paris 1985
Colloque national sur l'histoire et son enseignement (1984): Herausgegeben vom Ministère de l'Éducation nationale. Paris 1984
Ecole Elémentaire (1985): Programmes et instructions. Herausgegeben vom Ministère de l'Éducation nationale. Paris 1985
Ecole Elémentaire (1990): Programmes et instructions. Herausgegeben vom Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Paris 1990
Éducation civique (1990): Éducation aux droits de l'homme. Classes des collèges (6e, 5e, 4e, 3e). Herausgegeben vom Ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Paris 1990
La formation aux didactiques (1990): Cinquième Rencontre Nationale sur les Didactiques de l'Histoire, de la Géographie, des Sciences sociales, Mars 1990, Actes du colloque. Paris 1990
Giolitto, Pierre (1986): L'enseignement de l'histoire aujourd'hui. Paris 1986
Girault, René (1983): L'histoire et la géographie en question. Rapport au ministre de l'Éducation nationale. Paris 1983
Histoire et Géographie à l'école élémentaire (1986): Rencontres pédagogiques No. 13. Herausgegeben vom Institut national de recherche pédagogique. Paris 1986
Histoire, géographie, économie, éducation civique (1979): Classes des collèges (6e, 5e, 4e, 3e). Herausgegeben vom Ministère de l'Éducation. Paris 1979
Histoire, Géographie, Initiation économique (1992): Classes des collèges (6e, 5e, 4e, 3e). Herausgegeben vom Ministère de l'Éducation nationale. Paris 1992
Histoire, Géographie, Instruction civique (1991): Classes de seconde, première et terminale. Herausgegeben vom Ministère de l'Éducation nationale. Paris 1991
Propositions pour l'enseignement de l'avenir (1985): Elaborées à la demande de Monsieur le Président de la République par les professeurs du Collège de France. Paris 1985
Schuster, Peter (1989): Geschichtsunterricht und politische Bildung in Frankreich. Versuche der Integration. In: Northemann, Wolfgang/Schuster, Peter (Hrsg.): Mentorentag Geschichte und Sozialkunde. Berlin 1989, S. 111-126
Wittenbrock, Rolf (1983): Der Kampf für die Erhaltung und Erneuerung des Geschichtsunterrichts in Frankreich im Spiegel der Zeitschrift "Historiens et Géographes". In: Internationale Schulbuchforschung, Heft 2/1983, S. 133-144
Sutor, Bernhard (2004): Historisch-politische Bildung – Ein Interdependenzverhältnis
Den folgenden Überlegungen liegt die These zugrunde, dass historische und politische Bildung in einem Verhältnis der Interdependenz stehen, sich also gegenseitig bedingen und stützen. Das soll hier unter drei Aspekten begründet und auf Folgerungen hin befragt werden. Erstens soll an Beispielen die Geschichtlichkeit der Gegenstände des Politikunterrichts gezeigt werden. Zweitens sollen einige Überlegungen formuliert werden zum Ineinander von geschichtlichem und politischem Bewusstsein. Drittens soll das spezifische Verhältnis von Zeitgeschichte und politischer Bildung angesprochen werden. Ich beschränke mich in allen drei Schritten auf eine knappe Skizze, da ich mich an anderen Stellen schon ausführlicher zu der Thematik geäußert habe (1). Wenn ich mich hier wiederhole, so geht das auf den ausdrücklichen Wunsch des Herausgebers dieses Readers zurück.
1. Zur Geschichtlichkeit der Gegenstände des Politikunterrichts.
Die Geschichtlichkeit von Themen des Politikunterrichts sei modellhaft an vier didaktischen Zugriffsweisen verdeutlicht.
Erstens ist wohl unmittelbar einsichtig, dass sich bei der Analyse aktueller politischer Konflikte oder Probleme, wenn sie über die reine Tagesaktualität hinausgelangen will, die geschichtliche Dimension als Zugang zum Verständnis geradezu aufdrängt. Gewiss fragen wir z.B. beim Nahost-Konflikt nach den ihn bedingenden Faktoren sozio-ökonomischer, macht- und sicherheitspolitischer, militärstrategischer und ideologischer Art. Aber seine Tiefenstruktur als ein Existenzkampf politischer Großgruppen wird nur verstehbar aus deren geschichtlich gewachsenem Selbstverständnis, das gleichsam alle andern Faktoren imprägniert. Im Grunde meldet sich darin die ganze jüdisch-israelische und die islamisch-arabische Geschichte als Thema. Diese kann der Politikunterricht nicht aufarbeiten; er ist dafür auf den Geschichtsunterricht angewiesen. Aber unabhängig von diesem wird er doch den gegenwärtigen Konflikt mindestens bis in die Zeit der Entstehung des Staates Israel zurückverfolgen müssen, um ihn in seinen heutigen Dimensionen verstehbar zu machen.
Zweitens wird die Beachtung der geschichtlichen Dimension politischer Themen unabdingbar, wenn es um die Analyse politischer Strukturen oder Mentalitäten geht; denn sie sind immer von längerer Dauer, aus reiner Gegenwart nicht zu verstehen. Die unterschiedlichen Ausformungen parlamentarischer Demokratie, Parteiensysteme, Sozialmilieus und ihr Wählerverhalten sind Fragen, die über die Zeitgeschichte im engeren Sinn zurückreichen in Entwicklungen gesellschaftlicher und politischer Konfliktlinien seit dem 19. Jahrhundert. Dabei treffen wir auf die Verbindung objektiver, sozialstruktureller Faktoren mit der Selbstdeutung und dem Selbstverständnis sozialer Gruppen, mit biographisch und sozial geprägten Einstellungen, die wir Mentalitäten nennen. Auch wenn sie sich heute vielleicht rascher als bisher verändern, teils gar auflösen, wirken sie doch auch in neuen Formierungen weiter. Sie zu verstehen und zu reflektieren, gehört zentral zum Verständnis heutiger Demokratie der pluralistischen Gesellschaft.
Drittens kommt Geschichte als Alternative in den Blick, wenn wir die Besonderheit unserer Zeit, ihrer Strukturen, Institutionen, Probleme und Wertmaßstäbe erfassen wollen. Die oberflächliche Neigung, die ganze Menschheit in ihrer Geschichte über den Leisten unserer heutigen Sichtweisen und Maßstäbe schlagen zu wollen, scheitert schon an der "Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen" in der gegenwärtigen, sich globalisierenden Welt. Das gilt für unsere industriell-technisch bedingte Lebensweise ebenso wie für die Prinzipien und Institutionen unserer Demokratie und für unsere Vorstellung von Menschenrechten. Gerade die heute diskutierte Universalität der Menschenrechte bzw. ihre kulturell unterschiedliche Interpretation enthält die Frage nach geschichtlichen Alternativen. Historischer Blick relativiert unsere Ordnungsformen und Wertorientierungen. Das muss keineswegs zu reinem Wertrelativismus führen, kann vielmehr mit besserem Verständnis für andere Kulturen auch eine höhere Wertschätzung der eigenen bewirken.
Viertens schließlich kann damit Geschichte als universaler Horizont unseres Verständnisses von Gegenwart und unseres politischen Denkens und Wollens ins Blickfeld kommen. Die Neuartigkeit oder jedenfalls die spezifische Eigenart heutiger weltweiter Probleme wird in diesem Horizont erst angemessen erfassbar. Das gilt für die Frage der Ökologie im "Raumschiff Erde" ebenso wie für die Sicherung des Friedens in einer Welt von 190 Staaten ganz unterschiedlichen Gewichts und Interesses angesichts der Existenz von Massenvernichtungswaffen und für die Frage nach der Sicherung des Minimums an Bedürfnisbefriedigung für 6 Milliarden Menschen, zwischen denen Wohlstand und Armut provozierend ungleich verteilt sind. Die Grundfrage nach einer künftigen politischen Weltordnung ist unabweisbar gestellt. Nur wer geschichtlich bewusstlos lebt, kann die Neuartigkeit der heutigen Herausforderungen übersehen. Politik wird zunehmend international, wird zu Weltpolitik. Deshalb erfordert sie auch zunehmend weltgeschichtliches Denken. Politikunterricht kann die entsprechenden Fragen an die Geschichte stellen, zu ihrer Beantwortung ist er auf Geschichtsunterricht angewiesen.
2. Geschichtlich-politisches Bewusstsein
Dass politische Bildung nicht ohne Geschichte auskommt, wird besonders evident an dem Ineinander von geschichtlichem und politischem Bewusstsein. So wie Politikunterricht seine Gegenstände nicht hinlänglich verständlich machen kann, wenn er ihre Geschichtlichkeit nicht beachtet, so missversteht Geschichtsunterricht seine Aufgabe, wenn er der Illusion erliegt, Vergangenheit könne objektiv abgebildet und vermittelt werden. Geschichtswissenschaft und Geschichtsunterricht, Zeitdeutungen und politisches Wollen sind immer ineinander verwoben, wenngleich Historie insoweit der Objektivität verpflichtet ist, als ihre Aussagen methodisch kontrolliert und nachvollziehbar sein sollen. Ihr Frageinteresse ist immer das der jeweiligen Gegenwart. Wir haben es also mit einem dialektischen Verhältnis zu tun.
Einerseits stellt Geschichte ein Reservoir bisheriger politischer Erfahrungen dar und wird als solches bewusst oder unbewusst immer auch politisch genutzt. Gesellschaftliche Strukturen, politische Institutionen, Deutungs- und Handlungsmuster sind geschichtlich bedingt. Gerade deshalb darf politische Bildung Geschichte nicht zum "Steinbruch" degradieren und politisch instrumentalisieren. Sie muss vielmehr durch Reflexion der Geschichtlichkeit politischer Phänomene Distanz ermöglichen. Das Verstehenspotential der Geschichte wird für politische Bildung erst fruchtbar, wenn Geschichte auch in ihrem Kontrastcharakter zur Gegenwart wahrgenommen und Historie als wissenschaftlich geleitete Aufklärung unserer Herkunft ernst genommen wird.
Andererseits war und ist Geschichtsunterricht immer auch ein politisch relevantes Fach. Seit dem 19. Jahrhundert war er in unterschiedlichen, phasenweise auch in extremen Formen, das Leitfach staatsbürgerlicher Erziehung. Gegen seine politische Vereinnahmung braucht er wissenschaftlich und didaktisch begründete Distanz. Aber er entkommt damit nicht dem Zirkel gegenseitiger Abhängigkeit von Gegenwarts- und Geschichtsbewusstsein. Seine Fragen stammen aus gegenwärtigem Erkenntnisinteresse. Wir wollen uns und unsere heutige Welt aus der Geschichte verstehen.
Deshalb hat die Geschichtsdidaktik seit längerem das Phänomen des Geschichtsbewusstseins in das Zentrum ihrer Überlegungen gerückt und versteht sich als Wissenschaft von Inhalt und Struktur, von Faktoren und Beeinflussungsmöglichkeiten diese Bewusstseins (2). Dieser Ansatz ermöglicht am ehesten auch eine konsensfähige Verbindung zur Didaktik politischer Bildung. Er vermeidet nämlich die Einseitigkeiten traditionalistischer wie progressistischer Konzepte.
Der didaktische Ansatz beim Geschichtsbewusstsein setzt voraus, dass Geschichte mehr und etwas anderes ist als Vergangenheit. Sie ist die in unserer Erinnerung und in unseren Vorstellungen wirksame Gegenwart von Vergangenheit. Unsere Bilder von Vergangenheit beeinflussen unser Verständnis von Gegenwart und unser Zukunftswollen. Deshalb müssen wir aber unter dem Aspekt der Aufgaben politischer Bildung den Gegenstand der Geschichtsdidaktik, das Geschichtsbewusstsein, erweitern und von geschichtlich-politischem Bewusstsein sprechen.
Unsere politischen Vorstellungen von gegenwärtigen Konflikten und Problemen, unsere Intentionen und Wünsche zu ihrer Lösung sind mit Geschichtsbildern und -deutungen eng verflochten. Geschichtsdeutungen beeinflussen politisches Meinen und Wollen, dieses bedient sich seinerseits zugleich der Geschichte als eines Arsenals zu politischer Argumentation und Legitimation. Das gilt individuell, vor allem aber sozial. Großgruppen und politische Verbände leben von und mit Geschichtsbildern. Sie suchen Identität in Aneignung von Vergangenheit, die sie deuten und zugleich als gegenwärtig wirksam erfahren. In allen politischen Auseinandersetzungen ist Geschichte mit im Spiel.
Geschichts- und Politikunterricht haben das nicht zu bestätigen und zu bestärken, sondern zum Gegenstand methodisch geleiteter Bearbeitung mit dem Instrumentarium ihrer je eigenen Bezugswissenschaften zu machen. Daraus ergibt sich für das Verhältnis historischer und politischer Bildung:
- Politische Bildung braucht einen eigenständigen Politikunterricht. Dieser zielt auf die Entwicklung politischer Urteilsfähigkeit durch die Analyse politischer Themen (Gegenwartsprobleme/Konflikte) mit Hilfe politikdidaktisch begründeter Frageweisen/Kategorien und Modelle. Geschichtlichkeit ist eine seiner Grundkategorien.
- Politische Bildung braucht auch einen eigenständigen Geschichtsunterricht. Dieser zielt auf die Entwicklung historischen Verstehens und auf die Aufklärung unseres geschichtlich-politischen Bewusstseins durch historische Ortsbestimmung der Gegenwart. Diese Aufgabe kann nicht im Politikunterricht gleichsam nebenher mit Hilfe seiner Kategorie der Geschichtlichkeit geleistet werden. Dieser "Sehschlitz" ist zu eng.
Man kann dieses Plädoyer für die zwei Pfeiler politischer Bildung auch so begründen: Geschichtlichkeit ist nicht eine Kategorie neben anderen zum Verständnis des Politischen. Auch diese sind vielmehr von ihr durchdrungen. Die heute wirksamen Interessen und ihre Interpretationen, die Ideologien und die sozialen Strukturen, das Recht und die Institutionen, die Machtverhältnisse und schließlich unsere normativen Vorstellungen von Legitimität, von Menschenrechten, Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden sind allesamt geschichtlich geworden und bedürfen deshalb um politischer Bildung willen historischen Verstehens. Dieses kann der Politikunterricht mit seinen Mitteln nicht hinlänglich vermitteln; ganz abgesehen davon, dass es auch noch ganz andere legitime Aspekte und Interessen gibt, sich mit Geschichte zu befassen, literarische und künstlerische, philosophische und religiöse. Geschichtsunterricht ist für politische Bildung unentbehrlich, aber es ist Ausdruck einer freiheitlichen Gesellschaft, ihn nicht nur auf diese zu beziehen.
3. Zeitgeschichte als Teil des Politikunterrichts
Zeitgeschichte steht an der Nahtstelle zwischen Geschichts- und Politikunterricht. Sie gehört deshalb in je spezifischer Weise zu beiden Fächern. Es genügt nicht, wenn sie nur als letzte Epoche der Geschichte zur Sprache kommt. Sie bildet den Kontext der Gegenstände und Themen des Politikunterrichts, der gegenwärtigen, der ungelösten, der permanent aktuellen politischen Fragen unserer Zeit. Sie ist deshalb, in anderer Weise als die Geschichte im allgemeinen, nämlich unmittelbar Medium und Aufgabenfeld politischer Bildung. Gewiss hat es Politik mit den Konflikten und Ordnungsproblemen der Gegenwart zu tun. Aber ihre Gegenwart ist nicht der heutige Tag, sondern unsere Zeit. Deshalb gewinnt im Bezug auf Zeitgeschichte das oben festgestellte Ineinander von geschichtlichem und politischem Bewusstsein eine besondere Intensität.
Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Sonderdisziplin Zeitgeschichte neu begründet wurde, definierte sie Hans Rothfels als "die Epoche der Mitlebenden und ihre wissenschaftliche Behandlung" (3). Forschungspraktisch setzte er sie damals gleich mit der Zeit von 1917 bis 1945. Für die damals zugleich einsetzenden Bemühungen um politische Bildung war das eine Umschreibung von zentraler Bedeutung. Der Wissenschaft wie der politischen Bildung war damit die Aufgabe zugewiesen, die man als Aufarbeitung der Vergangenheit bezeichnete. Die entsprechenden Fragen konzentrierten sich zunächst auf das Scheitern der Weimarer Demokratie, auf Ermöglichungsgründe und Grundzüge des NS-Totalitarismus. Das kann und braucht hier nicht dargestellt zu werden. Fragestellungen und Schwerpunkte haben sich verschoben, aber die Aufgabe ist politischer Bildung geblieben. Heute hat Zeitgeschichte das gesamte 20. Jahrhundert zum Gegenstand, und zwar erweitert um die europäische und die globale Perspektive. Die beiden Weltkriege, der Ost-West-Konflikt und sein Ende, Entkolonialisierung und Entwicklungsproblematik, um nur die wichtigsten Stichworte zu nennen, beschreiben die Genese der heute zentralen politischen Probleme. Historische Einsichten in diese Zusammenhänge sind integraler Teil politischer Bildung.
Das Verständnis von Zeitgeschichte als der "Epoche der Mitlebenden" hat eine objektive und eine subjektive Seite. Die permanent aktuellen Probleme unserer Zeit sind mit dem "Erleben" der jetzt Lebenden aufs engste verflochten. Probleme sind ja nicht schlechthin objektiv gegeben; sie sind vielmehr Ergebnis von Deutungen und Wertungen des Faktischen und seiner Genese, Ausdruck der Diskrepanz zwischen dem was ist, und unseren Wünschen und Wertvorstellungen, ein Feld deshalb zugleich auch voller Deutungs- und Wertkonflikte.
Zeitgeschichte als Wissenschaft muss sich um die methodisch geleitete Analyse der geschichtlich-politischen Zusammenhänge, um die Erklärung der Genese unserer heutigen Situation bemühen. Methodisch verbindet sie historisch-verstehende und sozialwissenschftlich-strukturelle Verfahrensweisen in stärkerem Maße, als das in der Geschichtswissenschaft sonst üblich ist. Davon kann und soll auch politische Bildung profitieren. Sie muss ihre politikdidaktischen Kategorien mit zeitgeschichtlicher Anschauung füllen. In Abwandlung eines bekannten Wortes von Immanuel Kant kann man sagen: Politikunterricht ohne Zeitgeschichte ist leer, Zeitgeschichte ohne Politikunterricht ist blind.
Der Blick auf die subjektive Seite der Sache macht aber diese Verbindung noch dringlicher. Die "Mitlebenden" deuten und werten Zeitgeschichte unterschiedlich, und zwar nicht nur individuell, sondern auch als soziale Gruppen und politische Verbände. Hinzu kommt, dass es immer mehrere Generationen sind, die miteinander leben, mit unterschiedlichen geschichtlichen Erfahrungen und Zeitperspektiven; mit unterschiedlichen "Schlüsselerlebnissen", die ihre Deutungsperspektiven bestimmen. Diese gehen unmittelbar in politisches Urteilen ein, weil das Erlebte die Menschen geprägt hat, noch bewegt und umtreibt. Zeitgeschichte ist nach einer bekannten Formulierung von Barbara Tuchman Geschichte, "die noch qualmt".
Politische Bildung kann und soll diese unterschiedlichen Deutungen und Wertungen nicht aufheben. Aber eben deshalb muss sie sich auch als Kommunikationsprozess verstehen zwischen den Gruppen und den Generationen unserer Gesellschaft. Dieser Prozess ist in den letzten Jahrzehnten in bemerkenswerter Weise bereichert worden durch neue Formen und Konzepte der Beareitung von Zeitgeschichte: durch Oral History, Gespräche mit Zeitzeugen, Alltagsgeschichte und Geschichtswerkstätten, nicht zu vergessen die "Gedenkstättenpädagogik". Nur kann man sich des Eindrucks nicht ganz erwehren, als gehe diese Entwicklung an der professionellen politischen Bildung vorbei. Auch die immer noch zunehmende Präsentation von Zeitgeschichte in den Massenmedien fordert politische Bildung heraus. Sie sollte sich gezielt und zusammen mit den Zeithistorikern in das Spannungsfeld begeben zwischen den Primärerfahrungen der Menschen, der öffentlichen Erinnerungskultur von Großgruppen und dem Gemeinwesen, den massenmedialen Präsentationen und wissenschaftlichen Darstellungen(4).
Politische Bildung als Erwachsenenbildung kennt viele Möglichkeiten, der hier gekennzeichneten Aufgabe gerecht zu werden. Für die Schulen heißt die Folgerung aus unseren Überlegungen, neben dem eigenständigen Geschichtsunterricht das Fach "Politik" als zeitgeschichtlich-politischen Unterricht zu konzipieren. Dieser kann nicht darauf warten, bis der Geschichtsunterricht, in welcher Anordnung auch immer, zur Behandlung der Zeitgeschichte gelangt. Er braucht diese als sein Medium ständig und von Anfang an, wenn er Orientierung und Urteilskompetenz in politischen Gegenwartsfragen vermitteln soll.
Anmerkungen
1) Vgl. Sutor, Bernhard: Geschichte als politische Bildung; in: Wolfgang W. Mickel (Hg.): Politikunterricht im Zusammenhang mit seinen Nachbarfächern, München 1979, S. 82 - 102. Ders.: Zeitgeschichte und Politikunterricht; in: Katholische Bildung, Jg. 87/1986, S. 385 - 400. Ders.: Historisches Lernen als Dimension politischer Bildung; in: Wolfgang Sander (Hg): Handbuch politische Bildung, Schwalbach/Ts. 1997, S. 323 - 337, (demnächst in neuer Bearbeitung).
2) Vgl. Jeismann, Karl Ernst: Geschichtsbewusstsein als zentrale Kategorie des Geschichtsunterrichts; in: Ders.: Geschichte und Bildung, Paderborn 2000.
3) Rothfels, Hans: Zeitgeschichte als Aufgabe, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Heft 1/1953, Zitat S. 2.
4) Hockerts, Hans Günter: Zugänge zur Zeitgeschichte; in: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, Nr. 28/2001.
Literatur
Hockerts, Hans Günter (2001): Zugänge zur Zeitgeschichte. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament. Nr. 28.
Jeismann, Karl Ernst (2000): Geschichtsbewusstsein als zentrale Kategorie des Geschichtsunterrichts. In: Jeismann, Karl Ernst: Geschichte und Bildung. Paderborn: Schöningh, Seite 46-72.
Rothfels, Hans (1953): Zeitgeschichte als Aufgabe. In: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. Jg. 1 (1), Seite 2.
Sutor, Bernhard (1979): Geschichte als politische Bildung. In: Mickel, Wolfgang W. (Hg.): Politikunterricht im Zusammenhang mit seinen Nachbarfächern. München: Ehrenwirth, Seite 82-102.
Sutor, Bernhard (1986): Zeitgeschichte und Politikunterricht. In: Katholische Bildung. Jg. 87, Seite 385-400.
Sutor, Bernhard (1997): Historisches Lernen als Dimension politischer Bildung. In: Sander, Wolfgang. (Hg.): Handbuch politische Bildung. Schwalbach/Ts.: Wochenschau, Seite 323-337.
Reader-Impressum
|
Herausgeber der Ausgabe "Historische und politische Bildung":
Prof. Dr. Reinhold Hedtke, Prof. Dr. Dietmar von Reeken |
Herausgeber der Reihe:
sowi-online e. V. Bielefeld |
|
Mitarbeiter der Ausgabe "Historische und politische Bildung":
Prof. Dr. Reinhold Hedtke, Prof. Dr. Dietmar von Reeken, StD Hans-Erich Webers, Joanna Kucza, Anke Eberhard, Dr. Norbert Jacke, |
Ständige Mitarbeiter:
Prof. Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Reinhold Hedtke, Maik Jablonski, Dr. Norbert Jacke, Prof. Dr. Dietmar von Reeken, Volker Schwier, StD Hans-Erich Webers. |
|
Verlag:
sowi-online e. V. Prof. Dr. Reinhold Hedtke Upfeldweg 13 33739 Bielefeld E-Mail: reinhold.hedtke@sowi-online.de |
Redaktionsanschrift:
sowi-onlinereader Universität Bielefeld Fakultät für Soziologie Prof. Dr. Reinhold Hedtke Postfach 10 01 31 33501 Bielefeld E-Mail: forum@sowi-online.de Tel. 0521/106-3986 |